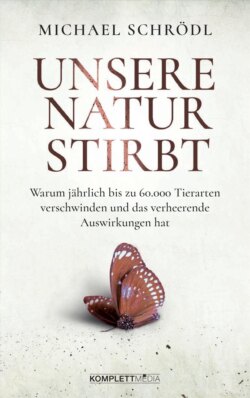Читать книгу Unsere Natur stirbt - Michael Schrödl - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеExkurs:
EINE KURZE GESCHICHTE DER NATUR
Die Natur umfasst unbelebte Materie wie Luft, Wasser und Steine genauso wie Lebewesen – von Bakterien und allein nicht lebensfähigen Viren über Einzeller bis hin zu Pflanzen, Pilzen und Tieren. Und natürlich Menschen. Was wissen wir eigentlich über »unsere« Natur?
Wussten Sie, dass Pilze näher mit den Tieren als mit den Pflanzen verwandt sind? Dass Korallen-Polypen, die Baumeister der Korallenriffe, nicht nur zu den Blumentieren gehören, sondern auch echte Tiere sind? Dass sich frühe Vorfahren von Insekten, Schnecken und Wirbeltieren schon vor über 500 Millionen Jahren in einem Urozean tummelten, während es an Land noch kein höheres Leben gab und die Atmosphäre kaum Sauerstoff, aber sehr viel CO2 und Methan enthielt? Ja, Treibhausgase, an die die damaligen Lebewesen angepasst waren.
Die Natur, belebt oder nicht, hat sich seither gewaltig verändert. Im Laufe von Jahrmillionen sind Kontinente gedriftet, Klimakrisen kamen und gingen, und über Tausende von Generationen an Warm- oder Kalt-, Trocken- oder Feuchtzeiten angepasste Lebewesen setzten sich durch und vergingen wieder. Insgesamt stieg die planetarische Artenvielfalt, das belegen Fossilien, immer weiter an, doch über 90 Prozent aller jemals existierenden Arten starben bereits früher aus. Viele davon während katastrophaler Massenaussterbe-Ereignisse. Fünf davon gab es bereits für Tiere, das letzte vor etwa 65 Millionen Jahren. Der Einschlag eines Meteoriten vor Yucatán und begleitende Klimakapriolen rafften alle Saurier außer den Vögeln dahin, und geschätzte 50 Prozent aller damals vorkommenden Tierarten zu Lande und zu Wasser. Gewinner waren Insekten als Bestäuber von Blütenpflanzen, sie legten eine grandiose Spezialisierung und Auffächerung von Arten hin. Dieser letzten globalen Monsterkrise verdanken aber auch unsere direkten Vorfahren, kleine pelzige Säugetiere, ihren plötzlichen und bis heute andauernden Erfolg gegenüber den Echsen.
Bis heute? Nicht ganz. Denn seit etwa 200 Jahren tun wir Menschen alles erdenklich Mögliche, um eine Zerstörung durch Killerasteroiden »nachzuahmen«. Gerade auch Säugetiere sind betroffen, wir Menschen rotten momentan aber auch alles andere höhere Leben aus, was uns in die Quere kommt. Wir befinden uns im sechsten Massensterben der Erdgeschichte, diesmal menschengemacht.
Wenn Sie nicht gerade im US-amerikanischen Bible Belt zur Schule gegangen sind, wissen Sie vielleicht auch, dass sich die Menschen zweifelsfrei aus affenähnlichen Vorfahren ableiten lassen und der moderne Mensch, der Homo sapiens, erst vor etwa 200.000 Jahren das Spielfeld Erde betrat? Die Wiege der Menschheit war Afrika, doch seit über 60.000 Jahren verließen immer wieder Gruppen von Auswanderern den »Schwarzen Kontinent«. Ja, unser aller Vorfahren waren so schwarz wie Afrika in den markengeschützten Ringen der Olympischen Spiele. Sie kamen über die Ostroute, via Arabien, die Türkei und den Balkan nach Europa. Und sie trafen dort auf Neandertaler, mit denen sie sich paarten und Nachkommen zeugten: uns.
Das ist inzwischen genetisch zweifelsfrei erwiesen. Vor 15 Jahren wurde ich noch belächelt, wenn ich vor Studenten vermutete, dass es Paarungen zwischen menschenähnlichen Wesen gegeben haben musste, einfach weil sich Menschen immer schon so verhielten, ob friedlich oder im Krieg. Dass solche Paarungen fruchtbare Nachkommen zur Folge hatten mit bis heute einigen Prozent Neandertaler im Erbgut (von Homo sapiens), hat mich selbst überrascht. Wir hellhäutigen Europäer, Asiaten, Amerikaner, Australier und auch sonst alle Nicht-Afrikaner sind – Mischlinge. Nicht mit Aliens, aber doch mit Nicht-Menschen, zumindest mit einer anderen Unterart, den robusten und kräftig gebauten Neandertalern, Homo neanderthalensis.
Es kommt aber noch viel besser: Afrikaner waren und blieben mit ihrer dunklen Hautfarbe an starke äquatornahe Sonneneinstrahlung angepasst. Die Auswanderer nach Norden aber, die schwarzen Vorfahren aller heute lebenden Bleichgesichter, hatten ein Problem: Sie bekamen unter winterlichem Schwachlicht in Europa zu wenig Vitamin D ab, und das ist wichtig für das Immunsystem. Insbesondere bei nordischem Schmuddelwetter holt man sich ja schnell böse Infektionen, und Auskurieren im warmen Bettchen gab es in den feuchtkalten Höhlen nicht. Unsere Vorfahren, genauer gesagt alle nicht schwarzafrikanischen modernen Menschen, passten sich in höheren Breiten durch Pigmentverlust an den UV-Mangel an. So hieß es bis vor Kurzem jedenfalls. Dann fanden Genetiker heraus, dass wir weißen Menschen unsere helle Haut wohl von den Neandertalern geerbt haben!
Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen: Wir alle, beziehungsweise unsere damaligen Genträger, waren Nachfahren pelziger Menschenaffen, kamen dann nackig und auf zwei Beinen von Afrika nach Europa marschiert, und natürlich waren wir damals alle schwarz. Warum ich darauf herumreite? Weil wir alle Nachfahren von farbigen Migranten aus dem sonnigen Süden sind, Klima- und Wirtschaftsflüchtlinge, Abenteurer. Das dürfte heutigen Nationalisten, rechten Populisten und grantigen alten weißen Männern nicht gefallen, oder? Früher kam dann gelegentlich der Spruch, Weiße wären halt nun mal der Gipfel der Evolution. Na ja, aber die Menschen, die jetzt nicht mehr schwarz sind und nun auch im Winter genug Vitamin D in der Haut produzieren, also wir hier, die allermeisten Europäer, grantig oder nicht, haben das der Paarung mit schon damals weißen (!) Neandertalern zu verdanken! Moment, aber waren die Neandertaler nicht stämmige, zottelige, primitive Wilde mit allzu prägnanten Überaugenwülsten, von Sprache und Kultur keine Spur? Ja, auch das waren wohl alles Vorurteile. Ob wir die auch von den Neandertalern geerbt haben?
»Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft!«
Wilhelm von Humboldt
Ob friedlich oder kriegerisch, die Neandertaler starben mitten in der letzten Eiszeit aus, vor über 30.000 Jahren. Unsere Homo sapiens-Vorfahren samt unserem genetischen Neandertaler-Erbe breiteten sich über sämtliche Kontinente aus, schafften es, die letzte Vereisung bis vor gut 10.000 Jahren zu überstehen, und fanden danach im sich erwärmenden Eurasien immer bessere Lebensmöglichkeiten. Aus Höhlenmenschen und jagenden Nomaden wurden erste Tierzüchter und in Kleinasien bereits Siedler mit Landwirtschaft.
Weiß oder Schwarz, bis vor etwa 10.000 Jahren verhielten sich Menschen im Wesentlichen als Teil der Natur, lebten in kleinen Gruppen oder streiften als Nomaden einher, jagten Tiere und sammelten Wurzeln und Beeren. Vermutlich haben schon solche frühen Menschen einige Großtierarten dezimiert, etwa das Riesenfaultier in Südpatagonien oder das Mammut in Eurasien. Das mag zu deren Ausrottung in der sich bewaldenden und damit für die Tundra bewohnenden Riesenviecher zunehmend ungeeigneten Landschaft beigetragen haben. Insgesamt aber waren die Menschen fast überall auf der Erde noch zu wenige, um die Landschaft prägend zu verändern.
Die Entwicklung von Landwirtschaft, Bewässerung, Vorratshaltung, Viehzucht, Siedlungen, immer wirkungsvolleren Werkzeugen und Waffen nahm nicht nur selbst Einfluss auf größere Regionen, sondern ermöglichte auch massiven Bevölkerungszuwachs. Trotz aller Kriege und Seuchen, die Menschen wurden immer mehr, drängten die wilde Natur zurück und veränderten das Antlitz der Erde dauerhaft.
Seit etwa 2000 Jahren tun sie das messbar und massiv, weswegen man zumindest die letzte Phase dieses modernen Zeitalters des Menschen als das »Anthropozän« bezeichnen kann. Wir waren damals nicht mal 200 Millionen Menschen und haben uns seither unauslöschlich im gesamtplanetarischen geologischen Nachweis verewigt. Aber nicht, wie man meinen möchte, durch Häuser und Straßen, Denkmäler und geniale Schaffenskraft, sondern durch Asche, Staub und schädliche Chemikalien. Also im Wesentlichen durch Verwüstung und Dreck.
Menschenstämme und Dörfer gab es bereits auf sämtlichen Kontinenten außer in der Antarktis. Insbesondere in Mittelamerika, in Kleinasien, China und im Mittelmeerraum gab es auch städtische Kulturen mit entsprechendem Bedarf an Ressourcen. So haben Römer und andere antike Völker für Schifffahrt, Bauwerke und Kriege fast sämtliche Küstengebiete des Mittelmeeres entwaldet, fruchtbare Böden ausgezehrt und schon damals in den Wasserhaushalt und das Klima ganzer Regionen eingegriffen – natürlich mit Konsequenzen für sämtliche Lebewesen.
Wilde mediterrane Macchia, karstige Felsküsten, erodierte Hügel so weit das Auge reicht – fast alles ist Menschenwerk, oder zumindest dessen Konsequenz.
Mitteleuropa war seit Rückgang der eiszeitlichen Gletscher sehr waldreich, nur Küsten und Flussläufe waren dichter besiedelt. Das änderte sich über das Mittelalter. Aus wilder Natur entstanden im deutschsprachigen Raum allmählich flächendeckende Kulturlandschaften.
Für Arten, die weite wilde Naturräume oder ganz spezielle, nun urbar gemachte Habitate brauchten, war das schlecht. Doch viele Arten kommen auch mit einer wenig intensiven Landnutzung durch Menschen zurecht oder werden sogar dadurch begünstigt. In Europa hatte sich über Jahrhunderte eine kleinräumige und vielfältige bäuerliche Land- und Forstwirtschaft entwickelt, mit Weidewirtschaft auf mageren, blumenreichen Streuobstwiesen und in Wäldern mit alten Bäumen. Eichen und Buchen lieferten Früchte für die Schweinehaltung, andere Waldbereiche wurden immer wieder auf den Stock gesetzt und lieferten Brennholz und, ganz nebenbei, durch Nutzung ausgemagerte Standorte mit reicher Flora und Fauna am Waldboden. Äcker waren klein, zerstreut und von Hecken und Steinhäufen mit Beerengebüschen begrenzt. Der Boden wurde mühsam per Hand oder Ochsen gepflügt, und im Saatgut war ein hoher Anteil an Ackerwildkräutern, die ebenfalls vielseitig genützt wurden. Man kann den Strukturreichtum und die Artenfülle solcher Landschaften, aber auch die Mühsal händischer Arbeiten, heute noch beispielsweise im östlichen Rumänien bewundern.
Das bäuerliche Leben war hart, es herrschte Nährstoffmangel, und Dung wie Gülle aus dem Weidebetrieb waren wertvoller Dünger für die Äcker, deren Früchte man natürlich selber aß und nicht an Tiere verfütterte. Doch Mitteleuropa war bis in das 20. Jahrhundert hinein so blüten- und artenreich wie nie zuvor.
Heute kaum mehr vorstellbar ist auch der kleinteilige, mosaikartige Charakter der Landschaft, mit Unmengen von Hecken, Büschen, Gräben, Wällen und einem schier unglaublichen Reichtum an trockenen, mageren oder feuchten, sumpfigen Standorten, jeweils mit reicher Pflanzenpracht und an solche Standorte angepasstem Kleingetier. Am ehesten kann man solche engräumige natürliche Vielfalt noch in manchen Almregionen und Hochgebirgen bewundern.
Im Flachland wurden bereits großflächig Moore entwässert und Torf, über Jahrhunderte abgelagerte Torfmoosreste, als Brennmaterial gewonnen. Tümpel und Teiche gab es noch reichlich, Bäche und Flüsse waren naturbelassen und konnten bei Schneeschmelzen und Starkregen durch weite Auwälder und Überflutungswiesen Überschwemmungen abmildern. Lokale Umweltverschmutzung durch Kloaken und Chemikalien gab es nur in den Städten und stadtnahen Gewässern. Ansonsten laichten noch Lachse im Rhein, die großen Malermuscheln waren häufig und dienten den Künstlern am Starnberger See als Farbtöpfchen, und reichlich vorhandene Flussperlmuscheln in Urgesteinsgebieten wurden von Königshäusern und Adligen nach Perlen befischt.
Erst mit dem Beginn der Industrialisierung vor etwa 200 Jahren begann die Bevölkerung, fast überall regelrecht zu explodieren. Von etwa einer Milliarde auf über 7,5 Milliarden. Mehr Menschen, mehr Technik, mehr Nahrungsbedarf, mehr Konsumkraft, noch mehr Einfluss auf Natur und Umwelt: Der industrialisierte Mensch machte sich die Erde sehr zügig untertan, bis hin in sehr entlegene Gebiete. Dazu gleich mehr. Erst kehren wir einmal vor der eigenen Haustür.