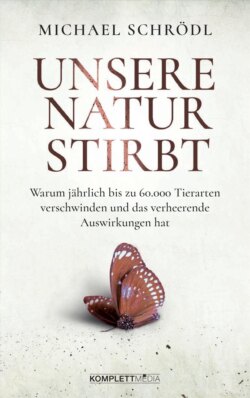Читать книгу Unsere Natur stirbt - Michael Schrödl - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDIE BIOLOGISCHE KRISE
Wenn ich das Thema »Mensch macht Umwelt, Lebewesen und damit seine eigene Lebensgrundlage kaputt« in meinen Vorlesungen anschneide und in Vorträgen ausführe, denken anfangs offenbar viele Zuhörer insgeheim »na ja, weiß ich schon«. Schließlich sind die Medien mittlerweile – endlich – voll davon, und so manche Fachleute tun ihre Meinungen kund. Biologen waren selten dabei und Artenforscher schon gar nicht. Ich spreche also von vielerlei speziellen und regionalen Aspekten der Artenforschung und des Artenschwunds, erweitere den Fokus, beleuchte Ursachen und globale Zusammenhänge. Und spätestens hier bemerke ich an den teils erstaunten, teils erschreckten oder ungläubigen Gesichtern, dass meine Zuhörer eben doch nicht alles wussten, entscheidende Verbindungen nicht bedachten oder sich schlichtweg scheuten, sich globale Konsequenzen abnehmender Biomasse und aussterbender Arten auszumalen.
Blicken wir kurz aus dem Fenster auf das Naheliegende: Überdüngtes Einheitsgrün statt farbenfroher Feuchtbiotope, Maiswüsten statt summender Blumenwiesen, öde Fichtenforste statt von Gezwitscher erfüllte Wälder, direkt vor unserer Nase, in Deutschland und drum herum. Ältere Naturfreunde bemerken den Unterschied zu früher, als man vielerlei verschiedene Schmetterlinge nicht lange suchen musste. Die Jungen und die vielen Stadtmenschen bemerken das nicht, sie haben ja keine Vergleichsmöglichkeiten – »shifting baselines« wird dieses Phänomen genannt.
Erlebt man als Kind keine intakte Natur, hatte man nie mit frei lebenden Pflanzen und wilden Tieren zu tun, erkennt und erwartet man sie später auch nicht. Umso wichtiger sind Bildungs- und Erlebnisprogramme in freier, möglichst vielfältiger und intakter Natur, wenn man sie denn noch selbst kennt.
Überhaupt gelten Städte in Mitteleuropa inzwischen als artenreicher als das intensiv beackerte und bespritzte Umland. Was nicht allzu viel bedeutet, denn vielerorts werden sogar Hausspatzen selten. Und leider gibt es die meisten seltenen Arten in den Städten sowieso nicht, sondern nur an besonderen und besonders bedrohten Stellen draußen in der Natur. Etwa 30 Prozent der etwa 48.000 Tierarten in Deutschland werden bis 2050 ausgestorben sein, so die offizielle Schätzung. Bei den Weichtieren, also Muscheln und Schnecken, sind von den etwa 333 Arten an Land und im Süßwasser über 60 Prozent bedroht bis ausgestorben. Über 60 Prozent!!!
Aussterben funktioniert so: Lebewesen wandern aus oder sterben, wenn die Lebensräume verschwinden und die Umweltbedingungen nicht mehr passen. Arten werden seltener, die genetische Vielfalt und damit die Reaktionsmöglichkeiten auf Umweltveränderungen schwinden, örtliche Populationen erlöschen. Schließlich verschwindet die Art – für immer! Insgesamt, über alle Tiere, Pflanzen und Mikroben hinweg, ein tragischer, irreparabler Verlust an Naturgeschichte, direkt vor unserer Nase und durch unser Tun und Unterlassen! Für Gläubige ein Verlust der Schöpfung, für Fühlende ein tragisches Unrecht, für kühle Rechner ein mieses Geschäft.
Biomasse macht’s
»Sterben die Bienen, stirbt der Mensch!« Der Spruch stammt zwar wohl doch nicht von Albert Einstein, birgt aber viel Wahres.
Sterben die Honigbienen, leiden die Imker, leidet die Bestäubung von Wildpflanzen und Nutzpflanzen, leidet ein Großteil der landwirtschaftlichen Produktion wie Obst- und Gemüseanbau, aber auch der Raps. Von den Blütenpflanzen werden im Wesentlichen nur Gräser und Nadelbäume vom Wind bestäubt, Pflanzen mit deutlich sichtbaren Blüten brauchen dagegen meist Insekten, also Honigbienen, Wildbienen und andere Krabbel- und Fliegetierchen, sonst gibt es keinen Nachwuchs und keine Produktion von essbarer Pflanzenmasse. Jeder weiß inzwischen, Insekten werden dramatisch weniger, also wird weniger bestäubt. Im von Umweltverschmutzung besonders geplagten China bestäuben schon menschliche Helfer per Hand die Obstbaumblüten. Klar, Arbeitskraft ist auf dem Land noch billig, und was kann es Schöneres geben, als den ganzen Tag an der frischen Luft zu sein und Tausende von Blüten mit einem Pinsel zu beglücken? Schon werden Bestäuberdrohnen entwickelt, doch wie viele davon bräuchte man wohl, um die Milliarden von Blüten auf einem einzigen Feld zu besuchen? In den auf kompromisslose Agrarwirtschaft getrimmten USA gibt es in den endlosen und stark bespritzen Agrarwüsten keine Bienen mehr. Braucht man welche, werden mobile Imker-Trucks mit Hunderten von Bienenstöcken gemietet. Bee-Ware!
Der Mensch ist erfinderisch. Für spezielle lokale Probleme mag es passable, unerwartete technische Lösungen geben. Für komplexe, generelle, überregionale Probleme aber nicht!
Artenvielfalt macht’s erst recht
In jedem Lebensraum gibt es vielerlei Arten, etwa Pflanzen, die unter Licht CO2 in Biomasse binden, Tiere, die Pflanzen oder andere Tiere fressen, und Mikroben, die überschüssige Substanz abbauen oder weiterverarbeiten. Manche Arten haben sehr spezifische Anforderungen, andere sind Generalisten. Manche Gruppen bestehen aus Millionen einzelner Tieren stattlicher Größen – man denke an Gnus oder vielerlei Seevögel. Viele Arten bestehen aus Milliarden winziger Individuen, die sich gegenseitig fressen oder bestimmte Tätigkeiten verrichten oder Produkte herstellen, die sie und wir benötigen. Honigbienen etwa, die auch Nutzpflanzen bestäuben und Honig produzieren.
Die allermeisten Arten aber sind klein und selten – und dennoch wichtig. Neuere Forschungen zeigen, wie wichtig etwa die zusätzliche Bestäuberleistung der über 500 Wildbienenarten allein in Deutschland ist: Jede hat andere Vorlieben, was die Blüten angeht und wann und wo bestäubt wird, etwa bereits bei kühlen Temperaturen, in der Dämmerung oder auch bei feuchtem Wetter, wenn die Honigbienen in ihren Stöcken auf bessere Sammelbedingungen warten. Dazu kommen Aberhunderte Arten von Hummeln, Schwebfliegen, Schmetterlingen; alle mit ihren speziellen Vorlieben und besonderen Fähigkeiten.
Gibt es vielerlei verschiedene Arten in einem Lebensraum, etwa die vielen Wildbienenarten und andere Bestäuber, übernehmen sie zahlreiche Funktionen im Ökosystem. Ändern sich die Umweltbedingungen und fallen einige Arten aus, übernehmen andere Arten deren Funktionen und vermehren sich. Die viel zitierte Nahrungskette ist in Wahrheit ein Nahrungsnetz, das funktioniert, auch wenn das eine oder andere Glied mal ausfällt. Anders gesagt: Naturnahe Ökosysteme mit vielerlei Bestäubern sind robust. Gibt es aber nur noch Honigbienen, also unsere Haustiere, und fallen diese aus, etwa wegen der gefürchteten Varroa-Milbe, wegen Pestiziden oder wegen der Kombination aus beidem, ist die Bestäubung und damit die Funktion ganzer Ökosysteme bedroht.
»Diversity« ist also nicht nur in der modernen Wirtschaft gefragt, sondern überall in der Natur und insbesondere auch auf dem Acker. Als aktuelles Beispiel die Glyphosat-Debatte: Mit dem giftbedingten Ableben von Mikroben und Kleintieren in den Ackerböden leidet auch die Fruchtbarkeit der weltweiten industriellen Landwirtschaft. Immer mehr und neue Kunstdünger, Pestizide und »grüne« Gentechnik heißen einige der Notnägel, die unsere Versorgung mit Nahrung sichern sollen. Noch, und mit allerlei unschönen Nebenwirkungen und viel mehr Verlierern als Gewinnern. In den südamerikanischen Sojaplantagen für unsere Massentierhaltung genauso wie in trostlosen Ölpalmenhainen in Südostasien. Wo einst artenreichster Regenwald war, erodiert nun der Boden. Es fehlt an Wasser zum Bewässern der Felder, zum Tränken des Viehs, als Getränk für den Mensch. Ohne Regenwald regnet es immer weniger, und es wird heißer, was höhere Verdunstung bedeutet, also immer mehr und heftigere Dürren, weniger Ernte, Ausdehnung der Monokulturen auf sterbende Wälder in der Umgebung …
Sauberes Trinkwasser, ein teurer Luxus, sogar in der meist regenreichen Güllegrube Deutschland – von angeblich guter Landluft ganz zu schweigen. Wir Menschen, insbesondere aus den Industrieländern, zerstören momentan die Vielfalt des Lebens, zerstören ganze Lebensräume daheim und in fernen Kontinenten, zerstören unsere eigene Lebensgrundlage.
Auf zum globalen Ökozid!
Wir vernichten ganze Lebensräume, zu Hause und in aller Welt. Und zwar sehr rasch. Wussten Sie, dass die globalen Korallenriffe wohl vor dem Jahr 2050 verschwunden sein werden? Dass die globale Meeresfischerei bis dahin kollabiert sein wird? Dass riesige Regenwälder innerhalb weniger Jahre vertrocknen könnten? All das mit extremen Folgen für Milliarden Menschen, das Weltklima, die Weltwirtschaft, den Weltfrieden.
Nein, wussten Sie nicht? Oder wollen Sie es gar nicht so genau wissen? Das ist typisch für die allgemeine Wahrnehmung der globalen biologischen Krise, die noch allzu gern als Privatproblem der Liebhaber von Bienchen und Blümchen abgetan wird. Der Naturromantiker und weinerlichen vegetarischen Öko-Fuzzis, die sich vor ein bisschen Glyphosat im Müsli fürchten und besserwisserisch am weltrettenden Gänseblümchentee saugen.
Echte Probleme sind viel konkreter, sind wirtschaftlicher Art, haben mit Arbeitsplätzen, Industrieproduktion, Karriere, Konkurrenz und Wettbewerbsfähigkeit zu tun, nicht wahr? Vielleicht auch mit Anschaffungen, Krediten und Annehmlichkeiten? Und auch mit Ihrer Gesundheit, dem Wohlergehen Ihrer Lieben, der Sicherheit Ihrer Besitztümer. Ist doch normal. Die Jacke ist einem halt näher als die Hose, alles eine Sache der Prioritäten.
Sie sind beileibe kein schlechter Mensch, haben durchaus Mitgefühl, wenn ein Haustier leidet oder mal wieder irgendwo ein Tsunami oder Erdbeben Schreckliches anrichtet. Und, ja, Sie spenden auch manchmal. Der Welthunger, an dem immerhin noch 800 Millionen Menschen leiden, ist nicht schön. Aber halt weit weg. Und helfen kann man da eh nicht wirklich, glauben nicht nur Sie. Dasselbe gilt für all die Krankheiten, wäre sowieso besser, wenn es weniger Dschungel mit seltsamen Viechern und all den Krankheitsüberträgern drin gäbe. Wären schön ordentliche Felder und Wiesen nicht besser, und ist industrielle Landwirtschaft nicht sowieso nötig, um all die hungrigen Mäuler zu ernähren? Wer soll sich schon »Bio« leisten, und steigt die weltweite Geburtenrate nicht immer noch? Na eben, ohne moderne, sogenannte »grüne« Agrartechnik geht das nicht, da würden ja Hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden verhungern, hört man doch immer wieder! Auch die vielen Kriege sind schlimm, aber, Gott sei Dank, sind auch die relativ weit weg. Wer wollte da nicht zuallererst an die eigene Sicherheit denken? Und bekäme sie auch, wenn es keine globalen ökologischen und ökonomischen Zusammenhänge gäbe und uns der Rest der Welt nur mit seinen Problemen in Ruhe lassen würde. Tut er aber nicht.
Sie haben vom Klimawandel gehört, der weite Gebiete verdorren lässt, riesige Seen austrocknet, Landwirtschaft, Viehzucht und Fischfang unmöglich macht. Schlimm für die Bewohner. Natürlich müssen all die armen Teufel irgendwo hin. Und natürlich, das sagen sämtliche Klimamodelle auf allen seriösen Kanälen, wird es immer noch wärmer und die Not dadurch nicht weniger, sondern mehr werden. Aber eben nicht bei uns, im klimatisch gemäßigten Mitteleuropa, hoffen Sie zumindest.
Wir sitzen das einfach in Ruhe aus. Wir müssten uns nur effektiv gegen Eindringlinge schützen und uns daheim an den Klimawandel anpassen, das sagen auch die Politiker. Schließlich haben wir Außengrenzen und Technologie. Wir sind Dichter und Denker, fleißige Hausfrauen, ehrbare Kaufleute, die besten Ingenieure, waren Exportweltmeister, Papst und Fußballweltmeister. Und die Amerikaner schießen Teslas in den Orbit und planen Kolonien auf Mond und Mars. Was soll uns der Wandel im Rest der Welt schon anhaben? Was soll mir das ganze Schlamassel irgendwann in ferner Zukunft schon tun können?
Wenn Sie auch nur ansatzweise so denken, muss ich Sie enttäuschen. Schon der Wandel in Mitteleuropa wird dramatisch werden, insbesondere im Alpenraum und in heute schon trockenen Ecken der Republik, aber auch bei Ihnen vor der Haustür. Bis zum Jahr 2100 werden nicht nur Skilifte, sondern auch Fichtenforste und Buchenwälder aus niedrigen Lagen verschwinden, Wetterkapriolen mit Erdrutschen, Überflutungen, Dürren, Stürmen und Tornados zunehmen. Kennen Sie das alles schon aus den Nachrichten? Haben Sie diese Zukunft schon in Ihre Ansichten eingespeist?
Doch halt, so weit wird es ja gar nicht kommen, denn schon lange vorher, vermutlich zwischen 2030 und 2050, ereilt uns die globale biologische Krise, die globale Not, das Ende der Zivilisation. Aus der scheinbaren Bienchen-und-Blümchen-Krise wird rasch eine globale Biokalypse.
Biokalypse noch vor 2050!
Ja wie? So bald schon? Das könnte Sie also wohl doch noch höchstpersönlich betreffen! Und Ihre Kinder, Verwandten, Freunde auch! Aber davon hätten Sie doch bestimmt schon gehört?
Das haben Sie wohl auch, nur nicht in letzter Konsequenz. Denn die klingt ungut. Macht ein »Weiter so« unserer Lebensweise unmöglich. Würde eine rasche und weitreichende Änderung von uns allen, unserer Denk-, Lebens- und Handlungsweisen erfordern – und wäre doch recht einfach und ohne große Einbußen an Wohlstand und Komfort machbar.
Habe ich Ihr Interesse?
Dann folgen Sie mir bitte zunächst in die Welt der Wissenschaft, denn die belegt das oben Gesagte. Danach werde ich die Ursachen und Konsequenzen unserer viel zu umweltschädlichen Lebensweise noch genauer aufzeigen und eine globale Prognose für die nächsten Jahrzehnte wagen. Und schließlich möchte ich Ihnen die Vielzahl an Möglichkeiten nahebringen, um die Biokalypse zu vermeiden.
Im globalen Wandel brauchen wir einen globalen Sinneswandel. Damit die Natur leben kann – und wir auch.