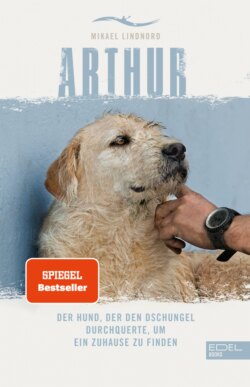Читать книгу Arthur - Mikael Lindnord - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nach Åre und weiter, 1995 und danach
ОглавлениеWenn ich eins hasse, dann das Gefühl, das mich überfällt, wenn ich glaube mich verlaufen zu haben. Vielleicht erinnere ich mich an all die Stunden, die ich als Junge damit zugebracht habe, die ganzen Checkpoints im Wald zu finden. Vielleicht liegt es auch an der Panik, die in mir aufsteigt, wenn ich mitten im Dschungel auf eine schlammverspritzte Karte schaue und partout nicht weiß, auf welchem Weg wir uns befinden. Oder vielleicht weiß ich einfach, dass man immer verliert, wenn man sich einmal verlaufen hat. Was es auch ist, diese Hilflosigkeit hasse ich.
Glücklicherweise bin ich durch meine Militärzeit wesentlich sicherer im Orientieren geworden. Nichts schärft die Sinne mehr als dreißig Typen, die sich bei -35 Grad Celsius darauf verlassen, dass du die Geländekoordinaten richtig verstehst.
Allmählich verstand ich, dass ich auf manchen Gebieten gut war, und dabei war Skilaufen meine Lieblingsdisziplin. In der Armee machten wir oft Langlauf. Ich merkte, wie ich besser und besser darin wurde, und irgendwann konnte ich vom Skilaufen nicht mehr genug bekommen. Oft verbrachte ich auch meine freien Tage beim Abfahrtslauf mit anderen Kadetten. Die Armee besaß eine Skihütte in dem kleinen Skigebiet Riksgränsen und wir konnten unseren Sold für den Heimaturlaub in Bustickets und Skipässen anlegen.
Bei alldem verabredete ich mich natürlich weiter mit Helena. Es war schwierig, sie so häufig zu treffen, wie ich gern gewollt hätte. Ich erinnere mich, dass wir uns oft geschrieben haben – Liebesbriefe, muss man wohl sagen. Ich schrieb so gern welche, wie ich mich über die Antwort freute. Aber reden konnten wir leider nicht sehr oft miteinander.
„Nur eine Leitung, und die ist ständig besetzt“, klagte sie immer. Sie hatte recht. Weil man heute stets in Kontakt bleiben kann, da jeder ein Handy hat, kann man sich das kaum noch vorstellen, aber damals mussten wir uns am Telefon anstellen. Wir mussten uns die Telefonzeit erkämpfen. Kein Wunder, dass einige frische Beziehungen auf der Strecke blieben.
Das galt jedoch nicht für uns. Zwar nahm vieles unsere Zeit in Anspruch – Helena ging noch zur Schule und musste neben dem Reiten, dem Fußball und all dem anderen Sport reichlich lernen –, doch wir nahmen uns auch Zeit füreinander. Uns verband etwas Ernstes, und das wussten wir auch.
Nach meiner Militärzeit machte ich eine Ausbildung zum Skilehrer in Jarpen bei Åre, dem größten Skigebiet Schwedens. Helena sollte nach ihrer Schulzeit zu mir ziehen. Zusammen wollten wir unserem Sport nachgehen und über unsere Zukunft nachdenken.
Da ich ja jetzt erwachsener war, nahm ich auch wieder Unterricht – denn ich wollte die Prüfungen ablegen, bei denen ich in der Schule nicht ganz durchgekommen war. Helena wollte mit mir zusammenarbeiten und gemeinsam wollten wir die Weichen stellen, um Geld zu verdienen und zusammen durchs Leben zu gehen.
Aber mit dem Skifahren war es bei mir vielleicht ähnlich wie mit dem Eishockey. Vielleicht hätte mir jemand sagen sollen, dass ich nicht in der ersten Liga spielte. In diesem ersten Jahr verließ mich ein wenig der Mut. Was ich damals allerdings nicht ahnen konnte, war, dass ein paar der Typen, mit denen ich Ski fahren ging, später zu den größten Ski-Assen der Welt gehören sollten. Ich sah nur, dass sie besser waren als ich.
Aber ich war in der glücklichen Lage, das tun zu können, was mir Spaß machte, so viel wusste ich. Außerdem wurde mir allmählich klar, dass ich nie den Weg einschlagen würde, den alle anderen gingen. Selbst nach ein paar bestandenen Prüfungen wusste ich wohl, dass ich immer das tun würde, wozu ich Lust hatte, statt mir einen Job zu suchen, statt das zu tun, was andere von mir verlangten.
Eines Tages werde ich eine Antwort auf die Frage haben: „Was willst du eigentlich machen, wenn du erwachsen bist?“
Wie so oft hatte die Sache einen Haken. Eigentlich wollte ich am liebsten den ganzen Tag Ski fahren – vor allem das Skibergsteigen hatte es mir angetan, bei dem man mit Steigfellen unter den Skiern die Hänge erklimmt –, doch als Skilehrer muss man natürlich auch jemandem etwas beibringen. Und manche Leute, denen ich etwas beibringen sollte, waren sehr jung; Kinder, um genau zu sein. Dazu fehlte mir einfach die Geduld. Ich wollte mich an den Besten messen, aber einen Schritt zurückzutreten und Anfängern etwas zu erklären, war nichts für mich.
Heute erscheint mir das alles unendlich weit weg. Da ich nun selbst kleine Kinder habe, habe ich in mir die Fähigkeit zu endloser Geduld entdeckt. Ich will sie bei allem begleiten, was sie gern wollen – das heißt, falls sie überhaupt Sport treiben möchten; natürlich müssen sie gar nichts machen –, und es wird mir Freude bereiten, es langsam und gründlich angehen zu lassen. Damals jedoch war ich jung und kämpferisch und wollte stets der Beste sein und mich mit den Besten umgeben.
Darüber hinaus allerdings hatte ich den Sport entdeckt, der mich auf ewig faszinieren wird – Adventure Racing. Als Adventure Racer macht man alles Mögliche – Laufen, Mountainbiking, Kajaking –, und zwar in Teams, ohne Pause, über mehrere Tage. Das macht Adventure Racing zur wohl ultimativen Herausforderung für Körper und Geist. Die Grundprinzipien sind relativ einfach, doch die Logistik ist komplex. Ein Team, meist bestehend aus drei Männern und einer Frau, muss per Mountainbike, zu Fuß, in Kajaks und manchmal durch Abseilen, Klettern oder Schwimmen von A nach B gelangen (wobei B meist Hunderte Kilometer von A entfernt ist). Die Uhr läuft ab Tag eins und wird erst angehalten, wenn man entweder auf der Strecke bleibt oder die Ziellinie überquert, manchmal erst nach mehr als einer Woche. Es ist also Eile geboten – und Schlafmangel wird zunehmend zum entscheidenden Faktor.
Heute finden im Rahmen der Adventure Racing World Series das ganze Jahr über Ausdauerrennen auf der ganzen Welt statt, doch der Höhepunkt ist die Weltmeisterschaft im November. Dann müssen die weltbesten Teams in absoluter Topform sein, denn das Rennen wird in den weltweit unwirtlichsten Gebieten abgehalten – etwa in Wüsten oder im Schnee – und geht über 600 bis 800 Kilometer. Das bedeutet, dass selbst die schnellsten Teams fast 120 Stunden, also fünf Tage am Stück, unterwegs sind, und das bei nur wenigen Stunden Schlaf.
Bei einem guten Adventure Racer muss eine seltene Kombination von Fähigkeiten zusammenkommen. Neben der selbstverständlich nötigen überragenden Fitness ist Loyalität meiner Meinung nach die wichtigste. Das Viererteam muss während des ganzen Rennens zusammenbleiben – die Mitglieder dürfen sich nicht mehr als fünf Meter voneinander entfernen. Das Team muss also eins sein und immer an einem Strang ziehen. Die Mitglieder müssen sich bei wichtigen Entscheidungen einig werden und einander unterstützen. Diese Unterstützung kann alle möglichen Formen annehmen. Wenn etwa einer im Team nur langsam vorankommt, vielleicht weil er oder sie Probleme mit der Höhenlage hat, können stärkere Mitglieder das schwächere auf dem Rad oder beim Trekken mitziehen. Und wenn jemand wirklich krank oder verletzt ist, kann er oder sie notfalls auch getragen werden. Man teilt Nahrung und Wasser und ermuntert und unterstützt einander, wenn – oder besser: sobald – die Erschöpfung einsetzt.
Es gibt keinerlei Unterstützung von außen, lediglich wichtige medizinische Hilfe und Verpflegung in den Wechselzonen. Dort wechselt man von einer sportlichen Disziplin zur nächsten, zum Beispiel vom Trekking zum Radfahren. Man muss also beispielsweise darauf achten, dass die Bikes gut verpackt und für die nächste Etappe ordentlich gewartet sind; jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass die richtige Ausrüstung zur nächsten Wechselzone transportiert wird. Man muss sicherstellen, dass Art, Gewicht und Menge des Equipments stimmen (egal, ob es sich um das Gewicht der Bikebox, die Rettungsdecke oder die Energieriegel dreht), man muss also exakt planen und besonders gut vorausschauend denken können. Da man sich ausschließlich mithilfe von Karten orientieren darf, muss mindestens ein Teammitglied gut im Kartenlesen sein. (Kein Wunder, dass ich in unserem Team nur zweiter Navigator bin.)
Außerdem muss man für jede Phase des Rennens die Taktik planen – vor allem die Frage, wann man schläft, ist wichtig. Oder ob man schläft: Manche Teams entscheiden sich für zwei Stunden Schlafpause am Stück, andere powern die Nacht über durch. Man muss also klug und flexibel taktieren können. Weil man bei Schlafmangel nicht nur langsamer wird, sondern oft auch zu halluzinieren beginnt, muss ein bisschen Schlaf immer sein, so heiß man auch darauf ist, ganz vorne mitzulaufen; und das richtig zu planen, ist entscheidend.
Dazu kommt natürlich, dass die wichtigen Rennen in ganz verschiedenen, unwirtlichen Gegenden der Welt ausgetragen werden – im Gebirge, bei Eis, im Regenwald, durch Stromschnellen, über Felsen –, und manchmal kommen nicht nur Schlamm, Regen und Wasserfälle dazu, sondern auch giftige Schlangen und Insekten. Oft bewegt man sich außerdem auf großer Höhe und die Temperaturen schwanken zwischen eiskalt und 40 Grad Celsius bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Daher muss man natürlich besonders fit sein. Nicht nur fit genug für Sprints zu Fuß oder auf dem Rad in einfachem Gelände, nicht nur fit im Oberkörper, dass man sich am Seil über eine Schlucht hangeln oder durch Stromschnellen paddeln kann, sondern auch mental fit und stark genug, um durchzuhalten – trotz Schlafentzug, Schmerzen und Hunderter anderer Unbequemlichkeiten, die einen beim Abenteuersport in widriger Umgebung über Tage hinweg belasten.
So etwas ist nicht jedermanns Sache.
Ich behaupte sogar, dass die meisten noch nicht einmal verstehen können, was uns zu einer derart extremen Sportart treibt, die ein normaler Mensch wohl eher als „Folter“ bezeichnen würde.
Aber ich liebe diesen Sport aus genau diesen Gründen: wie er einen auf die Probe stellt, wie er von einem verlangt, sich mit sich selbst genauso zu messen wie mit den anderen Teams. Der Gewinn der Weltmeisterschaft wäre für mich absolut das Größte. Würde man mich vor die Wahl stellen, eine Tasche mit zwei Millionen Dollar zu bekommen oder bei der Weltmeisterschaft oben auf der Siegertreppe zu stehen, ich würde mich jederzeit für das Siegerpodest entscheiden.
Ich habe immer versucht, anderen zu erklären, dass ich bei mir – und bei anderen Adventure Racern – den Eindruck habe, dass wir eine andere Art „Komfortzone“ besitzen. Ich würde behaupten, dass meine größer ist als bei den meisten Menschen. Ich will damit sagen, dass die meisten ihre Belastungsgrenze kennen. Für einige kann das ein Marathonlauf sein, aber für uns ist ein Marathon nur Tag eins von sieben Tagen. Für viele mag eine Kanufahrt ein kleines Abenteuer sein. Überall sehen sie Gefahren. Da ich aber meine Grenzen kenne, ist für mich die Gefahr viel weiter weg.
Ich bin schon vier Tage durch Costa Rica gerannt und habe dabei nur eine Stunde geschlafen. Ich habe sieben Tage Rennen durchgestanden, obwohl mir ein Stück der rechten Ferse fehlte. Ich habe ein Rennen über sechs Tage mit schwarz-gefrorenen Zehen gemeistert (und gewonnen). Ich hatte Halluzinationen und den metallischen Geschmack im Mund, der ankündigt, dass der Körper sich bald abschalten wird.
Meine Komfortzone ist im Vergleich zu fast allen anderen Menschen riesig, denn solange es nicht so schlimm ist wie in diesen Beispielen, solange ist alles in Ordnung. Und das ist es, was die meisten nicht verstehen.
Und ehrlich gesagt: Ich verstehe, dass sie es nicht verstehen.
In Åre führten Helena und ich das Leben rund um den Outdoor-Sport, das wir uns erträumt hatten. Wir verdienten unseren Lebensunterhalt, indem ich Skiunterricht gab und Helena für einen Sportausrüster arbeitete. Beide engagierten wir uns mehr und mehr im Laufsport. 1999 wurde Reebok der erste größere Sponsor unseres Teams. Ich glaube, das war der Moment, an dem ich mir sagte: Ja, das schaffe ich. Ich kann Leute dafür gewinnen, dass sie in mich investieren.
Wenig später besuchten wir in der Schweiz meine Eltern, die inzwischen dort arbeiteten. Da wir schon ein Stück weit zur schwedischen Adventure-Racing-Szene gehörten, unterstützten wir Team Silva, unsere Nationalmannschaft, bei der ersten Weltmeisterschaft 2001. Ich weiß noch, wie ich neben meinem Freund Jari Palonen stand, der heute ein berühmter Adventure Racer ist, und sagte: „Nie wieder will ich bei einem Adventure Race am Rand stehen. Nächstes Jahr bin ich mit am Start.“
Ich glaube, er sah mich damals ein bisschen skeptisch an, aber ich meinte es ernst. Und von diesem Moment an haben wir Adventure Racing zu unserem großen Ziel und unserem Beruf gemacht. Wir arbeiteten hart dafür, schafften es, über die Runden zu kommen, und hatten einen Job, der uns Spaß machte.
Aber den ganzen Tag dafür zu arbeiten, die Rennen finanzieren zu können und uns dann dabei zu verausgaben, forderte allmählich seinen Tribut, und schließlich waren wir nicht nur ständig müde, sondern auch pleite. Es war sehr schwierig geworden, unser Leben beieinanderzuhalten. Also zogen Helena und ich zurück nach Örnsköldsvik auf den Hof ihrer Eltern, um eine Pause einzulegen und ein bisschen Geld zu sparen.
Es war ein herrlicher Hof mit einer Rinderherde, ein paar Milchkühen, Schweinen und Ackerland. Eins der beiden Bauernhäuser gehörte ihren Eltern und das andere ihrem Onkel. Wenn sich die Familie versammelte, war es daher immer eine große Runde, die nicht nur aus Helena, ihrem Bruder und ihren Eltern bestand – zur Erntezeit saßen wir meistens mit zwanzig Leuten am Tisch.
Es war einfach wunderbar, ein Teil dieser Familie zu sein. Oft kommt mir in den Sinn, welch einen großartigen Start ins Leben Helena mit so einer Kindheit – mit all den Tieren ringsumher – doch erlebt haben muss. Sie war für das Melken der Kühe verantwortlich und musste sich um viele Haustiere kümmern. Und wenn man beigebracht bekommt, Tiere zu versorgen, sie zu achten und mit ihnen zu arbeiten, lernt man, glaube ich, auch etwas über den Umgang mit Menschen dazu. Meine Kindheit hingegen war ganz anders. Wir hatten nie Haustiere, geschweige denn einen Hund …
Doch so schön und wertvoll die Erfahrungen auf dem Hof auch waren, ich fand den immer gleichen Rhythmus des Landlebens ein bisschen ermüdend. Natürlich half ich bei der Ernte, klar, aber im tiefsten Innern dachte ich, wie es mir doch widerstreben würde, genau zu wissen, dass ich das Gleiche nächstes Jahr genau zur gleichen Zeit auf die gleiche Weise wieder tun würde und das Jahr darauf wieder und das Jahr darauf wieder …
Und ebenso wenig, das wusste ich, begriff Helenas Vater, was ich zu erreichen versuchte. Ich hatte eine halbe Stelle als Personal Trainer im Sportcenter von Örnsköldsvik, aber das Wichtigere für Helena und mich war unser Adventure Racing. Wir hatten gerade die Aufgabe übernommen, das erste Rennen an der Hohen Küste zu organisieren – eine mörderische Strecke über fast 400 Kilometer für ein Nonstop-Rennen mit Viererteams. Es war ein Haufen Arbeit, Sponsoren zu verpflichten, eine neue Webseite aufzubauen und die ganze Logistik auf die Beine zu stellen.
Diese arbeitsintensive Aufgabe machte es uns beiden unmöglich, weiter zwei Jobs gleichzeitig zu haben. Ich hörte 2004 im Sportcenter auf, und Helena und ich konzentrierten uns ganz auf das Adventure Racing – als „Team Explorer“ traten wir selbst an, und als „Explore Sweden“ organisierten wir Rennen. Wir hatten ein Büro in der Stadt und zogen wieder dorthin, um näher am Arbeitsplatz zu wohnen. Außerdem machten wir uns daran, einen Wettkampf für die Adventure Racing World Series auf die Beine zu stellen, bei dem eine Boeing 737 die Racer zwischen drei unterschiedlichen Orten hin- und herfliegen sollte.
Es wurde ein sensationelles, großartiges Rennen. Der einzige kleine Haken war nur, dass wir ziemlich viel Geld verloren. Doch Gott sei Dank gibt es auch Bankberater mit Mitgefühl. Weil unserer zu dieser Sorte gehörte, bekamen wir einen Kredit, kündigten das Büro und hatten eine wichtige Lektion für die Planung des nächsten Rennens für die World Series gelernt.
Schon der Wettbewerb 2004 war eine aufregende Sache gewesen, doch mit dem Rennen im Jahr 2006 sollten wir noch einen draufsetzen. Wir waren entschlossen, aus unserem Rennen das beste seiner Art zu machen – es sollte nicht nur anspruchsvoll sein, sondern auch Spaß machen und dabei Schweden und Norwegen von ihrer besten Seite zeigen. Doch zuvor galt es noch, eine kleine, bescheidene Hochzeit auszurichten.
Wir hatten immer heiraten wollen, gar keine Frage, aber wir wollten einen besonderen Tag daraus machen, sobald wir unser Leben ein bisschen im Griff hatten. Im Januar 2006 war es so weit, und die wunderschöne Kirche gleich neben meinem Elternhaus war der Ort unserer Wahl. Meine Mutter hatte sich in der Kirche schon immer sehr engagiert, und auch ohne dass je ein Wort dazu gefallen wäre, hatte wohl schon immer festgestanden, dass wir dort heiraten würden.
Alles lief wie am Schnürchen. Helena sah wunderschön aus, wir sagten die richtigen Worte zur richtigen Zeit, alle unsere Freunde und Verwandten waren da, alle waren glücklich und es wurde viel und herzlich gelacht. Und die Sonne schien. Paradoxerweise war das schade, denn daher lag kein Schnee, auf dem unser eigens gebuchter Pferdeschlitten zum Empfang auf den Berg hätte fahren können. So mussten wir uns für diese Fahrt mit einer altmodischen Räderkutsche begnügen.
Aber wenn sonst auf einer Hochzeit nichts schiefgeht, hat man wohl Glück gehabt.
Für Flitterwochen allerdings blieb nur wenig Zeit, weil wir sofort mit der Planung für unser außergewöhnliches Rennen weiterkommen mussten – damit für ein World-Series-Rennen auch wirklich jedes Detail stimmt, braucht es rund ein Jahr Vorbereitung. Doch wir schafften es. Und als der große Tag da war, mussten wir nur noch hoffen, dass viele Teilnehmer kamen und alle ihren Spaß hatten.
Und den hatten sie. Wir waren unglaublich stolz auf unser Rennen. Wie einer aus dem Siegerteam es ausdrückte: „Viele Organisatoren machen ihr Rennen so brutal anstrengend, als wollten sie die Leute vom Adventure Racing abschrecken. Aber bei diesem würde man jede Teilstrecke jederzeit mit Vergnügen wieder absolvieren. Zwanzig Erlebnisse auf diesem Level in ein Rennen zu packen ist der Hammer. Wir haben beim Paddeln die Nordlichter gesehen, wir haben Wale gesehen und Rentiere. Es war ganz fantastisch.“
Weniger fantastisch war, dass manche Sponsoren, auf deren Unterstützung wir gebaut hatten, nicht erschienen waren. Und weil die Weltmeisterschaft im vorherigen Jahr kein großer Erfolg gewesen war, standen wir mit weniger Teilnehmern da als üblich. Alles in allem wurden wir auch aus dieser Erfahrung wieder ein bisschen klüger … Wir mussten uns noch strenger und realistischer klarmachen, wie wir diesen teuren Sport letztendlich finanzieren wollten.
Ich beschloss, von nun an alles selbst in die Hand zu nehmen, angefangen bei den Sponsoren. Und während ich mögliche Sponsoren abtelefonierte, wollte Helena die Medien übernehmen und die ganze Papierarbeit erledigen.
Wir waren ein Team. Im bestmöglichen und umfassendsten Sinn.