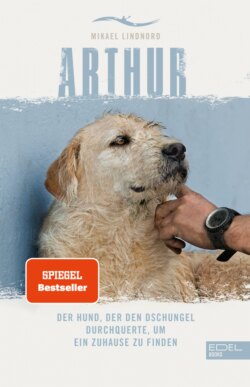Читать книгу Arthur - Mikael Lindnord - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Flughafen Örnsköldsvik, 31. Oktober 2014
ОглавлениеDer Flughafen von Örnsköldsvik besteht aus kaum mehr als einem Tower und einer betonierten Fläche inmitten der Wälder. Das Gepäck kommt auf einem Förderband durch ein Loch in der Wand oder wandert auf einem anderen Band, auf das die Fluggäste ihre Koffer selbst stellen müssen, nach draußen. An der Passkontrolle sitzt eine Person, und wenn viele Passagiere an Bord gehen, sind es auch mal zwei. Ein in jeder Hinsicht meilenweiter Unterschied zu hektischen Verkehrsknoten wie Stockholm oder Heathrow.
Als wir an diesem kalten Oktoberabend dort ankamen, waren wir zwar nervös, weil noch so viel zu erledigen war, aber auch aufgeregt, weil es endlich zum Wettkampf nach Ecuador ging und wir schon bald am anderen Ende der Welt zu einem der wichtigsten Rennen unserer sportlichen Laufbahn antreten sollten.
Als Erstes standen uns sechs Tage zur Akklimatisierung an die große Höhe bevor. Wir wollten in den Bergen nahe der Hauptstadt Quito trekken und klettern – und hofften, dass sich durch die dünne Luft bei niemandem zu große Erschöpfung einstellen würde. Große Höhen können Adventure Racern ganz schön zu schaffen machen, besonders denjenigen von uns, die auf Meereshöhe leben und nicht daran gewöhnt sind. Wenn der Körper bereits bis aufs Äußerste strapaziert ist, gibt eingeschränkte Sauerstoffversorgung oft den entscheidenden Ausschlag zwischen Leben und – wohl nicht gerade Tod, aber doch einer Nahtoderfahrung. Man tut also gut daran, den Körper schon mal daran zu gewöhnen.
Während der ersten vier Tage in Ecuador waren wir die drei Musketiere – unsere Teamkameradin Karen sollte erst am letzten Tag zu uns stoßen, da sie aus ihrer Heimat Lake Tahoe bereits an große Höhen gewöhnt war.
Während wir uns durch den schmalen Eingang zur Flughalle schoben, betrachtete ich meine Teamkameraden. Zuerst war da Staffan, ein fitter Schwede wie aus dem Bilderbuch. Groß und blond und offenbar – ich kann das nicht beurteilen – gut aussehend. Er alberte mit der jungen Frau an der Passkontrolle herum. Wir hatten so viel sperriges Gepäck, so viele Transportboxen, dass man uns unmöglich übersehen konnte, selbst wenn wir nicht so viel Lärm gemacht hätten.
In einer Ecke stand Simon und überprüfte wieder und wieder seine Bikeboxen. Er ist groß, dunkelhaarig, schlank und ein wunderbarer Sportler. Sehr schnell und heiß darauf, Erster zu sein. Mit fünfundzwanzig ist er unser Youngster, aber schon auf dem Weg nach oben – und das mit Tempo.
Zusammen mit Karen, einer der weltweit zähesten und erfahrensten Frauen in diesem Sport, hatten wir eine gute Mischung verschiedener Fähigkeiten beisammen. Außerdem kannten wir einander sehr gut und wussten, wie wir einander unterstützen konnten. Wie Simon einmal gesagt hat: „Es ist wichtig, dass man gut befreundet ist: Wir haben Spaß im Training – und nach dem Training.“
Als Letzter stieg unser Fotograf Krister Göransson ins Flugzeug. Krister und ich kommen aus der gleichen Stadt und sind seit mehr als fünfzehn Jahren befreundet. Er fotografiert seit seinem sechsten Lebensjahr. Die Fotografie ist der rote Faden in seinem Berufsleben. Er ist ein toller Fotograf – und Freund –, und seine große Stärke sind neben Landschaftsaufnahmen auch Actionfotos von Adventure Racern. In den letzten Jahren musste er sich in einige ziemlich unbequeme Situationen begeben, um die bestmöglichen Bilder zu machen, aber darin ist er wirklich gut.
Als er mit dem Sicherheitspersonal plauderte, bemerkte ich, dass seine Kameras fast genauso viel Platz benötigten wie unsere Sachen. Er nahm unser ganzes Notfallkontingent in Anspruch. Ich ging zu ihm. „Ich will mal hoffen“, sagte ich, „dass du mit all den Kameras und dem ganzen Equipment ein paar verdammt hammermäßige Bilder machen wirst.“
Er zeigte mir freundlich den Finger.
Schließlich war es Zeit, Helena und Philippa zum Abschied in den Arm zu nehmen. Helena würde unseren Weg Schritt für Schritt mitverfolgen. Gleich beim Start des Rennens würden wir die Gestalt eines Pünktchens auf ihrem Computerbildschirm annehmen, da unsere Peilsender Funksignale an die Organisatoren sendeten. Gemeinsam mit unseren Freundinnen Mia und Malin war Helena zuständig für alle Facebook- und Webseiten-Updates sowie für den Papierkram rund um unsere Reise ans andere Ende der Welt.
„Guten Flug“, sagte sie. „Ruf mich an, wenn ihr gelandet seid.“ Ich rufe sie immer so bald wie möglich an, wenn ich irgendwo ankomme oder ein Rennen vorbei ist, aber sie meint bestimmt, dass sie mir besser noch letzte Instruktionen gibt, damit ich das auch nicht vergesse.
Schließlich saßen wir in dem Flieger nach Stockholm, wo wir einen Anschluss nach Amsterdam nehmen wollten, um von dort nach Quito in Ecuador weiterzureisen. Es war ein ziemlich einfaches Propellerflugzeug, und in seinem Inneren war es laut und zugig. Mir ging durch den Kopf, wie es mir wohl auf dem Rückflug in drei Wochen gehen würde – würden wir unseren Sieg feiern? Oder schlecht drauf sein, weil wir nicht unter den besten Zehn gelandet oder – noch schlimmer – nicht einmal durchgekommen waren? Der vertraute Knoten im Bauch, den ich unterwegs zu großen Rennen immer spüre, zog sich ein bisschen enger zusammen.
Als wir am Abend in Stockholm eintrafen, hatten wir nur ein paar Stunden bis zu unserem nächsten Flug nach Amsterdam, also checkten wir in einem Flughafenhotel ein. Das Zimmer war wenig mehr als ein Etagenbett hinter einer Tür. Für die meisten wäre so etwas sicher zu primitiv, aber wir wussten, dass es der pure Luxus war, verglichen mit dem, was uns bevorstand. Wir gingen ganz bewusst sofort ins Bett, denn wir wussten, dass wir so viel wie möglich vorschlafen mussten.
Am nächsten Morgen waren wir in aller Frühe auf den Beinen, um den zweistündigen Flug nach Amsterdam zu kriegen. Die anschließende Etappe nach Quito sollte dreizehn Stunden dauern, und als wir an Bord waren, schlug ich vor, diese Zeit zu nutzen, um unsere Strategie für das Rennen zu besprechen. Ich wusste, dass wir alles erneut mit Karen durchgehen würden, aber ich wollte unsere Taktik genau im Kopf haben.
„Also, Leute“, sagte ich, als wir es uns auf unseren Plätzen bequem gemacht hatten. „Eins muss uns klar sein. Der Anfang ist gleich der Hammer. Auf den ersten vier Etappen geht es dreimal zwei- bis dreitausend Meter rauf, und dazwischen zweimal wieder fünfzehnhundert oder viertausend Meter runter. Zwei Trekking-, zwei Bikestrecken. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das in sechsunddreißig Stunden. Hell ist es von halb sechs bis abends halb sieben, also sollte es kein Problem sein, die Dark Zones richtig zu timen und ohne Pause bis zur Wechselzone 4 durchzukommen – wenn wir bei der Orientierung keine Fehler machen.“ Ich sah Staffan an.
Er tat, als konzentrierte er sich ganz auf seine Erdnüsse, also beschloss ich, ihn nicht mit dummen Sprüchen zu dem Thema aufzuziehen.
„Es kommt drauf an, wo wir bei Tageslicht unterwegs sind“, fuhr ich fort. „Aber wenn alles klappt, könnten wir, sobald wir Wechselzone 4 erreichen, ein paar Stunden schlafen und dann gleich zur nächsten Trekkingstrecke aufbrechen. Aber vor der Etappe liegen 144 Kilometer Biken, deshalb müssen wir da superfix durch.“
Ich drehte mich wieder zu den anderen um. Simon studierte mit gerunzelter Stirn das Höhenprofil. Dass große Höhen manchen Menschen etwas ausmachen und anderen nicht, hat keinen erkennbaren Grund. Vielleicht sorgte er sich, ob er zu denen gehörte, denen sie Probleme bereiten.
„Der Knackpunkt ist“, sagte ich etwas lauter, weil es wichtig war, „dass wir nach Etappe sechs richtig Gas geben. Das sind 160 Kilometer Biken, keine Höhenlage mehr – da können wir ganz nach vorn kommen. Da geht’s um Bike-Skills, das ist unser Ding.“
Jetzt hatte ich sie.
„Es ist total entscheidend, wo wir bei Etappe sieben liegen“, fuhr ich fort. „Wir springen in die Boote – egal ob wir müde sind, denn ab da geht’s flussabwärts.“ Ich hatte mir die Gezeitentabellen genau angesehen, und wenn wir nach meinem wahrscheinlichen Zeitplan zum Fluss durchkamen, hatten wir einen super Vorteil. „Was haltet ihr davon, wenn wir da nur einen Zehn-Minuten-Wechsel machen? Wir kommen an, packen die Bikes in die Box und machen in Radklamotten weiter. Einfach alles anlassen, Proviant und Schwimmwesten schnappen und los. Dann essen wir Vierundzwanzig-Stunden-Mahlzeiten im Boot und schlafen ein bisschen in der Wechselzone acht, vor der Bikeetappe, oder in Wechselzone neun, vor der nächsten Trekkingetappe, wenn wir uns das leisten wollen. Oder wir machen Powernaps.“
Jetzt hörten sie mir zu. Sie verstanden, dass es ganz auf diese letzte Etappe ankam.
„Und in der Wechselzone neun wechseln wir wieder superschnell. Laufklamotten bleiben an. Wir rennen mit den Paddeln zu den Booten und haben sonst nichts in der Hand. Vielleicht lassen wir die Rucksäcke bei diesen Etappen einfach die ganze Zeit auf und schaffen den Wechsel in fünf Minuten!“
„Okay“, sagte Staffan. Er war mit seinen Erdnüssen fertig und hatte keine Entschuldigung, nicht zuzuhören. „Damit kann ich leben. Zuerst Höhenstrecke ohne Schlaf. Und am Ende alles geben.“
„Und über die Höhe dürfen wir uns keine Gedanken machen“, sagte ich, obwohl ich mir sehr wohl Gedanken über die Höhe machte. „Wir haben sechs Tage Höhentraining, bevor das Rennen losgeht. Dann haben wir drei Viertausender hinter uns. Das haut hin.“
So muss man das als Mannschaftskapitän machen. Sagen, dass es schon hinhauen wird, und dann irgendwie dafür sorgen, dass es hinhaut.
Am dritten Tag unserer Akklimatisierung in Ecuador war klar, dass ich mit meinen Befürchtungen recht gehabt hatte. Genugtuung verschaffte mir das nicht, aber ich hatte eben recht gehabt. Höhen waren einfach nicht unser Ding.
Wir waren drei der zähesten Kerle, die man im Gebirge antreffen kann, aber während der letzten beiden Tage, beim Besteigen des Ruminahui und des Illinizas, beide mehr als 4000 Meter über dem Meeresspiegel, hatten wir sehr gelitten. Wir waren so schnell wir konnten höher und höher gestiegen und dabei völlig außer Atem gekommen. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man jede Menge Energie aufbringt und trotzdem nicht vom Fleck kommt. Auch mit Willenskraft ist da nicht viel auszurichten.
Unser Führer war ein netter Ecuadorianer, der uns versicherte, der heutige Aufstieg sei relativ einfach. Also sollte Krister mitkommen, ein paar Bilder von der imposanten ecuadorianischen Bergwelt machen und vielleicht auch ein Video für die Sponsoren zu Hause drehen.
Der erste Teil lief gut. Wir trugen unsere Schneeausrüstung – Stiefel, Trekkingstöcke, das volle Programm – und waren etwa auf halber Höhe, als Krister rief: „Stopp, hier ist es ideal!“ Wir wollten einen Film drehen. Gut und schön, dachte ich, aber alle waren so außer Atem, dass keiner ein gerades Wort herausbekam. Das Bergaufmarschieren in Kombination mit der großen Höhe – wir waren schon fast auf 4000 Metern, viel höher als Quito – hatte uns nahezu die Stimme geraubt.
Dennoch imitierte Staffan, der sich in der dünnen Luft noch am besten hielt, vor der Kamera recht überzeugend einen sprechenden Menschen. Nach dieser Nummer setzten wir unseren Weg fort, entschlossen, den Gipfel zu erreichen und die 4000 Meter zu knacken.
In dem Moment hörte ich jemanden von weitem rufen. „Mikael! Hey, Mikael!“ Zuerst konnte ich niemanden sehen, aber dann erkannte ich vier Gestalten, die uns entgegenkamen.
Es war Nathan Fa’avae, der Kapitän des Teams „Seagate“ aus Neuseeland, mit seiner Frau und ihren kleinen Kindern. Deren Ausrüstung sah eher nach Strandurlaub aus, und sie sprangen umher, als wären sie tatsächlich am Strand.
Ich winkte ihnen zu und sah ihnen nach, wie sie in ihrem Strandoutfit den Berg hinunterrannten. Sie mussten auf weit über 4000 Metern gewesen sein. Ich fluchte still vor mich hin. Sie schienen übermenschliche Kräfte zu haben, während wir in unserem Schneeoutfit vor uns hin litten. Seagate war das Favoritenteam, und es sah ganz so aus, als hätten sie bei der Höhenakklimatisierung einen Riesenvorsprung.
„Alles klar!“, rief unser Führer eine halbe Stunde später. Er war vorausgelaufen und hatte überhaupt keine Schwierigkeiten mit dem Atmen. „Das war’s, wir drehen um.“
Wir guckten verdutzt. Wir wollten doch noch zum Gipfel. Das war doch der Zweck der Übung.
„Da kommt ein fetter Sturm“, erklärte unser Führer. „Sofort umkehren.“ Er klang überzeugt. Wir schauten uns um und sahen nichts Ungewöhnliches, keine Spur von dunklen Wolken.
Dann plötzlich: „Da kommt’s!“, rief Simon. „Er hat recht. Mein Gott, schaut euch das an.“
Wir drehten uns um. Ganz am Horizont war der Himmel komplett schwarz geworden und die Wolken bewegten sich offenbar auf uns zu.
Unser Führer lotste uns bergab auf einen Bergkamm zu. Und was einen zur Verzweiflung bringen konnte: Er rannte! „Schnell, schnell!“, rief er. Wir erkannten, dass er einem Weg folgte, der mit Flaggen gekennzeichnet war. Er musste sie auf dem Weg nach oben aufgestellt haben, weil er geahnt hatte, dass wir in einen Sturm geraten konnten.
„Bewegung“, rief er uns zu. „Wir müssen rennen.“
Krister hielt seine Kameras eng am Körper, um sie zu schützen, und sagte: „Ich renne nicht.“
Die Blitze wurden häufiger und es begann zu hageln. Gleichzeitig kamen die Blitzeinschläge näher und näher, und wir gerieten durch die dünne, aufgeladene Atmosphäre noch mehr außer Atem. Wir setzten die Helme auf, um uns vor den riesigen Hagelkörnern zu schützen, die inzwischen die Größe von Orangen erreicht hatten. Dann schlug ein Blitz genau in die Mitte des Weges ein, dort, wo wir noch einen Moment zuvor gewesen waren.
Das war der Ansporn, den unser Fotograf noch gebraucht hatte, und gemeinsam rannten wir so schnell wir konnten ins Tal zur sicheren Hütte. Als wir uns aus unseren durchnässten Klamotten schälten, bemerkte ich, dass die elektrische Spannung mein Handy komplett ruiniert hatte.
Hoffentlich würde sich all das Training wenigstens im Rennen als nützlich erweisen.