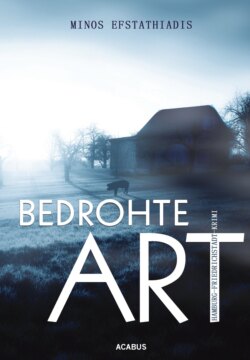Читать книгу Bedrohte Art. Ein Hamburg-Friedrichstadt-Krimi - Minos Efstathiadis - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5
Von meiner Sitzbank aus, kann ich zwei menschliche Figuren erkennen, die in der Ferne gehen. Ich spüre das Verlangen, meine Gedanken in eine unvollkommene Reihe zu bringen, zu realisieren, wie sich dieser merkwürdige Kreis geöffnet hat, in dem ich gefangen bin. Mir gegenüber überquert eine klapprige Holzbrücke eine der schmalen Grachten der Stadt. Rechts und links neigen sich die Bäume der gegenüberliegenden Ufer über das Wasser und vereinigen sich am Ende in ihren nackten Zweigspitzen. Ahmen sie die Brücke nach, oder passiert genau das Gegenteil?
Die Zeit rollt dahin, gar nichts passiert, ich bleibe auf meiner Bank. Ich schwanke, ob es besser ist, heute Abend noch zurück nach Hamburg zu fahren. Anderthalb Stunden Fahrt und morgen früh muss ich wieder hier sein. Ich schiebe die Entscheidung auf und denke noch einmal über den Mord nach.
Angelika zufolge stehen zwei Personen in völlig unterschiedlichem Verhältnis zu Konrad Hausmann. Sein Freund Berger und der Schmidt, Pächter der Ländereien, die er von seinen Eltern geerbt hat. Morgen versuche ich die beiden zu treffen.
Der Wind pfeift immer stärker, sodass ich aufstehen muss. In den leeren Straßen streife ich umher, als das Schild eines Hotels wie ein Zeichen vor mir auftaucht. Die Müdigkeit, die Kälte, die Nacht neigen sich in dieselbe Richtung und die Entscheidung wird einfacher.
Hinter der Rezeption sitzt eine Frau mit roten Pausbacken. Beim Aufstehen scheint ihr Körper noch schwerer. Heisere Stimme, Bluessängerin. Der Preis, sechzig Euro die Nacht. Sie versucht bereits, mich auszuhorchen. Wieso ich in der Stadt bleiben möchte? Zu ihrer großen Enttäuschung hat sie keinen Erfolg dabei, etwas zu erfahren. Zimmer einhundertsieben also. Ich bin dran mit dem Fragen, vielleicht gibt es in der Nähe ein Restaurant. Sie zeigt direkt auf die Durchgangstür. Unser Hotel verfügt auch über ein Restaurant, betont sie offenkundig stolz. Ich nicke und gehe gleich darauf durch jene Tür.
Fünf Stammkunden, auf den Barhockern thronend vor großen Biergläsern. Plötzliche Stille. Zwölf Augen sind auf mich gerichtet. Hinter ihnen lauert der Barmann. Ich wähle den am weitesten abgelegenen Tisch; durch die Scheiben der Kneipe zeichnet sich ein gepflasterter Platz ab. Ich könnte wetten, dass der Barmann gleichzeitig Eigentümer und Ehemann der Rezeptionistin ist. Er verlässt seinen Posten und kommt auf mich zu, um meine Bestellung entgegenzunehmen. Schnauzbart, Karohemd, viele Kilos, Förmlichkeit. Wir sind schnell fertig: Schnitzel mit Pommes und ein dunkles Bier.
Draußen sprengt in bestimmten zeitlichen Abständen ein Auto die Reglosigkeit des Ortes. Das Essen kommt, große Portion, gut aussehend, das Bier leider warm. Ich spüre ihre Augen auf meinem Rücken und eine metallische Erschöpfung auf meiner Wirbelsäule. Bevor ich die Rechnung bezahle, fragt mich der Barmann, ob es mir geschmeckt hat. „Sehr gut, sehr gut”, antworte ich zweimal und das ist nicht gelogen.
Im selben Moment kommen mir unbewusst Angelikas Worte ins Gedächtnis, als ich sie fragte, wie wir das Ganze mit der Polizei handhaben werden. Die Wahrheit, die Wahrheit. Diese abrupte, wiederholte Antwort von ihr hörte sich so spontan an. Lügner reagieren anders, sie benötigen Zeit und gewöhnlich mehr Worte.
Wieder die zwölf Augen auf mir, die Durchgangstür zum Hotel, die roten Pausbacken, die Bluesstimme. Und mein Schlüssel. Einen Fahrstuhl gibt es nicht, nur wenige Stufen trennen mich vom ersten Stockwerk. Das Zimmer einhundertsieben erweist sich als geräumig, warm und muffig. Ich dusche und sinke ins Bett. Mit meinem Mobiltelefon rufe ich Frau Queneau an. Ich habe keine Sekretärin, keinen Assistenten, keine Ehefrau, keine Geschwister. Ich habe Frau Queneau.
Zweiundachtzig Jahre alt, Französin, aus einem Dorf im Elsass stammend, dessen Namen ich mir nie merken kann. Sie lebt allein in Hamburg, seit ihr deutscher Ehemann vor zwanzig Jahren verstarb. Die Frau von nebenan, sie hat jedoch nichts mit dem Film von Truffaut zu tun. Ich habe ihr vor drei Jahren einen Zweitschlüssel gegeben, mit dem Auftrag, die Polizei zu benachrichtigen, falls sie mich eines Nachts erdrosselt von einem eifersüchtigen Ehemann findet. Es sind die Schlüssel zu meiner Büro-Wohnung. In dem einen Zimmer befindet sich mein Büro und in dem anderen mein Bett. Es gibt auch die kleine Küche und das noch kleinere Bad. Frau Queneau putzt bei mir, obwohl ich ihr ständig sage, dass sie das nicht tun soll. Sie wäscht, was sie ungewaschen vorfindet, also alles. Sie kocht für mich und wir essen zusammen auf ihrem Balkon. Sogar mitten im Winter bevorzugt sie es dort draußen zu sitzen, solange sie Gesellschaft hat.
Sie geht sofort ans Telefon. Wo bist du? Was machst du dort, mein Kind? Ich kann hören, wie sie den Namen Friedrichstadt auf ihren Block schreibt. Sie hat mehr Angst davor, an Alzheimer zu erkranken als vor den Krimis, die sie jede Nacht bis zum Morgen anschaut. Sie wird kein Alzheimer bekommen, zumindest nicht vor mir. Ihr Gedächtnis ist viel besser als meins. Die Angewohnheit mit dem Block hat sie sich von mir abgeguckt. Ich vergesse alles, nicht sie.
Ich sage ihr noch mal, dass sie nur denen meine Nummer geben soll, die mit Beharren, Geduld und hauptsächlich nicht mit roten Augen nach mir fragen. Wenn ich nicht da bin und jemand an meine Tür klopft, dann braucht sie nicht mehr als zehn Sekunden. Frau Queneau schießt sofort aus ihrer Wohnung und spielt meine Sekretärin. Immer erfolgreich. Sie besitzt die riesige und gefährliche Gabe, Männer gut zu durchschauen. Der pathologisch Eifersüchtige, der Säufer, der Egoist, der Geizhals, der Faulpelz, der Gentleman, alle bekommen schnell und gewöhnlich mit Recht ihren entsprechenden Stempel auf die Stirn gedrückt.
Ich deaktiviere mein Handy und lege es auf den Nachttisch neben dem Doppelbett im Zimmer einhundertsieben. Meine Augen schließen sich automatisch. Der Tag löscht sich von dem Bildschirm in meinem Gehirn und nur noch der Ausblick von Hausmanns Hof bleibt irgendwo hängen. Der endlose Horizont.
Ich wache um halb acht am Morgen auf, plötzlich, inmitten eines Traumes, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Die Brise der Nacht hängt noch frisch über mir. Ich wasche mich mit kaltem Wasser, doch das, was ich geträumt habe, was auch immer es war, hat sich wie eine undurchdringbare Kruste ausgebreitet. Ich ziehe mich träge an und gehe runter zur Rezeption.
Die Bluesstimme informiert mich, dass das Frühstück im Restaurant serviert wird. Ich gehe wieder durch die Durchgangstür und nehme mir nur heißen Kaffee vom Buffet. Ich meide Käse, Marmeladen, Eier, Speck und Würstchen, während mir der Barmann von gestern Nacht aus ein paar Metern weiter hinten zusieht, lächelnd und nachgiebig. Er lässt mich ein paar erste Schlucke trinken, nähert sich meinem Tisch und kündigt mit leiser Stimme an, dass er gerade frische Pfannkuchen gemacht hat. Das klingt wie ein Sieben-Siegel-Geheimnis, das dich direkt zu den oberen Etagen des Paradieses führt. Ich schaffe es noch nicht mal zu nicken, da landen bereits zwei Pfannkuchen auf meinem Teller. Draußen vor dem Fenster beginnt der Tag sein graues, seichtes Licht zwischen den Gebäuden zu verbreiten. Im Vergleich zu gestern Nacht sind die Straßen natürlich lebendig geworden. Ein Trecker brummt durch die Stadt. Der Bauer darauf, erhöht sitzend, macht den Autofahrern Handzeichen, ihn zu überholen.
Als ich in mein Auto steige, fahre ich direkt zu Hausmanns Hof. Der Weg breitet sich einsam und monoton vor mir aus. Ich parke an derselben Stelle wie gestern. Der zweite Streifenwagen der Polizei ist natürlich verschwunden und das Absperrband, welches das Gebäude umwickelt, verrät seine Spuren. Ich zünde eine Zigarette an und entscheide mich, ein paar Schritte zu gehen. So, wie der morgendliche Nebel über den verlassenen Äckern schwebt, überschwemmt mich das Gefühl in einer Mondlandschaft zu sein, in der ich als einziger Überlebender herumlaufe.
Langsam entferne ich mich vom Haus. Die Linden haben eine dicke Matratze aus Blättern gebildet. Und plötzlich sehe ich es. Ein Stück weiter erhebt sich ein einziger Apfelbaum, der bis jetzt hinter anderen Bäumen versteckt geblieben ist. Alle Früchte haben dieselbe braune, reife Farbe, sind klein und schrumpelig. Ich pflücke einen. Keine Zweifel. Der Apfel, der eingekeilt in Hausmanns Mund gefunden wurde, stammte von diesem Baum.
Hatte der Mörder nicht dafür gesorgt, etwas anderes mitzubringen, um sein Opfer zu knebeln? All seine anderen Taten zeigten extrem aufmerksame Planung. Ist es möglich, dass er einfach nur das erstbeste, was er finden konnte, benutzt hat? Ich kann mir den Mann, der Hausmann in zwei Teile schnitt, nicht vorstellen, wie er nach einer Frucht im Haus oder im Garten sucht. Wollte er damit vielleicht eine Nachricht an das Opfer senden? Ein Apfel von seinem eigenen Apfelbaum unterdrückte das Schreien. Sollte sich dahinter wohl ein besonderer Symbolismus verstecken?
An der hinteren Seite des Hauses stelle ich fest, dass der Schuppen nicht von dem Polizeiband umwickelt wurde. Ich fasse an die Türklinke, öffne sie und gehe zwei Schritte hinein, während Syds Grunzen in der Luft widerhallt. Doch dieses Mal ist seine Reaktion nicht zu vergleichen mit gestern. Als Angelika durch dieselbe Tür hineinkam, um mir den Schuppen zu zeigen, hatte das Tier ein völlig anderes Geräusch herausgebracht, in Lautstärke und Klang.
Der Gestank wird hier drinnen immer übler, doch daran ist nicht nur das Schwein schuld. Wir stehen uns gegenüber, so langsam ändern sich seine Reaktionen, sie werden weicher. Er ist etwas fröhlich oder es scheint mir nur so? Kann es sein, dass er mich wiedererkannt hat? Du armer Syd, jetzt bist du allein und keiner kümmert sich um dich.
Er fängt an zu schnauben und bewegt seine Schnauze hoch und runter, versucht mir etwas zu sagen. Zugegebenermaßen erscheint er dabei ausdrucksvoller als viele Menschen. Der Hunger in tausend Sprachen.
Ich suche um mich herum und finde endlich, hinter einigen leeren Säcken, einen halbvollen, mit Stroh bedeckten Sack. Die kleinen, braunen Stückchen bestehen aus einem unbekannten Material, wie hartes Plastik. Ist das essbar? Ja, essbar; Syd feiert eine Party, als ich ihm die ersten davon hinschmeiße. Ich strecke meine Hand über die Holzwand und nehme den Metalleimer heraus. Leer, dreckig und halbverrostet. Draußen vor dem Schuppen finde ich einen Wasserhahn, wasche den Eimer etwas aus und fülle ihn mit frischem Wasser. Eine neue Party für Syd. Am Ende verstreue ich den ganzen Sack mit dem unbekannten Futter vor dem Schweinehock und öffne die kleine Tür. Er sieht mich an. Ja, mein Freund, es ist an der Zeit, dass du nach draußen in die Welt gehst. Nicht, dass es dort weniger stinkt.
Die Schuppentür lasse ich offen, als ich hinausgehe. Wenn Syd das Futter aufgefressen hat, dann kann er zumindest unter den Eichen zelten und Wasser als geschmolzenes Eis in den Pfützen finden.
Ich spaziere etwas an der Morgenluft. Dieser Ort strahlt einen mysteriösen Magnetismus aus. Der Horizont, verloren im Nebel, breitet sich grenzenlos wie Trauer aus. Und als ich mich entschließe zu gehen, habe ich den Verdacht, dass ich zurückkommen werde. Für den Apfelbaum? Für Syd? Für mich?