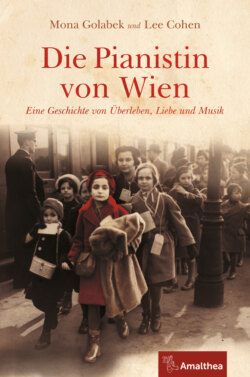Читать книгу Die Pianistin von Wien - Mona Golabek - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеLisa Jura legte viel Wert auf ihr Äußeres. Eine Ewigkeit stand sie vor dem Spiegel und zupfte ihr dunkelrotes Haar zurecht, bis es topmodisch unter dem Wollhütchen hervorspitzte, das sie gerade im Geschäft für Gebrauchtmode gekauft hatte. Der Hut brauchte den perfekten schrägen Sitz … ja, so. Genau so, wie sie es bei den Modellen in den Modemagazinen gesehen hatte.
Sie war entschlossen, reifer auszusehen, als sie es mit ihren vierzehn Jahren war. Sie fuhr zur Klavierstunde. Nichts war ihr wichtiger als das. Endlich wandte sie sich vom Spiegel ab und warf dem feschen jungen Mädchen, das sie darin erblickte, ein Lächeln zu.
Leise, um die Familie nicht zu stören, schloss sie die Wohnungstür, ging treppab durch das menschenvolle Mietshaus und trat aus dem düsteren grauen Gebäude hinaus aufs Trottoir der Franzensbrückenstraße im Herzen der Leopoldstadt, des jüdischen Hauptbezirks von Wien.
Wie an jedem Sonntag seit ihrem zehnten Lebensjahr bestieg Lisa die Trambahn und fuhr durch die Stadt zu Professor Lenz’ Klavierschule. Sie liebte diese Fahrt quer durch Wien, das war eine Reise in ein anderes Jahrhundert, in eine Epoche prachtvoller Palais und funkelnder Ballsäle. Straße um Straße aus Marmor und Granit, Kolonnaden und Fassaden. Der Turm des Stephansdoms tanzte vorbei. »Alter Steffl« nannte der Vater die Kirche. Ein dummer Name, dachte Lisa. Er passte nicht zu diesem grandiosen Gotteshaus.
Als die Bahn den breiten Heumarkt hinunterfuhr, vorbei am Konzerthaus, schloss Lisa wie schon so oft die Augen und stellte sich vor, sie säße reglos auf der Bühne des großen Saales am Flügel. Stille senkte sich über das Publikum. Vor Lisa schimmerten die Tasten aus Ebenholz und Elfenbein. Innerlich hörte sie die Einleitung des heroischen Klavierkonzerts von Grieg, den anschwellenden Paukenwirbel, der ihrem Einsatz voranging. Kerzengerade nahm sie die elegante Pose ein, die ihre Mutter sie gelehrt hatte, und als die Spannung fast ins Unerträgliche gewachsen war, holte sie Atem und schlug an. Sie spürte die Erregung der Zuhörer und fühlte ihr Herz im Takt mit den ihren schlagen. Die Seligkeit, die Musik in sich zu hören, war so stark, dass das Gerassel der Fahrt und der Straßenlärm Lisa nicht mehr störten. Als sie endlich die Augen aufschlug, bog die Bahn gerade in die Ringstraße ein, den baumbestandenen Prachtboulevard, an dem die Staatsoper steht. Staunend blickte Lisa aus dem Fenster und wartete darauf, dass der Fahrer ihre Haltestelle ausrief. Dies war das Wien Mozarts, Beethovens, Schuberts, Mahlers und Strauss’, der größten Komponisten aller Zeiten. So viel hatte Lisas Mutter ihr von ihnen erzählt, und sie hatte sich insgeheim geschworen, ihren hohen Vorgaben nachzueifern. Sie hörte ihre Musik im Marmor der Bauten, im Pflaster der Straßen. Sie waren hier. Sie lauschten.
Mit dröhnender Stimme rief der Fahrer ihre Haltestelle aus: »Mahlerstraße«. Bald schon würde sie »Meistersingerstraße« heißen. Dass eine so schöne Straße nach einem Juden benannt war, duldeten die Nazis nicht mehr. Wut stieg in Lisa auf, wenn sie daran dachte, jedoch sie beherrschte sich. Aufgeregtheit schadete nur ihrer Musik. Sie zwang sich, an die bevorstehende Stunde zu denken. Sie wusste nur zu gut, dass, saß sie einmal am Klavier, die Welt um sie herum versinken würde.
Trotz der frühen Stunde summten die mit Cafés gesäumten Straßen schon wie ein Bienenstock. Walzerklänge der »Blauen Donau«, gemischt mit swingendem Dixieland-Jazz, ließen Lisa wieder lächeln. Der Duft von frischem Apfelstrudel weckte Sehnsucht nach dem Rezept ihrer Mutter – sie buk den besten Strudel von Wien! In den Kaffeehäusern nippten gut gekleidete junge Männer und Frauen, die in lebhafte Gespräche vertieft waren, an ihren Tassen. Lisa sah in ihnen Komponisten, Künstler, Dichter, die leidenschaftlich ihre neuen Werke verteidigten. Wie sie sich danach sehnte, zu ihnen zu gehören, in schicker Garderobe über Beethoven und Mozart zu sprechen – in der glanzvollen Kaffeehausgesellschaft zu verkehren. Eines Tages, nach ihrem musikalischen Debüt, würden diese Straßen, diese Cafés ihr gehören.
Kurz vor dem Ziel stockte Lisas Schritt. Am Eingang des großen Hauses, das die Klavierschule von Professor Lenz beherbergte, stand, hochgewachsen und emotionslos, ein deutscher Soldat. Hart spiegelte sich die Sonne auf dem Karabiner, den er an seine braune Uniform drückte. Seit vier Jahren kam Lisa hierher, doch dies war das erste Mal, dass hier jemand Wache stand. Es hätte sie nicht überraschen sollen. Naziposten wurden zu einem zunehmend bedrohlichen Anblick auf den Straßen von Wien.
»Was wollen Sie hier?«, fragte der Posten kalt.
»Ich habe eine Klavierstunde«, erwiderte sie und versuchte, sich von der gebieterischen Erscheinung und der Schusswaffe des Soldaten nicht einschüchtern zu lassen.
»Der Professor wird schon warten«, fügte sie laut und klar hinzu, wie um ihre Angst zu übertönen. Der Soldat blinzelte zum ersten Stock empor. Dort hinter dem Fenster stand eine Gestalt und winkte dem Mädchen heraufzukommen. Widerstrebend senkte der Soldat die Waffe, gab die Tür frei und ließ Lisa eintreten.
»Kommen Sie herein, Fräulein Jura«, sagte der Professor und begrüßte Lisa mit dem gewohnt liebenswürdigen Händedruck. Vorbei an einer Beethovenbüste, die Sprünge hatte, und einem Regal mit gestapelten gelben Notenheften geleitete sie Lenz ins Unterrichtszimmer. Lisa sog den Duft seines Pfeifentabaks ein. Bilder und Gerüche, die sie liebte und die zu einer freundlichen Begrüßung geworden waren – zu einem Zeichen, dass sie in der kommenden Stunde alles hinter sich lassen und mit der Musik verschmelzen würde.
In der Mitte des Raums stand der imposante Blüthner-Flügel des Professors. Er war hochglanzpoliert und hatte gedrechselte Beine. An der Wand hing eine Kostbarkeit – ein Foto von Franz Liszt im Alter, der von mehreren Klavierschülern umgeben war, unter ihnen der Lehrer des Professors. Er rühmte sich, in seiner Klavierpädagogik die Tradition des Meisters fortzuführen, und das Bild zeigte eine abgegriffene Stelle, auf die er wohl oft mit dem Finger gedeutet hatte.
Wie üblich wurden nur wenige Worte gewechselt. Lisa legte die Noten für Beethovens Mondscheinsonate aufs Pult und setzte sich auf den abgewetzten Klavierstuhl. Sie schraubte ihn höher, so dass er ihrer Körpergröße entsprach.
»Nun, Fräulein Jura, war es schwer?«, fragte der Professor.
»Es war kinderleicht«, lächelte sie schelmisch.
»Dann erwarte ich höchste Perfektion«, lächelte er zurück.
Lisa begann mit der leisen Einleitung in cis-Moll. Der Professor beugte sich auf seinem Stuhl vor und verfolgte ihr Spiel in seinem Notenheft. Als über den einfachen Arpeggien das dunkelelegische Thema ertönte, blickte Lisa aus den Augenwinkeln auf ihren Lehrer, um zu sehen, wie er reagierte. Sie hoffte auf ein Lächeln. Schließlich hatte sie den komplizierten ersten Satz in nur einer Woche auswendig gelernt und ihren Lehrer oft sagen gehört, sie sei seine beste Schülerin. Doch er schwieg und lauschte mit stirnrunzelnder Konzentration. Sie führte diesen Gesichtsausdruck häufig auf Trauer darüber zurück, dass er selbst nicht mehr spielen konnte: Arthritis hatte seine Finger versteift, sodass er die richtigen Spieltechniken nicht mehr selber demonstrieren konnte. Welche Grausamkeit des Schicksals gegenüber einem Pianisten, dachte sie. Dass sie selbst vielleicht einmal nicht mehr würde spielen können – nicht auszudenken.
Als Lehrmaterial ließ Professor Lenz oft Schallplatten für Lisa auf seinem Grammophon laufen. Horowitz, der Rachmaninow spielte, weckte seine staunende Bewunderung, doch am höchsten schätzte er Myra Hess’ lyrisch-gesangliche Beethoven-Interpretation.
»Hören Sie nur den Ton ihres Legatospiels«, pflegte der Lehrer mit einem Seufzer zu sagen.
Lisa lauschte, lauschte und lauschte. Den größten Teil der Stunde spielte sie, ohne dass sie unterbrochen wurde. Schweigend saß der Professor dabei und machte nur hin und wieder mit der Hand ein Akzentzeichen. Schließlich ließ er sein Notenheft sinken und hörte nur noch zu. Sie blickte ihn an und sah Niedergeschlagenheit in seinen Augen. Spielte sie so schlecht? Am Ende ihres Vortrags machte Lenz dazu keine Bemerkung. Lisa ging an ihr übliches Technikprogramm, ihre Tonleitern, und wartete eingeschüchtert auf sein Urteil. Abwesend kratzte der Professor den Kopf seiner Pfeife über dem Aschenbecher aus.
»Darf ich für nächste Woche das Allegretto einüben?«, fragte sie. Sie liebte den zweiten Satz und brannte darauf, dem Lehrer zu zeigen, wie sich ihr Legatospiel verbessert hatte. Er sah sie lange an, und schließlich sprach er es aus, Verlegenheit und Beschämung im Blick: »Es tut mir leid, Fräulein Jura, aber ich muss Ihnen mitteilen, dass ich Sie in Zukunft nicht mehr unterrichten darf.«
Lisa saß regungslos und wie vom Donner gerührt. Der Professor ging ans Fenster und zog die Gardine auf. Er starrte hinab auf die Menschen auf der Straße. »Es gibt fürchterliche neue Vorschriften, was die Juden angeht«, sagte er langsam, »es ist jetzt ein Verbrechen, ein jüdisches Kind zu unterrichten.« Er murmelte etwas in seinen Bart und fügte verzweifelt hinzu: »Kann man sich das vorstellen?«
Lisa fühlte Tränen in die Augen steigen.
»Ich gehe fort von hier«, sagte er leise, »es tut mir so leid.«
Er trat zum Flügel, nahm ihre schlanken jungen Hände in die seinen und drückte sie. »Sie sind außerordentlich begabt, Lisa. Vergessen Sie das nie.«
Durch ihre Tränen sah sie den Professor ein Goldkettchen hochheben, das auf dem Flügel lag. Daran hing ein kleines Amulett in Form eines Klaviers.
»Es ist nicht viel, aber nehmen Sie es bitte mit als Andenken an unsere gemeinsamen Musikerlebnisse«, sagte er leise und legte ihr die Kette mit zitternden Fingern um den Hals. Durch ihre Tränen starrte Lisa auf die Notenstapel, auf das Lisztbild an der Wand und versuchte, sich alles genau einzuprägen. Sie hatte Angst, dass sie das alles vielleicht nie wiedersehen würde. Um Haltung ringend, dankte sie dem Professor und suchte ihre Sachen zusammen. Dann wandte sie sich um und lief hinaus.
Kalter Wind ließ Lisas schlanken Körper frösteln, während sie auf die Straßenbahn wartete. Sie zog ihren Mantel enger um sich. Überall, wohin man blickte, die Braunhemden der SA. Starrten sie sie alle an? Erhobenen Hauptes ging sie auf die herankommende Bahn zu, stieg ein und packte die Haltestange fest mit ihren Wollhandschuhen. Sie blickte dem verschwindenden Gebäude nach und versuchte, sich das Muster seiner facettierten Glasfenster, die Größe des Portikus und den Glanz des bronzenen Türgriffs einzuprägen, der von Tausenden Händen blank geputzt war. Traurig winkte ihr der Professor aus seinem Fenster zu, dann verschwand er.
Wieso hatten die Deutschen jetzt auch in Österreich so viel Macht, wieso tanzten sie den Österreichern auf der Nase herum? Und wieso ließen die es sich gefallen? Es musste eine Antwort geben – irgendwer musste daran schuld sein. Mitleidige Blicke der anderen Fahrgäste streiften sie. Rasch riss sie sich den Hut vom Kopf und hielt ihn sich vor das Gesicht, da ihr klar wurde, dass sie seit Verlassen der Klavierstunde geweint hatte. Diesen schrecklichen Menschen wollte sie nicht die Genugtuung geben, das zu sehen.
Endlos zog die Fahrt sich hin. Ihr Zauber war verflogen. Lisa konnte es nicht erwarten, wieder in der Franzensbrückenstraße zu sein, wo jedermann sie kannte – das kleine Mädchen, das Klavier spielte. Zuerst hatte man hinter vorgehaltener Hand über ihre Mutter Malka getratscht, als sie in Herrn Minskys Gebrauchtwarengeschäft das teure Klavier erworben hatte. Wie konnten die Juras sich das leisten? Eine extravagante Anschaffung in diesen knappen Zeiten. Fünf Jahre später waren die Klatschmäuler verstummt. Malkas Tochter war etwas Besonderes. Sie war begabt. Man hörte sie im Fleischerladen, man hörte sie in der Bäckerei – überallhin wehte der Klang der Musik. Die Straße selbst erschien in einem freundlicheren Licht, wenn die Kleine spielte. Schon sprach man von ihr als einem Wunderkind. Manchmal spielte Lisa so laut, dass die hämmernden Oktaven das Klappern der Mülltonnen übertönten und sich in den allgemeinen Lärm des Mietshauses mischten. Wenn sie leise spielte, traten alte Ehepaare ans Fenster und ließen ihre Hausarbeit liegen. Melodien von Schubert und Mozart schwebten die Treppen hinab, in Wohnungen hinein und aus Wohnungen heraus. Sie verzauberten das ganze Viertel.
Die Musik riss die Fantasie des frühreifen Mädchens mit sich fort. Spielte sie die ersten Takte eines Straußwalzers, sah sie sich im Ballkleid aus Atlasseide, die Hand hoch erhoben, von einem Grafen oder Marquis zum Tanz geführt. Die Schar der eleganten Ballgäste wich auseinander, als sie die Tanzfläche betrat. Von klein an hatte Malka durch Geschichten, die sie ihr erzählt, und Bilder, die sie ihr gezeigt hatte, ihre Tochter dazu erzogen, in der Musik aufzugehen. Musik wurde Lisas ganze Welt. Sie wurde zu einem Zufluchtsort vor den dunklen Straßen, den schäbigen Wohnungen, den Ladengeschäften und Märkten, mit einem Wort der Heimat von Wiens Juden der Arbeiterklasse. Und jetzt wurde sie vor allem zu einem: zu einem Zufluchtsort vor den Nazis.
Mit untypisch langsamem Schritt ging Lisa auf das Haus in der Franzensbrückenstraße Nr. 13 zu, die Schuhe kaum noch vom Boden hebend, die aufrechte Gestalt gebeugt. Im Wohnzimmer warf sie ihre Noten auf die Bank, mit einer Geste, die ihre Mutter aufschrecken ließ.
»Was ist los, Lisele? Was hast du?« Malka nahm ihre Tochter in den Arm und streichelte ihr das Haar. Lisa schluchzte. Malka ahnte den Grund. »Ist es der Professor?«
Lisa nickte.
»Keine Sorge, ich habe dich früher unterrichtet. Ich unterrichte dich wieder.« Lisa versuchte zu lächeln. Sie wussten beide, dass Lisas Fähigkeiten die der Mutter längst weit überstiegen.
»Spielen wir doch jetzt etwas. Fangen wir den Tag ganz von vorne an.«
»Ich kann jetzt nicht spielen, Mama. Ich bin zu durcheinander.«
»Hast du alles vergessen, was ich dir beigebracht habe? Lisa, gerade in Zeiten wie diesen ist Musik besonders wichtig.«
Malka ging zum Schrank und zog die Préludes von Chopin hervor. Sie schlug das Heft bei Nr. 4 in e-Moll auf und setzte sich ans Klavier.
»Ich spiele die Rechte, du die Linke«, beharrte sie.
»Ich kann nicht.«
»Spiel, was dein Herz dir eingibt.«
Lisa setzte sich neben sie und schlug die treibenden, absteigenden Akkorde der Begleitung im Vierviertelrhythmus an. Als sie die linke Hand beherrschte, löste sie die Mutter ab und ließ nun beides zusammenfließen: die klagende Melodie des Diskants mit den dunklen Akkorden im Bass. Am Schluss mündete die Melodie in eine Frage und lief aus in einen verhauchenden e-Moll-Akkord. Draußen im Hof setzte eine alte Frau die schwere Einkaufstasche ab, lehnte sich an die Mauer und hörte gespannt zu.
Nach dem letzten Takt Chopin ging Lisa auf ihr Zimmer, legte sich aufs Bett und weinte so leise wie möglich in die Kissen. Wenige Minuten später spürte sie eine warme Hand auf der Schulter, die sie leise streichelte. Es war ihre ältere Schwester Rosie. »Nicht weinen, Lisa«, bat sie, »komm, ich zeig dir was.«
Lisa drehte sich um und blickte auf zu der schick gekleideten Zwanzigjährigen. Sie freute sich immer, wenn ihre ältere Schwester einmal Zeit für sie erübrigte, steckte sie neuerdings doch die meiste Zeit mit ihrem Verlobten Leo Schwartz zusammen.
»Weinen hilft nicht, Lisa. Lass mich dir etwas zeigen, das ich gerade gelernt habe. Komm!«, drängte Rosie und fasste Lisa an der Hand.
Im Schlepptau ihrer Schwester stolperte Lisa ins Bad und erblickte im Spiegel ihr tränenüberströmtes Gesicht. Rosie leerte eine Tasche aus und schüttete jede Menge Kosmetika auf den Badezimmertisch.
»Ich zeige dir eine neue Art, die Lippen zu schminken. Hinterher siehst du wie Marlene Dietrich aus.«
Wie schon so oft trug Rosie sorgfältig Lippen- und Augen-Make-up auf Lisas Gesicht auf.
»Siehst du? Ein kleines bisschen über die Lippengrenze hinaus.«
Ihre Schwester sollte sich auskennen, dachte Lisa. Vor zwei Jahren war sie Zweite im Miss-Wien-Wettbewerb geworden, an dem sie damals als Nichtarierin noch hatte teilnehmen dürfen. Unvermittelt platzte die zwölfjährige Sonia herein.
»Was macht ihr beiden denn hier?«
»Schau dir Lisa an. Sieht sie nicht wie ein Filmstar aus?«
Aufgeregt beäugte Lisa ihr neues Gesicht im Spiegel. So wirkte sie fünf Jahre älter! Da näherten sich Schritte, und alle erstarrten.
»Rasch! Mama kommt!«
Im oft geübten Notmanöver schrubbte Lisa sich mit Seife und Wasser das Gesicht, während Rosie rasch die Kosmetika verschwinden ließ. Die kleine Sonia schaute zu und kicherte. Schützend legte Rosie den Arm um Lisa, und einen Augenblick lang waren die Sorgen mit Professor Lenz vergessen. Dann fassten sich die drei Schwestern an der Hand und gingen hinaus, um ihrer Mutter zu begegnen.