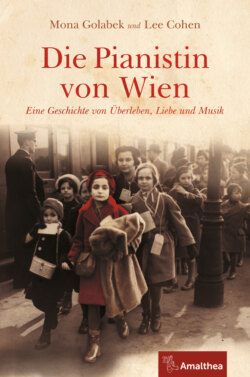Читать книгу Die Pianistin von Wien - Mona Golabek - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеBald gab es auch Ausgangssperren. Juden durften nachts nicht mehr auf die Straße. Sie durften nicht mehr ins Kino, nicht mehr ins Konzert, kaum noch an die Öffentlichkeit. Immer drakonischer wurde der Nazi-Terror. Die Attacken auf Ladengeschäfte und Wohnhäuser setzten sich fort, die Prügelangriffe auf der Straße wurden zum gewohnten Anblick. SA-Leute brachen in Häuser ein und verhafteten viele der männlichen Bewohner. Man munkelte, sie würden in Gefangenenlager gebracht. Auf behördliche Anordnung wurde Abrahams Schneiderladen im Erdgeschoss geschlossen. Auf dem rissigen Glas des Schaufensters klebte ein Plakat. Jemand hatte die Buchstaben auszukratzen versucht, aber sie waren noch lesbar: Judenblut – Schweineblut!
Die zwölfjährige Sonia begriff nicht, warum all das geschah. Sie ging noch zur Schule, die jüdischen Kinder waren jedoch bereits von den nichtjüdischen getrennt. Sie durfte mit ihren nichtjüdischen Freundinnen nicht mehr sprechen. An dem Tag, als ihre beste Freundin nicht mehr mit ihr reden wollte, kam Sonia weinend nach Hause gerannt.
»Warum, Mama, warum?«, schluchzte sie.
Malka suchte nach einer Antwort, aber sie begriff es ja selber nicht.
»Erinnerst du dich an die Purimgeschichte von Königin Esther und Haman?«, fragte sie Sonia und nahm sie in den Arm.
Das Mädchen nickte.
»Haman war der böse Ratgeber des Königs Ahasveros vor langer, langer Zeit, er trachtete allen Juden nach dem Leben. Der König verliebte sich jedoch in Esther, die ja Jüdin war und sehr schön, und nahm sie zur Frau und Königin. Dann nutzte Esther ihre Macht, um alle Juden zu retten.«
»Ja, ich weiß«, nickte Sonia.
»Also«, fuhr Malka fort, »heute gibt es einen bösen Mann, der genauso wie Haman ist. Er heißt Adolf Hitler. Er kann uns aber nichts tun, wenn wir tapfer sind und weise handeln. Wir müssen an unserem Glauben festhalten. Wir Juden sind ein von Gott erwähltes Volk. Wenn wir den Glauben an Gott nicht verlieren, wird Gott uns schützen.«
Malka küsste ihre Jüngste, stand auf und ging zum Klavier. »Komm, Lisele, arbeiten wir an ›Clair de Lune‹.« Lisa zog ein abgegriffenes Notenheft aus dem Stapel und setzte Debussys Meisterwerk auf das Notenpult.
»Mach kurz die Augen zu, ehe du anfängst. Wo siehst du dich?«
»Auf einer einsamen Insel mitten im Meer«, erwiderte Lisa ohne zu zögern.
»Darf ich auch mit?«, fiel Sonia ein und kniff die Augen zu.
»Aber natürlich«, antwortete die Mutter zärtlich.
Hellen Blicks schlug Lisa die Augen auf und legte die Finger auf die Tasten. Die Musik schimmerte wie Mondlicht, das auf den Wellen eines fernen Ozeans tanzt. Als Lisa von der Klaviatur aufblickte, sah sie, dass ihre Mutter die Augen geschlossen hatte und lächelte. Leise wiegte Malka den Kopf, vom Silberton ihrer Tochter gewiegt und fortgetragen.
Malka hatte ihren Mann gedrängt nicht auszugehen, er hatte jedoch nicht auf sie gehört. »Wenn du erwischt wirst, was machen wir dann?«, hatte Malka gefleht. »Herr Stein, unser Nachbar, ist gestern Abend nicht zurückgekommen!«
»Ich kann nicht die ganze Zeit im Haus sitzen. Das macht mich verrückt!« Er hatte den Mantel genommen und war eilends gegangen, ohne seiner Frau in die Augen schauen zu können. Er war hinausgegangen auf die Straße, auf der es, seit man die Straßenlaternen zerschlagen hatte, stockdunkel war.
Zu später Stunde kam er zurück.
Lisa spitzte die Ohren, um Gesprächsfetzen der Eltern aufzufangen. »Wir müssen etwas tun, sofort. Die Gelegenheit kommt vielleicht nie wieder.«
Leise schlüpfte Lisa aus dem Bett und schlich in den Flur. Sie hörte die Worte Holland und England.
»Sie lassen die Juden nicht mehr aus Wien hinaus«, fuhr der Vater fort, »aber ein paar Bahntransporte mit Kindern sind genehmigt worden, jüdischen Kindern. Hunderte sind schon weg. Eltern kämpfen und flehen um einen Platz in den Zügen. Die Sache ist in aller Munde.«
»Kinder werden weggeschickt? Ohne ihre Eltern?« Malkas Stimme war schwach und verängstigt. »Wohin denn?«
»Nach England. Man organisiert jetzt Züge, um sie nach England zu bringen. Ich glaube, wir sollten das ins Auge fassen.«
»Ist dir klar, wovon du sprichst? Die Kinder wegschicken ohne uns? Ohne Mutter, ohne Vater?«
»Meine Cousine Dora und mein Cousin Sid leben in London. Das ist vielleicht die letzte Gelegenheit.«
»Die Lage wird sich wieder bessern, Abraham. Es kann doch nicht so schlimm bleiben. Wir müssen Vertrauen haben.«
»Malka, in der Kultusgemeinde geht alles drunter und drüber. Ich habe schreckliche Geschichten gehört. Ich kann sie dir gar nicht erzählen. Bitte vertraue mir. Wir müssen es tun!«
»Aber selbst wenn wir wollten, wie soll das denn gehen?«
»Lass mich ausreden. Rothbard sagt, seine Frau will ihren Sohn unter keinen Umständen alleine fortlassen. Er glaubt, die Familie werde auf einem anderen Weg geschlossen hinauskommen. Ein solcher Weg steht uns nicht offen. Wir müssen den Familienzusammenhalt aufgeben. Rothbard will uns den Zugplatz seines Sohnes überlassen.«
Bestürzt und angstvoll holte Malka tief Luft. »Du verlangst von mir, meine beiden Töchter fortzuschicken?«
»Malka, du musst mir zuhören. Er hat nur einen einzigen Platz für ein einziges Kind. Wir müssen Lisa oder Sonia schicken … Rosie ist über achtzehn. Sie kommt nicht mehr infrage.« Abrahams Stimme versagte fast.
Lisa hörte, wie ihre Mutter anfing zu weinen.
»Wie brächten wir das übers Herz? Wie könnten wir es ertragen?«
»Eine unserer Töchter können wir in Sicherheit bringen«, drängte Abraham. »Sobald es dann geht, schicken wir die anderen nach …«
»So weit kann es doch noch nicht sein, so weit noch nicht«, flüsterte Malka ungläubig.
Lisa hörte Schritte, dann kam ihre Mutter aus der Küche. Traurig lächelte Malka ihre Tochter an. »Geh wieder ins Bett, mein Schatz. Geh ins Bett.«
Lisa küsste ihre Mutter auf die Wange und ging zurück ins Schlafzimmer, wo Sonia friedlich neben ihren Stoffpuppen schlief. Lisa starrte ihre Schwester an und fragte sich, auf wen die Wahl wohl fallen würde.
Am nächsten Morgen las Lisa am Küchentisch, als ihre Eltern eintraten. Abraham warf einen langen Blick auf die schöne Vierzehnjährige, die sein rotes Haar, sein gewinnendes Lächeln und seinen Willen und Eigensinn geerbt hatte.
»Wir haben einen Beschluss gefasst«, sagte die Mutter, »wir schicken dich nach England. Wir würden euch gern alle schicken, sind aber gezwungen, uns für eine von euch zu entscheiden. Du bist stark, Lisa. Du bist stark, und du hast deine Musik … Wir schicken dich als Erste. Sobald wir genug Geld auftreiben, kommen deine Schwestern nach.« Malka begann zu weinen. Lisa schwieg, und obgleich ihr ebenfalls nach Weinen zumute war, hielt sie ihre Tränen zurück. Weinte sie, würde sie es ihrer Mutter nur schwerer machen. Sie zwang sich, nicht mehr an die Trennungs- und Abschiedsbilder zu denken, die über sie hereinbrachen.
»Wohin soll ich denn? Was mache ich da drüben?« Lisa hatte keine Ahnung, wie sie allein zurechtkommen sollte, und sie war sich auch nicht sicher, ob ihre Eltern eine klare Vorstellung davon hatten. Aber sie wollte tun, was ihre Mutter ihr sagte. Sie wollte Vertrauen haben.
»Es gibt eine Organisation namens Bloomsbury House, die jüdischen Kindern die Verschickung nach England ermöglicht«, sagte ihr Vater. »Dort seid ihr in Sicherheit.«
»Können wir nicht zusammen fort? Können wir nicht warten und dann zusammen fort?«
Zärtlich blickte Abraham seine Tochter an. »Gleich als Nächste kommt Sonia nach, und Rosie und Leo und deine Mutter und ich werden dann zu euch stoßen. Bis dahin wird sich unsere Vetternfamilie um euch kümmern.«
»Was für Vettern sind das?«, fragte Lisa unglücklich.
»Ein Cousin und eine Cousine meiner Tante. Ich habe sie nie kennengelernt, jedoch gehört, dass er ebenfalls Schneider ist, Schneider in London.« Lisa zwang sich, sich das Bild eines Mannes mit Hut und elegantem Anzug auszumalen. »Dann arbeite ich für ihn und schicke euch das Geld. Ihr werdet sehen.«
Am Sonntag war es warm für die Jahreszeit, und die Familie beschloss, picknicken zu fahren. Lisa und Sonia trugen Maßkleidung, die ihr Vater geschneidert hatte, Rosie einen feschen Wickelrock mit passendem modischem Cape. Leo half Malka dabei, den Picknickkorb zu tragen, der randvoll mit Fleischpasteten und anderen Köstlichkeiten gefüllt war, eine Wohltat nach dem wochenlangen Graubrot und den dünnen Suppen. In den Prater, wie früher, gingen sie nicht mehr. Sie wussten sehr wohl, dass am Eingang nun ein Schild hing, auf dem stand: Für Juden verboten. Stattdessen gingen sie zur Straßenbahnhaltestelle, um in den Wienerwald zu fahren. Im Sommer hatten sie dort immer gern gepicknickt, im Winter jedoch noch nie. Die Straßenbahn fuhr vor. Sie trug ein neues Schild: Für Juden und Hunde verboten. Schweigend ging die Familie zur Wohnung zurück. Malka deckte einen Tisch auf dem hinteren Treppenabsatz, von dem man in den Hof blicken konnte. Ein Nachbar winkte aus dem Fenster: »Schöner Tag für ein Picknick!«
»Einen besseren könnte man sich nicht wünschen!«, gab Malka zurück und versuchte, fröhlich zu klingen.
Plötzlich summte Abraham ein Lied, das immer im Prater am Riesenrad gespielt wurde. Malka lächelte und fiel ein, und Lisa rief: »Hier kommt die Blechkapelle!« Sie schlug mit dem Messer den Takt auf dem Tellerrand. Sonia sprang auf und wedelte mit den Armen. »Schaut her, ich bin der Dirigent!«
Lachend sang die Familie, wie sie es in besseren Jahren getan hatte, als Wien noch Wien war und sie noch nicht gezwungen war, das düstere Universum zu bewohnen, in das sich die Stadt verwandelt hatte.
In der Woche nach Chanukka sollte der Kindertransport abgehen. An welchem Tag stand noch nicht fest. Abend für Abend zündete die Familie die Menora, den siebenarmigen Leuchter, an und sprach ihre Gebete. Freunde kamen nicht mehr zu Besuch: Juden durften nur noch mit besonderem Passierschein auf die Straße. Dennoch war die Familie nicht unfroh. Noch war man zusammen. Seit Tagen wartete Lisas Reisegepäck. Nur einen einzigen kleinen Koffer durfte sie mitnehmen – genug für eine Garnitur Kleider zum Wechseln und das gute Sabbatkleid. Sie wusste, dass es im Zug sehr eng werden würde.
Dann, eines Abends, bekam Abraham den Anruf. Frühmorgens am folgenden Tag sollte der Zug gehen. Vom Bett aus hörte Lisa ihren Vater sprechen. Jeden Tag, seit die Entscheidung gefallen war, hatte sie an diesen Augenblick gedacht, sich darauf vorbereitet. Die Reise beherrschte alle ihre Gedanken. Jetzt, da es so weit war, verlor sie dennoch die Fassung. Tränenüberströmt lag sie in den Kissen und streichelte leise das bestickte Bettzeug ihrer Mutter. Wie lange würde es dauern, bis sie darin wieder würde schlafen können? Wie lange, bis sie wieder vereint sein würde mit ihrer Familie, ihren Lieben?
Vor allen anderen stand sie auf und legte ihren blauen Mantel aus Twillstoff mit passendem kariertem Kopftuch zurecht. Vor dem Spiegel setzte sie das Filzhütchen mit dem blauen Band auf und gab ihm den perfekten schrägen Sitz. Noch einmal ging sie durchs Haus, entschlossen, sich alles einzuprägen, was sie liebte. Sie fühlte sich jedoch bereits wie eine Fremde. Ihr Blick schweifte über Wände, zählte die Gemälde, ihre Finger strichen über die schöne Klöppelspitze auf dem Esstisch. Sanft berührte sie die blauweiße Porzellanfigur – sie stellte einen alten Schneider dar –, die ihr Vater vor Jahren aus Dresden mitgebracht hatte, und blätterte durch den abgeschabten Lederband mit den handkolorierten Postkarten. Am Klavier hielt sie inne und spielte mit den Fingern stumm über den Tasten. Auf dem Notenpult standen ihre Noten von »Clair de Lune«. Sie rollte sie zusammen und steckte sie ein. Ein törichter Luxus, dachte sie, da im Gepäck doch so wenig Platz war, jedoch sie musste die Noten mitnehmen. Ihre Mutter kam aus dem Flur und zog den schweren Mantel an. »Es ist Zeit zu gehen.«
»Mama, versprichst du mir etwas?«
Malka lächelte ihre Tochter an: »Ja, natürlich!«
»Versprichst du mir, dass du in diesem Zimmer nichts veränderst? Dass du alles genauso lässt, wie es ist? Ich möchte wissen, dass es noch genauso ist, wenn ich daran zurückdenke«, flüsterte Lisa so leise, dass ihre Mutter sie kaum verstand.
»Ich verspreche es, Lisele.« Malka nahm sie in den Arm und wiegte sie.
Der Wiener Westbahnhof war schwarz vor Menschen. Nie hatte Lisa ihn so voll gesehen. Hunderte verzweifelte Familien drängten sich in Panik und Verwirrung auf dem Bahnsteig, Gepäckstücke jeder Form und Größe auf den wartenden Zug zuschiebend. An jeder Wagentür kontrollierten Nazisoldaten in braunen Mänteln Koffer und Ausweise und brüllten in Megaphone. Als das Gedränge zu dicht wurde, blieb die Familie Jura stehen, um Abschied zu nehmen. Es war beschlossen worden, dass Rosie, Sonia und Abraham zuerst Lebewohl sagen sollten, dann sollte die Mutter Lisa zum Zug bringen. Abraham hatte das Köfferchen für seine Tochter getragen. Als er innehielt und es ihr übergab, fasste Lisa nach dem Griff und blieb wie angewurzelt stehen. Sie hatte das Gefühl, dass sie wie eine Porzellanfigur zerspringen würde, wenn sich irgendjemand wegrührte von ihrer Seite.
Abraham legte den Arm um Rosie und schob sie sanft zu Lisa hin. Die beiden Schwestern umarmten sich. »Denk daran, nimm den Fensterplatz, damit wir dich sehen können«, rief die schöne ältere Schwester, den Lärm übertönend. »Bald sind wir alle wieder zusammen. Sei tapfer für uns.«
Jetzt schob Abraham seine Jüngste nach vorne. Lisa küsste Sonia, griff in die Tasche und legte Sonia das kleine Goldamulett von Professor Lenz um den Hals. »Mach die Augen zu und stell dir vor, dass wir bald wieder alle zusammen sind … und heb das für mich auf, bis ich dich wiedersehe.«
Dann schloss Abraham Lisa in eine Umarmung, die so fest war, dass sie beiden den Atem nahm. Er weinte. Das hatte sie ihn noch nie tun sehen, nicht einmal in der Kristallnacht, der Nacht des großen Pogroms. Schließlich nahm Malka sie bei der Hand und führte sie zum Zug.
In Reih und Glied warteten dort die Kinder aufs Einsteigen. Manche waren in Lisas Alter, manche älter, manche jünger, sie hielten ihre Lieblingsspielzeuge und Puppen in der Hand. Eltern mit tränennassen Augen knöpften ihnen die Mäntel zu, kämmten ihnen das Haar, banden noch einmal die Schuhe.
»Dass du dich auch gut benimmst …«
»Vergiss nicht, deine Butterbrote zu essen …«
»Zieh den Pullover nicht aus, sonst erkältest du dich …«
Vor Lisa und ihrer Mutter wartete ein etwa zehnjähriger Junge. Neben seinem Koffer trug er ein großes rotes Akkordeon. »Das bleibt hier«, sagte die Wache, »Wertsachen dürfen nicht aus dem Land.«
»Das ist keine Wertsache«, protestierte der Knabe, »ich brauche es, um zu üben.«
»Zeig mir, dass du spielen kannst«, beharrte der Wachmann.
Der Junge setzte sein Gepäck ab und schnallte das Akkordeon um. Hinter dem riesigen Instrument verschwand fast sein Kopf. Er begann einen einfachen Ländler zu spielen – mit angstzitternden Händen. Unerwartet schwebte Musik im Dreivierteltakt über den Bahnsteig und ließ einen gespenstischen Augenblick lang alle Gespräche und allen Lärm verstummen. Regungslos hörte der Wachmann zu, dann winkte er dem Jungen vorzutreten und das Instrument mitzunehmen. Ringsum begann wieder das Stimmengewirr des Abschieds. Malka blickte ihre Tochter an, die als Nächste an der Reihe war. Sie drückte sie an sich: »Du musst mir etwas versprechen.«
»Was denn, Mama?«
»Du musst mir versprechen, dass du an deiner Musik festhältst. Versprich mir das.«
»Wie kann ich?«, schluchzte Lisa. »Wie kann ich das ohne dich?« Sie ließ das Köfferchen fallen und umklammerte ihre Mutter.
»Du kannst es. Du wirst sehen. Denk daran, was ich dir beigebracht habe. Deine Musik wird dir helfen, es zu schaffen. Lass sie deine beste Freundin sein, Lisele. Und denke daran, dass ich dich liebe.«
»Los«, befahl ein Posten und winkte Lisa auf die steilen metallenen Trittstufen. In diesem Augenblick drückte Malka ihrer Tochter einen kleinen Umschlag in die Hand. Lisa hatte keine Zeit, einen Blick darauf zu werfen. Ehe sie sich versah, war sie von der Mutter getrennt und wurde in den Wagen hineingeschoben. Im Gewimmel drückte sich Lisa durch den Gang und ergatterte tatsächlich einen Fensterplatz. Die Scheibe war vom Atem vieler Münder beschlagen. Mit heftigen Bewegungen wischte Lisa mit dem Ärmel ein Guckloch frei. Sie musste mit ansehen, wie Kinder gewaltsam den Müttern entrissen und in den Zug getrieben wurden. Zitternd suchte sie nach dem schwarzen Haar und dem schwarzen Mantel ihrer Mutter. Sie glaubte, sie zu sehen, und winkte verzweifelt, wusste aber nicht, ob ihre Mutter sie erkennen konnte. »Mutti!«, schrie sie durch die Scheibe, aber ihre Stimme verlor sich in einem Chor ähnlicher Schreie. Schließlich lösten sich mit leisem Ruck die Bremsen, und der Zug fuhr an. Einen Herzschlag lang glaubte sie, ihre Familie zu sehen – zurückgedrängt hinter einer Absperrung. Sie wirkten tapfer. Dann verschwand alles in Dampf und Rauch.
Zum ersten Mal sah sie sich den Umschlag an, den sie in der Faust hielt. Sie riss ihn auf. Er enthielt ein Foto: Malka in stolzer, aufrechter Haltung, aufgenommen beim letzten Klavierkonzert, das Lisa in der Schule gegeben hatte. Auf der Rückseite stand: »Damit du deine Mutter nicht vergisst.«
Langsam beschleunigte der Zug, immer rascher flogen die Häuser vorbei. Schneebedeckte Felder erschienen. Wien blieb zurück. Lisas Augen hingen an dem verschwindenden Häusermeer. Schließlich war nur noch die dünne Silhouette des Riesenrads zu sehen, das sich langsam über den Dächern der Stadt an der Donau drehte.