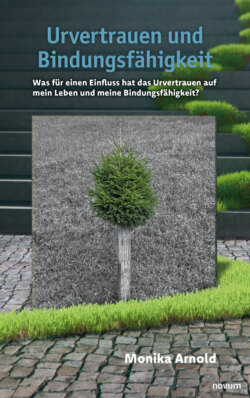Читать книгу Urvertrauen und Bindungsfähigkeit - Monika Arnold - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEntstehung von Urvertrauen
Urvertrauen und Bindung entsteht schon ganz früh, aus meiner Sicht beginnt dies schon in der Schwangerschaft.
Wir haben im Laufe der Zeit immer wieder festgestellt, dass es prägend sein kann, wie schon oben beschrieben, ob der Start ins Leben erwünscht oder unerwünscht war. Damit meine ich nicht eine unerwartete Schwangerschaft. Am Anfang benötigt es durchaus Zeit, mit dieser Situation umzugehen und sich auf die Schwangerschaft einzustellen. Mit der Zeit wird eine Beziehung zu dem Leben aufgebaut, dass heranwächst.
Eltern, die das Kind, das erwartet wird, ablehnen, scheinen dies auf die Kinder zu übertragen. Es ist für mich nachvollziehbar, dass ich dann erst gar nicht eine Beziehung aufbauen möchte oder kann. Geht uns nicht anders, es ist emotional ein ganz anderes Gefühl, ob ich an einem Ort erwünscht oder unerwünscht bin. Dementsprechend werden wir uns auch offen oder weniger offen verhalten. Unerwünscht zu sein löst ja ein Gefühl des Unwohlseins aus, es stellt mich als Person in Frage. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn ich mich nicht willkommen geheißen fühle, ich mich ganz anders verhalte und auch viel eher Fehler passieren, da ich ja überhaupt nicht weiß, ob dies z. B. gut ankommt, was ich mache, oder wie ich auf die anderen wirke.
Sind die Kinder auf der Welt, können sie ihre Bedürfnisse einzig durch Unzufriedenheit und Weinen zum Ausdruck bringen. Sie sind total dem Umfeld und den Personen ausgesetzt, die sich um sie kümmern und dass sie merken bzw. wissen, was das Baby braucht. So ist es auch eine große Herausforderung herauszufinden, was das Bedürfnis des Babys ist.
Schreit das Baby, weil es Hunger hat, die Windel voll ist, weil es müde ist, Bauchweh hat oder einfach nur die Nähe der Erwachsenen sucht?
Man stelle sich vor, neun Monate ist ein Baby im Bauch, entwickelt sich, wächst und ist mit der Nabelschnur mit der Mutter ganz eng verbunden. Bei der Geburt wird diese durchtrennt, die Bindung von Mutter zu Kind bleibt bestehen. Neun Monate lang war es ganz nah verbunden mit einer Person, geschützt im Bauch der Mutter. Auch denke ich, bekommt es mit, was für Emotionen da sind, ob auf das werdende Leben Rücksicht genommen wird. Es bekommt, wenn auch gedämpft, mit, wie die Außenwelt reagiert. Ob es laut oder leise ist, ruhig oder hektisch. Wie der Bauch behandelt wird, gestreichelt, geschützt wird. Es hört die Stimmen, die die Mutter umgeben und vieles mehr. Eine ganz enge Bindung zwischen Mutter und Kind, zwischen dem, was es im Bauch erlebt und von der Mutter mitbekommt.
Hat es dann Eltern, die mit sich und ihrer Situation so absorbiert sind, wird es diesen schwerfallen, die Bedürfnisse des Kindes zu erfassen. Es ist wichtig, diese Eltern nicht zu verurteilen, sondern sie und die Situation, in der sie stecken, zu verstehen. Sei es, dass sie psychisch mit ihren eigenen Erlebnissen durch die Schwangerschaft wieder konfrontiert werden, eine Suchtproblematik dahintersteckt, sie selbst Gewalterfahrungen gemacht haben, oder einfach selbst nie erfahren haben, wie es ist, bzw. sich anfühlt „willkommen zu sein“. Aus meiner Sicht eine sehr wichtige und prägende Erfahrung schon vor der Geburt.
Die Kinder solcher Eltern werden unruhig, wirken nervös und verunsichert, schreien mehr und somit steigt der Stresspegel für alle. Mit der Zeit werden sie feststellen, dass es wenig Erfolg hat zu schreien. Entweder ziehen sie sich dann zurück, schlafen viel, da es ja nicht viel bringt, etwas einzufordern, beschäftigen sich mit sich selbst oder verhalten sich eher auffällig, um zu der gewünschten Aufmerksamkeit zu kommen.
So haben wir mehrfach Kleinkinder betreut, die kaum ihre Bedürfnisse einfordern konnten. Wenn wir etwas unternehmen wollten, so konnten wir sie z. B. egal wann ins Bett legen und sie verhielten sich ruhig und schliefen. Ein Kind mit einem gesunden Urvertrauen wird das nicht mit sich machen lassen.
Nach außen wirkten die Kinder völlig pflegeleicht, was für Außenstehende so großartig aussah, hatte mit einem inneren Rückzug zu tun, aus der Erfahrung heraus, das Einfordern erfolglos ist und auch nicht zum Ziel führt. Somit kann keine Sicherheit und Selbstvertrauen aufgebaut werden. Es ist auch ein Schutz für das Kleinkind, Schutz vor erneuter Enttäuschung, da es ja schon erfahren hat, dass einforderndes Verhalten nicht zielführend ist.
Kinder die eine sogenannte gesunde Entwicklung durchmachen, haben Eltern, bei denen sie sich geborgen und sicher fühlen. Den Eltern gelingt es, die Bedürfnisse der Kinder richtig zu deuten und zu befriedigen. Die Kinder wirken zufrieden, zeigen mehr Sicherheit und Selbstvertrauen, wirken fröhlich und sind belastbar. Sie scheinen auch entdeckungsfreudiger zu sein, da sie sich ja in der Nähe der Eltern sicher fühlen. Es zeigt sich auch schon früh, dass diese Kleinkinder sich länger mit einer Sache beschäftigen können. Sie sind in einer geschützten Atmosphäre im Mutterbauch gediehen und strahlen dies auch aus durch Zufriedenheit und Tatendrang.
Kinder, die wenig Selbstvertrauen haben, werden sich nicht lange mit einer Sache beschäftigen, häufig ihre Spielsachen wechseln oder schnell die Lust verlieren. Dies hat sicher einen Zusammenhang damit, wenig Beständigkeit und Regelmäßigkeit erlebt zu haben. Eventuell haben sie die Erfahrung gemacht allein zu sein, wer traut sich schon was, wenn man sich allein fühlt. Eigentlich heftig, wenn ich dies so schreibe, so klein und schon auf sich selbst gestellt.
Finden viele Wechsel bei den Bezugspersonen statt, wie z. B. Eltern, die häufige Partnerwechsel haben, oder es gibt keine Konstanz in der Betreuung, viele Umzüge, viele Pflegefamilien, hinterlässt dies emotionale Spuren bei den Kindern. Sie werden mit der Zeit vorsichtig und lassen sich lieber gar nicht erst auf eine Beziehung ein, was reiner Selbstschutz ist, aus der Angst heraus, dass diese Beziehung auch wieder abgebrochen wird.
So ist der Selbstschutz eine gute und gesunde Reaktion, um sich vor Verletzungen und erneuten Enttäuschungen zu schützen. Konkret im Alltag mit Personen, die so etwas erlebt haben, heißt dies, zu verstehen, dass es viel Geduld braucht, bis sich die Kinder öffnen können und sich auch trauen, sich auf eine Beziehung einzulassen. Falls die Erwartung im Raum steht, die Kinder müssen sich doch wohlfühlen bei uns, wir sind doch da für sie, verstehe gar nicht, wo das Problem ist, dann werden diese Betreuungspersonen sehr schnell enttäuscht werden. Das scheint mir eines von den größten Schwierigkeiten zu sein. Zu verstehen, warum sich ein Kind nicht auf eine Beziehung einlässt und dies nicht persönlich zu nehmen. Hohe Kunst für die Eltern oder Betreuer, Bezugspersonen …
Dieser emotionale Rückzug ist aus der Sicht der Kinder für mich gut nachvollziehbar, warum soll ich mich auf etwas einlassen, wenn ich doch wieder enttäuscht werde.
Heißt dies nun, man muss sich selbst völlig vergessen als Eltern und sich nur noch um das Kind kümmern? Das denke ich nicht.
Sind die Grundbedürfnisse befriedigt, hat das Kleinkind gar nicht erst das Bedürfnis, so viel einzufordern.
So ein Baby bringt sehr viel Veränderung in eine Paarbeziehung, ein normaler Alltag scheint vor allem am Anfang schwierig, mit der Zeit wird sich dies einpendeln. Wir können ja auch nicht einfach kochen, sondern müssen dies erlernen oder wenigstens Grundkennnisse erwerben. Es scheint auch ganz wichtig zu sein, wie die Eltern selber ihre Kindheit erlebt haben. Ob ihre Bedürfnisse befriedigt wurden, und was sie an eigenen Erfahrungen mitbringen. Verrückt, was alles eine Rolle spielt und Einfluss auf unser Leben hat. So spielt die Vorbildfunktion für das Elternsein und der Umgang damit eine große Rolle.
Die Vorbildfunktion spielt eine wesentliche Rolle, weil es entscheidend ist, was die Kinder an Rüstzeug mitbekommen und wie ihre emotionale Entwicklung stattfindet. Das heißt, gerade in den ersten Lebensjahren, bilden sich schon ganz viele Anlagen, wie der Mensch später seine Vorbildfunktion lebt und auch weitergibt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Kinder zuerst übers Erleben und Mitmachen im ersten Lebensjahr sehr viele Grundkenntnisse mitbekommen, wie die Sprache erlernen, Abläufe erkennen und Automatismen entwickeln.
Ich habe sehr eindrücklich erlebt, wie ein Junge mit 2 ¾ Jahren zu uns in die Familie kam, er hatte kaum Sprache entwickelt. Er konnte sich nicht mitteilen, wirkte einerseits völlig verloren, andererseits wie in seiner eigenen Welt lebend. Es war schnell erkennbar, dass dieses Kind, vieles was für uns normal ist, nicht vorgelebt bekommen hatte. Er kannte Gegenstände anhand vom Namen, wusste jedoch nicht, wie sie aussehen, wo sie sind und was man z. B. damit macht. So musste mit Unterstützung von außen vieles erlernt werden. Die Sprache, die Zuordnung, was mit den Gegenständen gemacht wird. So galt es auch, Automatismen mit dem Kind zu entwickeln, da dies gänzlich fehlte. Dies einfach so als Gedankenanstoß, was das alles für Auswirkungen haben kann, wenn sich mit dem Kind nicht abgegeben wurde. Wir reden hier von Dingen. die im Alltag für uns alle als gegeben und normal erscheinen.