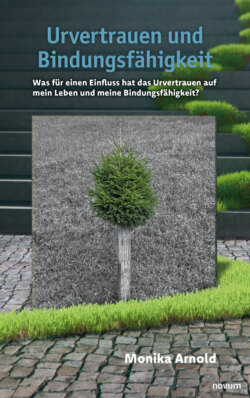Читать книгу Urvertrauen und Bindungsfähigkeit - Monika Arnold - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWas heißt es für ein Kind, wenn kein Urvertrauen aufgebaut werden konnte?
Kleinkinder und Kinder sind von Natur aus entdeckungsfreudig und lebensfroh. Sie werden oft als Individuen unterschätzt. Individuen sind, wie das Wort schon sagt, einzigartig. Ich selbst habe selten erlebt, dass das, was bei dem einem Kind funktioniert oder erfolgreich war, bei allen gleich wirkt.
Genau das ist meiner Meinung nach eine große Herausforderung und Chance, jedes Lebewesen in seiner Einzigartigkeit zu erfassen und verstehen zu lernen.
Wachsen Kinder in einer gesunden Umgebung auf, in der sie als Persönlichkeit ernst genommen werden, zeigen sie sich meistens mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen.
Wie der Name sagt, sie vertrauen auf sich und trauen sich etwas.
Traue ich mich etwas, dann kann ich auch eher mit Frust umgehen, denn ich habe ja das Vertrauen in mich selbst, dass es schon funktioniert oder es eine andere Lösung gibt. Die Kinder fühlen sich als Individuen wahrgenommen und anerkannt.
Lechzen wir nicht alle nach Anerkennung
und Liebe um unser selbst willen?
Kinder die wenig Stabilität, viele Beziehungswechsel erlebt haben, zeigen wenig Selbstvertrauen, scheinen weniger entdeckungsfreudiger und lebensfroher. Trauen sich weniger zu, wirken unsicherer und ihre Frustrationstoleranz ist oft niedrig. Es ist zu beobachten, dass sie schneller aufgeben, sich weniger lang mit einer Sache beschäftigen und schnell die Lust verlieren. Als Individuen werden sie nicht vollumfänglich wahrgenommen, sie müssen sich nach denen richten, die sie betreuen, fühlen sich eventuell unverstanden und alleingelassen. Fataler ist doch, dass es nicht nur ein Gefühl ist, sondern sie dies so erlebt haben.
Werde ich nicht vollumfänglich wahrgenommen, kann ich ja auch nicht mein Potenzial zum Tragen bringen. Traue mir viel weniger zu oder versuche es erst gar nicht aus Angst vor erneuter Enttäuschung oder Verletzung. Ja, und auch als Schutz vor erneuter Verletzung.
Fühle ich mich allein gelassen, dann bin ich völlig auf mich gestellt, das wiederrum ist erschwerend, da ich ja nicht weiß, wie, an was und an wen ich mich orientieren kann. Dann lasse ich es lieber sein, warte ab oder setze mich dem gar nicht erst aus.
Hingegen wird ein Kind im Normalfall sich neue Lösungen einfallen lassen an einer Sache dranbleiben und nicht so schnell von seinem Vorhaben ablassen. Denn es hat ja erfahren, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, und hat das nötige Selbstvertrauen dabei zu bleiben.
Was dann im Alltag vielleicht lästig ist, wenn ein Kind sein Vorhaben weiterhin verfolgt und nicht so schnell aufgibt. Diese, ich nenne es mal Fähigkeit, ist nicht zu unterschätzen und für eine gute Entwicklung wichtig.
So hatten wir zum Beispiel ein Kind, welches das erste Jahr nur am Tisch sass. Nach dem Frühstück blieb es sitzen bis zur nächsten Mahlzeit. war nicht zu motivieren, sich vom Tisch wegzubewegen und sich zu beschäftigen. Waren wir draußen, wurde es ihm schnell zu viel, es wollte bei einem Spaziergang nicht mehr weiterlaufen, setzte sich z. B. mitten auf die Straße und blieb dort sitzen, selbst wenn man weiterging, blieb es sitzen.
Mit der Zeit haben wir herausgefunden, dass das Kind eine serielle Störung (Serialität) (4) aufwies, Zeitabstände nicht einschätzen konnte, und darum eine sehr tiefe Frustrationstoleranz hatte. So war es sicherer, am Tisch sitzen zu bleiben bis zur nächsten Mahlzeit. So bekam es sicher etwas zum Essen und verpasste nichts. Es konnte nicht einschätzen, wie lang es dauert, bis es wieder etwas zu essen gibt. Ist es morgens, Abend- oder Mittagszeit?
Dieses Kind benötigte sehr lange, bis es durch das tägliche Erleben Sicherheit gewann und auch ein Bewusstsein für die Regelmäßigkeit und die Tagesstruktur entstand. Wir haben visuelle Unterstützungen eingebaut, z. B. eine große Pappuhr mit Zeigern und Bildern, mit ihr gebastelt etc. Es galt ihr zu helfen, sich zurechtzufinden und die Zeiten einordnen zu können. Ohne dies schien sie völlig verloren zu sein, Gott sei Dank waren wir zusammen sehr kreativ, um Unterstützung bieten zu können. Natürlich hatten wir auch die Unterstützung der Therapeutin.
Wenn ich mich auf die Straße setze, dann bin ich sicher, dass nicht zu viel von mir erwartet wird. Das Kind kann auch nicht abschätzen, ob es schafft mitzugehen und die ganze Strecke zu bewältigen. Verweigern ist dann sicherer, als nachher irgendwo allein gelassen zu werden. Was für eine bittere Erfahrung, wenn ich allein gelassen werde und auf mich gestellt bin.
Auch hier war es wichtig, Verständnis zu haben und mit viel Geduld dem Kind das Gefühl zu geben, es ist machbar, du schaffst es. Dem Kind Zeit zu geben und auch die Sicherheit zu vermitteln, es ist zu schaffen.
Die größte Herausforderung für mich war sicherlich, dies auszuhalten, nicht auf mich zu beziehen und zu verstehen, worum es hier eigentlich geht.
Ist es ein Machtkampf, will das Kind seinen Willen auf Biegen und Brechen durchsetzen? Da kommen so Gedanken auf wie: „Mann, ist das Kind hartnäckig! Das kann doch nicht wahr sein? Es kann doch nicht angehen, sich so zu verhalten, obwohl es bei uns dem Kind doch an nichts mangelt!“
Muss ich nun dem Kind zeigen, dass ich am stärkeren Hebel sitze. Kann ja wohl nicht sein, dass so ein kleines Kind alles bestimmt, mit mir nicht …
Glauben Sie mir, das bringt gar nichts, außer Frust auf beiden Seiten. Darum waren wir froh, dass wir regelmäßig Supervision hatten und mit Fachleuten zusammengearbeitet haben.
Das half uns, die Zusammenhänge zu verstehen und mit solchen Verhaltensweisen umzugehen. Die Situationen zu beschreiben, sich unseren Gefühlen zu stellen und zu erkennen, um was es wirklich geht. Schwierig war es sicherlich und ich denke, wir haben auch so manches Mal unseren Umgang mit solchen Situationen hinterfragt und angepasst.
Wir haben uns mit Fachleuten ausgetauscht und reflektiert, was löst es bei mir aus, wenn ein Kind sich so verhält. Hat es etwas mit meiner Geschichte zu tun? Was brauche ich, damit ich mich sicher fühle im Umgang mit dem Kind, und keine Emotionen, wie Frustration, Verzweiflung und Wut entwickle?
Einfach gesagt, Verständnis haben, ist nicht so einfach, wie auch zu verstehen, um was geht es hier eigentlich. Womit habe ich es hier zu tun, was steckt dahinter?
So haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass unsere Haltung der Schlüssel war für eine Lösung. Alles andere, den Gefühlen Raum zu geben, dementsprechend zu reagieren ist nicht zielführend. Es führt nicht nur bei den Kindern, sondern auch beim Gegenüber zu Frust und Verzweiflung.
Gelingt es ohne Wertung, so ein Verhalten (wie oben beschrieben) stehen zu lassen, komme ich auf die Sachebene und es werden sich neue Möglichkeiten auftun.
Kinder mit einem gesunden Selbstvertrauen sind sicher eine Herausforderung für die Eltern, benötigen eine klare Haltung und einen guten Umgang mit konsequentem Verhalten.
Kinder, die wenig Regelmäßigkeit erlebt haben, keine Strukturen hatten, wenig Verbindlichkeit erlebt haben, zeigen sich in ihrem Verhalten oft ganz anders und stellen für ihr Umfeld eine ganz besondere Herausforderung dar. Auch sie benötigen eine klare Haltung und einen Umgang mit konsequentem (5) Verhalten.
Konsequentes Verhalten hilft den Kindern zu wissen, woran sie sind, es gibt ihnen Halt, wie z. B. Leitplanken, die eine Straße säumen. Ohne Leitplanken würden sie, wenn wir bei diesem Bild bleiben, von der Straße abkommen, verunfallen, keine Spur einhalten können oder stehen bleiben.
Als wichtig erachte ich gerade bei diesen Kindern, dass wenn eine Konsequenz ausgesprochen wird, diese im direkten Zusammenhang steht, mit dem was sie gemacht haben. Es sollte so zeitnah wie möglich sein und ihnen helfen zu wissen, woran sie sind.
Ebenso wichtig scheint mir, die Konsequenzen müssen umsetzbar sein, ansonsten kann es eher kontraproduktiv sein und wir verunsichern die Kinder noch mehr.
Verunsicherte Kinder leben in dem ständigen Gefühl zu kurz zu kommen, haben Mühe, sich auf andere einzulassen, wirken egozentrisch und scheinen sich kaum auf die Bedürfnisse anderer einzulassen und Empathie zu empfinden.
Diese Kinder sind so tief verletzt, da sie ja nicht wissen, was gilt und ob sie auf die Erwachsenen bauen können. Wenn wir ehrlich sind, haben sie dies ja auch so erlebt und ihre Angst ist berechtigt. So scheinen sie sich in ihre eigene Welt zu flüchten, lassen sich auf nichts ein und lehnen auch vieles ab.
Wie soll sich denn Empathie für das
Gegenüber entwickeln, wenn mir selbst
dies nicht entgegengebracht wurde?
Wenn ich nie erlebt habe, dass man sich in mich eingefühlt hat, dann kann ich mich auch nicht in andere einfühlen. Da geht es um ganz existenzielle Befriedigung der eigenen Bedürfnisse.
Erst wenn ich immer wieder erlebe, das Versprechen gehalten werden, ich genug zu essen bekomme, weiß, wo ich schlafe und ich morgen bin, dann sind die wichtigsten Grundbedürfnisse befriedigt.
Was die Befriedigung der Emotionen angeht, ist es ganz wichtig zu wissen, ich bin erwünscht, ich werde bedingungslos geliebt und so wie ich bin, geschätzt. Meine Eltern oder Bezugspersonen haben mich gern, ich werde in den Arm genommen, kann schmusen und fühle mich geborgen und wohl.
Werden die Grundbedürfnisse nicht befriedigt,
kann dies verheerende Folgen auf die
Beziehungsfähigkeit und das ganze Leben haben.
Ist ja auch verständlich, wenn ich immer Hunger habe und nie satt werde, laufe ich mit einer permanenten ungestillten Sehnsucht durchs Leben. Mit allen Mitteln werde ich versuchen, diesen Hunger zu stillen, das geht so weit, dass ich rechts und links vergesse. Es gibt nur noch mich und meinen Hunger, meine Gedanken werden nur noch darum kreisen. Wie soll ich da noch wahrnehmen oder Verständnis haben für die Menschen, die mich umgeben. Um das aushalten zu können, werde ich zwangsläufig zu einem „Egoisten“. Ja, und es zeigt sich auch hier, dass es aus dem Erlebten heraus auch ein Überlebenswille erfolgt. Nun schaue ich, dass ich nicht zu kurz komme und sorge dafür, meine Grundbedürfnisse zu befriedigen.
Auch denke ich, ist dann nachvollziehbar, dass es lange Zeit benötigt, sich wieder zu öffnen, sich und seine Umgebung zu spüren und wahrzunehmen. Hat man einmal so einen ungestillten Hunger erlebt, wird dies einen Menschen sehr lange begleiten und dieser wird alles dafür tun, das so etwas nicht mehr vorkommt.
Dies ist im übertragenen Sinne zu verstehen:
Wie Hunger nach Liebe,
Hunger nach Geborgenheit,
Hunger nach Sicherheit,
Hunger nach Regelmäßigkeit,
Hunger nach Verlässlichkeit,
Hunger nach Konstanz und vielem mehr …
Wir haben oft erlebt, dass sich dies dann in dem Verhalten der Kinder gezeigt hat. Es schien nichts „niet- und nagelfest“, oft wurden unsere Vorräte geplündert. Ganz seltsame Dinge verschwanden aus dem Kellerregal wie z. B. Puddingpulver, rohe Teigwaren, Nussfüllung für Gipfeli etc. Kam Besuch und wir wollten Plätzchen hochholen, fand sich nur die leere Schachtel im Regal. Dinge, die die Kinder haben wollten, haben sie sich organsiert. Nicht, indem sie gespart haben, sondern es wurde genommen.
Wie vorher schon beschrieben, ungestillter Hunger nach Liebe, Sehnsucht, Geborgenheit etc.
Was steckt hinter dem Verhalten?
Es schien wenig Verständnis und Einfühlungsvermögen da zu sein, was das für denjenigen heißt, dem ich das wegnehme. Ich möchte das haben und dann nehme ich es. Oft waren sie dabei vordergründig so ungeschickt, dass sie sicher entdeckt wurden.
Für uns waren dies immer Hilfeschreie: Ich fühle mich so allein, alle anderen haben so viel und ich habe nichts. Ich mag auch nicht warten.
Es ist, wie schon am Anfang geschrieben, eine besondere Sprache. Eigentlich schreit das Kind nach der Befriedigung der Grundbedürfnisse, es scheint allerdings nie zu reichen und kaum möglich, das Bedürfnis zu stillen.
Das Bedürfnis, geliebt und anerkannt zu werden, scheint fast wie ein „Fass ohne Boden“. Bekomme ich dies nicht, dann versuche ich es anders zu stillen. Trotzdem wird es nicht zum gewünschten Erfolg führen, weil nur kurzfristig eine Sättigung eintritt und das Bedürfnis schnell wieder anklopft.
Wir haben im Alltag immer wieder mit den Kindern konstruktive Lösungen gesucht. Bei allem Verständnis, kann ich nicht einfach etwas nehmen, wenn mir danach ist. Eine Konsequenz war, ich verdiene mir etwas und ersetze es. Durch unsere Landwirtschaft boten sich uns da einige Möglichkeiten für die Kinder.
Wie geht man damit um, wenn die Kinder sich so verhalten? Wenn sie genügend Essen und Nähe bekommen aus unserer Sicht?
Das löst in erster Linie bei den Betroffenen Emotionen aus, wie Enttäuschung:
„Dem traue ich nicht mehr, nichts ist sicher. Muss ich nun alles wegsperren, geht ja gar nicht. So jemand muss weg, wer weiß, wo das hinführt!“
Ab und zu hatten wir Erfolg, wenn wir den Kindern eine Schachtel mit Süßem unter das Bett stellten, sogenannter eigener Vorrat. Diese Schachtel wurde gefüllt, wenn sie leer war. Am Anfang kamen die Kinder nach zwei bis drei Tagen, um diese Schachtel zu füllen. Später wöchentlich und nach zwei bis drei Monaten konnte es sein, dass die Rückmeldung kam, ich habe genug. Das hat nicht bei jedem Kind funktioniert, die Verletzungen waren tiefer und das ungestillte Bedürfnis nach der Liebe der leiblichen Eltern und deren Anerkennung sehr hoch. Es ging gar nicht um die Lebensmittel oder die Dinge, die sie sich nahmen, sie kompensierten ihre Leere, wollten sie füllen.
In einem anderen Fall wollte ein Kind, welches nicht mehr bei uns war, Kontakt aufnehmen. Rings um unseren Lebensmittelpunkt wurde eingebrochen in Ställe und Häuser. Die Polizei hat sich nach dem Ehemaligen bei uns erkundigt: Wir haben ihm dann über die Polizei ausrichten lassen, dass er einfach so vorbeikommen kann und jederzeit willkommen ist.
Was steckte hinter dem Verhalten? Warum bricht er in unserer Umgebung ein?
Da dieses Kind wegen der Schulsituation in ein Schulheim platziert wurde, eigentlich gar nicht wegwollte von unserer Familie. Benutzte es eine spezielle Sprache der Kontaktaufnahme. Eine Person, welche Sicherheit und Beständigkeit erlebt hat, hätte einfach angerufen und Kontakt aufgenommen. Warum war dies nicht möglich für das Kind?
Es hatte Angst davor, wieder enttäuscht zu werden, kaum ausgehalten, wegen der Schule von der Familie weg zu müssen. Angst abgelehnt zu werden oder unerwünscht zu sein. War verunsichert, wie die Gedanken des Kindes: Ich musste weg, ich konnte die Zusammenhänge nicht verstehen … Die eigene Enttäuschung war groß und somit die Umplatzierung für das Kind nicht nachvollziehbar.
So mache ich auf andere Art
auf mich aufmerksam und
ich hoffe, es wird verstanden.
Dieses Kind kam dann, nachdem die Botschaft weitergeben wurde, auf Besuch, es war sehr emotional für beide Seiten. Auch verrückt, so etwas zu erleben und vonseiten des Kindes, zu solchen Mitteln zu greifen. Uns hat es damals emotional geschüttelt und sehr betroffen gemacht.
So hat sich auch bestätigt, dass die Einbrüche gemacht wurden in der Hoffnung, dass wir merken, dass es Sehnsucht nach uns hat. Ein sehr eindrückliches Erlebnis, durch den erneuten Wechsel von der SPP in ein Schulheim, wurden wieder alle Verletzungen wachgerüttelt und die feine entstandene Bindung zu uns tief erschüttert.
Das sind oft die Einflüsse von außen, die wir nicht ändern können. Sind die Strukturen wie Schulen für die besonderen Bedürfnisse dieser originellen Kinder nicht vorhanden. So kann es sein, dass es wie in dem oben genannten Fall zu einer Umplatzierung kommt.
Solche Umplatzierungen können ganz vieles wieder ins Wanken bringen und sogenanntes Erreichtes ist wie weggeblasen. Damit will ich nicht sagen, dass es grundsätzlich schlecht ist, Wechsel vorzunehmen. Nein, es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu wählen und einen guten Abschluss zu gestalten, um einen Neuanfang machen zu können.
Im Pflegekinderwesen sind Wechsel manchmal unumgänglich, sind sie gut begleitet und wenn irgend möglich vorbereitet, kann es für alle Seiten einen Gewinn bedeuten. Es ist aus meiner Sicht sinnvoll, auch zu seinen Möglichkeiten und Grenzen zu stehen. Nicht immer konnten wir den geeigneten Rahmen bieten, den die Kinder brauchten.
So haben wir auch erlebt, dass die Kinder rastlos waren von der Sehnsucht zu den leiblichen Eltern, Diese Sehnsucht war umso größer, je weniger diese präsent waren. Die Kinder entwickelten Wunschvorstellungen, stellten ihre Eltern auf ein Podest, getrieben von Wünschen, Träumen und Sehnsüchten.
Wir haben so auch Kinder und Jugendliche begleitet, ihre Eltern zu finden, und in einigen Fällen auch miterlebt, wie sie zu diesen zurückgingen. Zurück in das alte Umfeld. Selbst dann, wenn wir wussten, es ist schwierig, wahrscheinlich wird es nicht gelingen. Für die Entwicklung der Jugendlichen war dies ein wichtiger Prozess. Der Realitätsbezug ist wichtig, um schlussendlich den Loslösungsprozess in der Pubertät machen zu können.
So hatten wir eine Jugendliche, deren Mutter wir gesucht und gefunden haben. Die Mutter und die Jugendliche hatten Sehnsucht nacheinander, so versprach die Mutter ihrer Tochter ganz viele Dinge. Eine eigene Wohnung, den Führerschein, ein Auto … Sie brach ihre Ausbildung ab und zog zu ihrer Mutter, die Versprechungen wurden nicht eingehalten. Die Jugendliche hat alles vergessen, was in der Vergangenheit war und sie erlebt hatte mit der Mutter. Sie war überzeugt, dass dies alles so stimmt, was die Mutter sagte, wie groß die Enttäuschung, als es nicht eintraf.
Die Sehnsucht und Hoffnung der Jugendlichen zu ihrer Mutter war jedoch groß und dies hat alles andere ausgeblendet. Wir konnten sie nicht davor bewahren, haben auch nicht versucht dagegen etwas zu sagen, denn das wäre eher kontraproduktiv gewesen. Das mitzuerleben war nicht schön. Lass mal los – mit dem Wissen, das geht nicht gut. Wobei, woher wollten wir dies so genau wissen? Es hätte ja auch gut gehen können. So waren auch wir hin- und hergerissen in unseren Emotionen und Einschätzung der Situation.
Lebe ich in meinen Wunschvorstellungen,
dann entspricht dies nicht mehr
der Alltagsrealität.
Die Kinder und Jugendlichen sind mehrheitlich in ihren eigenen unerfüllten Sehnsüchten wie hängengeblieben. Entwicklung schien dann noch kaum möglich.
Für uns hieß dies erst einmal zu verstehen, was da passiert, dass dies nichts mit uns persönlich zu tun hatte. Es war nicht einfach, das zu verstehen und dann im Sinne der Kinder so zu handeln, dass sie zu ihren Eltern zurückgehen konnten.
Wichtig war auch unsere Haltung, den leiblichen Eltern den Platz zu geben, der ihnen gebührt, ohne sie vor den Kindern schlecht zu machen. Mit dem eigenen Platz meine ich ihren Platz im System. Sie hatten die Kinder empfangen und geboren. Aus unserer Sicht war es wichtig, dies immer vor Augen zu haben. Egal, was die Eltern gemacht haben, sie waren die Eltern der Kinder und somit auch systemisch gesehen an erster Stelle für die Kinder. Das hat uns auch wiederum geholfen, uns zu distanzieren, dies scheint mir wichtig, um mit diesen Situationen umgehen zu können. Es waren für alle Seiten heftige Situationen.
Weg von Wertung und Bewertung: Wie, was ist gut und was nicht?
Ich glaube, das war der Moment, wo
wir verstanden haben, dass es wichtig
ist, die leiblichen Eltern der Kinder so,
wie sie sind, zu akzeptieren.
Sie waren nicht schlecht oder …, sondern haben das weitergegeben an ihre Kinder, was sie selbst erlebt haben. Es scheint wie ein Kreislauf, der uns immer wieder begegnet. Das. was ich mitbekommen habe als Kind und später erlernt habe, gebe ich weiter.