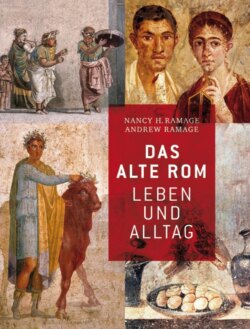Читать книгу Das Alte Rom - Nancy Ramage - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bronzestatuen
ОглавлениеEin überlebensgroßer Bronzekopf Hadrians wurde 1834 in der Themse in der Nähe der London Bridge gefunden. Hadrian hatte das ferne Britannien im
Jahr 122 n. Chr. besucht, was den Entstehungszeitpunkt des Portraits markieren könnte. Der Vollbart des Kaisers ist detailliert und sorgfältig ausgearbeitet, so dass das Portrait eine außergewöhnliche Schönheit annimmt.
Der Hals der Statue weist zwei quadratische Einsätze auf, von denen einer herausgefallen ist. Darüber hinaus finden sich eine Anzahl kleinerer Flicken. Dies sind für Bronzestatuen typische Reparaturarbeiten, um im Herstellungsprozess entstandene Unebenheiten auszugleichen, die durch den Guss geschmolzenen Metalls in eine Hohlform entstehen. Alle Bronzearbeiten ab einer bestimmten Größe sind innen hohl, um einerseits das Fehlerrisiko zu verringern, andererseits den Materialverbrauch zu minimieren. Um eventuelle Fehler auszumerzen, wurden bei Fertigstellung der Bronze Unebenheiten herausgeschnitten und mit nachträglichen Flicken versehen. Diese Flicken wurden mittels eines Hammers in die entsprechenden Stellen eingepasst und dann auf Hochglanz poliert, um Unregelmäßigkeiten der Statuenoberfläche zu vermeiden. In manchen Fällen wurde darüber hinaus ein gefärbtes Wachs verwendet, um Risse oder auch Luftblasen, die während des Gießens entstanden sind, zu füllen.
18 | Portraitkopf Hadrians. Bronze. 2. Jahrhundert n. Chr. Gefunden in der Themse bei London, 1834. H. 43 cm.
Die Römer galten als geschickte Metallschmiede, die diese Technik von ihren griechischen, etruskischen und nahöstlichen Nachbarn gelernt und dann verfeinert hatten. Metallarbeiten wandten sie jedoch nicht nur für die unterschiedlichen Kunstwerke an, sondern auch für Gefäße, Inschriften und kleinere Werkzeuge. Größere Werkzeuge sowie Klammern und Nägel wurden aus Eisen hergestellt (siehe Seite 77, Abb. 66).
Nach Trajans Tod übernahm dessen Cousin zweiten Grades, Hadrian | Abb. 18 |, 117 n. Chr. die Herrschaft. Angeblich hat Trajan seinen Nachfolger kurz vor seinem Tod adoptiert, doch konnte dies nie bewiesen werden und mag eine Erfindung der Trajanswitwe Plotina sein. Hadrian war einer der kultiviertesten der römischen Herrscher und bereiste das gesamte Reich. Seine besondere Aufmerksamkeit galt den Griechen, im Besonderen Athen, deren Kultur er offene Bewunderung entgegenbrachte. Diese Bewunderung mag als Erklärung dafür dienen, warum er in Anlehnung an die berühmten Philosophen Athens als erster der Kaiser und entgegen römischer Sitte einen Bart trug. Er hatte sowohl eine Frau, Sabina, als auch einen schönen Geliebten, Antinoos, mit dem er einen großen Teil seiner Zeit verbrachte. Als Antinoos im Nil ertrank, ließ Hadrian als Ausdruck seiner Trauer einen Tempel zu seinen Ehren errichten.
Hadrians Nachfolger, Antoninus Pius, begründete die Dynastie der Antoninen. Ihm und seiner Frau Faustina wurde auf dem Forum Romanum ein Tempel errichtet (Seite 21, Abb. 10). Eine fein ausgearbeitete, überlebensgroße Büste des Antoninus Pius im Militärmantel mit Wollsaum wurde in Kyrene, Libyen, ausgegraben | Abb. 19 |. Auf seine Anweisung hin wurde in Schottland der Antoninuswall errichtet, der die Grenze des Reiches über den Hadrianswall hinaus nach Norden hin erweitern sollte.
19 | Portrait des Antoninus Pius im gesäumten Militärmantel. Marmor. Ca. 140 n. Chr. oder später. Aus dem Haus des Jason Magnus, Kyrene, Libyen. Von Capt. R. Murdoch Smith und Comm. E. A. Porcher von der Britischen Marine gefunden. H. 71 cm.
Seine beiden Nachfolger regierten zwischen 161 und 169 harmonisch zusammen: Marcus Aurelius und Lucius Verus | Abb. 20, 21 | waren streng genommen nicht miteinander verwandt, doch hatte Antoninus Pius Marcus Aurelius als Sohn adoptiert, ebenso wie dieser Lucius Verus adoptierte und ihn mit seiner Tochter Lucilla verheiratete. In ihren Portraits werden die Züge der beiden Kaiser einander angeglichen, um so die Familienbande zu unterstreichen. Tatsächlich war Marcus Aurelius ein ernsthafter und nachdenklicher Herrscher, dazu ein aktiver Heerführer, der eine Sammlung von Betrachtungen, die Meditationen, verfasste. Lucius Verus wird dagegen in der Literatur seiner Zeit gerne als attraktiver und lebensfroher Mann beschrieben. In Taylor Combes Description of the Collection of Ancient Marbles (1812) beschreibt der Autor die beiden mit den folgenden Worten: »Marcus Aurelius war stets darauf bedacht, sich aufs äußerste für die Belange des römischen Volkes einzusetzen und hob sich besonders durch seine strengen moralischen Maßstäbe und seinen Lerneifer von seinen Mitmenschen ab. Lucius Verus dagegen brachte den Belangen des Reiches weitaus weniger Interesse entgegen und verbrachte seine Zeit in Trägheit, Luxus und Prasserei.« Außerdem schreibt Combe über Lucius, dass dieser »so extrem stolz auf seine Locken war, dass er seinem Haar ein unmäßiges Maß an Aufmerksamkeit zukommen ließ.«11 Durch die Machtübernahme des Commodus, Sohn des Marcus Aurelius, folgte nach langer Zeit wieder einmal ein leiblicher Sohn dem Vater auf den Thron. Doch in seinem Wesen und seinem Regierungsstil ähnelte Commodus wenig dem strengen Vater und entpuppte sich bald als wahnsinniger Herrscher, der als Gott, oder vielmehr als Herkules, verehrt werden wollte. Seinem Volk tat er wenig Gutes.
20 | Portrait des Marcus Aurelius in einem gesäumten Mantel. Marmor. 160–70 n. Chr. Aus dem Haus des Jason Magnus, Kyrene, Libyen. H. 71 cm
21 | Portrait des Lucius Verus im gesäumten Militärmantel, Tunika und Harnisch. Marmor. H. mit sis 94 cm.
Nach dem Tod des Commodus gab es wiederum eine Vielzahl von Konkurrenten um die Macht. Mit dem Aufstieg des Septimius Severus, dem Heerführer der östlichen Truppen, begann eine neue Dynastie. Das Gerücht, dass er mit Marcus Aurelius verwandt war, entspricht wohl nicht der Wahrheit, doch förderte Septimius diese Idee, indem er sich einen Bart wachsen ließ, der dem des großen Kaisers ähnlich war. Tatsächlich stammte Septimius aus Leptis Magna in Nordafrika, einer Stadt, die er während seiner Herrschaft prachtvoll ausbauen ließ. Seine syrische Frau, Julia Domna, war eine überaus hinterhältige Person, deren Boshaftigkeiten nur durch die ihres Sohnes Caracalla in den Schatten gestellt wurden | Abb. 22 |.
22 | Kopf und Büste des Kaisers Caracalla. Marmor. H. 49,5 cm.
Caracalla wurde im Jahr 212 n. Chr. Alleinherrscher über das Römische Reich, nachdem er seinen einzigen Bruder Geta umgebracht hatte. Bei dieser Tat hatte er vermutlich die Hilfe seiner Mutter. Das Andenken des Bruders wurde der damnatio memoriae unterworfen: Alle bildlichen und schriftlichen Hinweise auf Geta wurden ausgelöscht. So finden sich heute nur noch wenige Spuren des jüngeren Septimius-Sohnes, bei denen die Ausradierung oft deutlich sichtbar ist. Caracalla hatte einen harten und aggressiven Gesichtsausdruck, die Mundwinkel nach unten gezogen und die Stirn in Falten gelegt; all das zeigt deutlich, was für ein suspekter, um nicht zu sagen bösartiger Mensch er war. Typische Portraits dieses Herrschers zeigen ihn mit kurzem, lockigem Haar, einem kantigen Gesicht, den Kopf und die Augen zur Seite gewandt.
Die Jahrzehnte um die Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. sind als die Zeit der Soldatenkaiser bekannt (235–284 n. Chr.). Dies waren Jahre von nahezu beständigen Unruhen, in denen Kaiser schneller aufeinanderfolgten, als man sie zählen konnte. Zumeist kamen sie durch Gewalt an die Macht, um nur kurze Zeit später von dem nächsten Herrscher selbst getötet zu werden. Wir wissen um sie durch die Münzen, die in ihrem Namen geprägt wurden: Jeder von ihnen legte Wert darauf, sein Gesicht auf diesem Weg bekannt zu machen, um so seinen Anspruch auf Legitimität zu untermauern. Manche davon sind geradezu brutal realistische Portraits. Einer dieser Soldatenkaiser war Aurelian, der von 270 bis 275 n. Chr. regierte und mit dem Bau der großen Mauer um Rom begann, bevor er ermordet wurde. Mehrmals gab es mehr als einen Bewerber um die Nachfolge auf den Thron.
Die Zeit der Soldatenkaiser endete mit dem Aufstieg Diokletians (284–305 n. Chr.), der selbst ein Paradebeispiel derselben war. Doch umsichtiger als seine Vorgänger und weitaus mehr bedacht auf das Wohl des Reiches, entwickelte er eine neue Art von Regierung, indem er das Reich zunächst entlang der Adria in Ost und West teilte und diese Gebiete dann wiederum unterteilte, so dass insgesamt vier Verwaltungsbezirke entstanden. Das durch Diokletian eingeführte System nennt sich Tetrarchie, da zu jeder Zeit vier Kaiser gleichzeitig regieren sollten, zwei übergeordnete »Augusti« und zwei nachgeordnete »Caesares«: Nach dem freiwilligen Rücktritt der Augusti würden die Caesares diesen ins Amt folgen und selbst Titel und Würde der obersten Herrscher übernehmen. Eine solche Einrichtung bedeutete einen radikalen Bruch mit der Tradition, da zum ersten Mal das Amt selbst, und nicht mehr die Person, als das eigentliche Zentrum der Macht verstanden wurde. »Einheitlichkeit« war das neue Motto und dies wird auch an den nahezu identischen Münzbildern der ersten vier Tetrarchen deutlich. Das prächtige Diokletian-Medaillon | Abb. 23 | zeigt ihn gänzlich ohne eigene, individuelle Züge, aber mit typischem kantigen Kinn, scharfen Augenbrauen und kurzgeschorenem Haar und Bart. Das Medaillon orientiert sich an der Münzprägung Diokletians, ist jedoch deutlich größer und schwerer: mit 53,58 Gramm wiegt es zehnmal so viel wie ein Gold-Solidus. Das tetrarchische Experiment hielt nicht lange an. Misstrauen und Rivalitäten führten bald zu einem erneuten Bürgerkrieg im Westen des Reiches, aus dem im Jahr 312 n. Chr. Konstantin als Sieger und Alleinherrscher im Westen hervorging.
23 | Medaillon des Diokletian. Gold. 284–305 n. Chr. Durchmesser 3,9 cm.