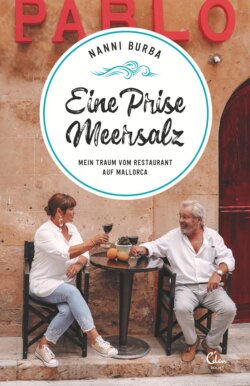Читать книгу Eine Prise Meersalz - Nanni Burba - Страница 11
Arme Reiche
Оглавление»Nanni, ihr habt den Job! Glückwunsch! Könnt ihr morgen anfangen?«
Beate ruft schon einen Tag nach unserem Treffen mit Madame P. an. Ich bin wie vom Donner gerührt. Es hat tatsächlich geklappt! Aber wieso nur springe ich jetzt nicht laut juchzend durchs Haus, knuddle die Hunde ab und kreische Harald die Ohren voll vor Freude? Eigentlich wäre das meine Art, und es ist ja auch eine Art Lottogewinn. Aber irgendetwas hält mich zurück. Mein Bauch wehrt sich gegen vorbehaltlose Euphorie und unbeschwerte Freude. Was der nur immer hat …
Zeitsprung zurück. Vier Tage zuvor: ein Donnerstag. Harald war mit den Hunden draußen und hat vom Kiosk die beiden deutschen Zeitungen mitgebracht. Er kommt mit der Mallorca Zeitung in der Hand an den Frühstückstisch und zeigt auf eine kleine, recht unscheinbare Stellenanzeige. »Schau mal, hier: ›Hausmeisterehepaar für Son Vida gesucht.‹ Hast du ’ne Ahnung, was Son Vida ist?«
Ich habe das auch noch nie gehört, meine aber: »Hausmeisterehepaar – das klingt doch irgendwie nach dem, was wir suchen. Also als Einstieg. Wenn wir mal eine Hausverwaltung haben wollen, sind doch Erfahrungen als Hausmeister nicht schlecht. Und wir haben beide handwerklich was drauf, einen Haushalt führen können wir auch … Ruf doch da mal an!«
Wir rechnen uns beide keine großen Chancen aus, weil wir keinerlei Erfahrungen in dem Bereich haben und uns auch noch nicht so gut auskennen auf der Insel, was zum Beispiel Handwerker angeht. Aber versuchen kann man es ja mal.
Harald nickt: »›Auch Absagen sind Erfahrungen‹, sagte mein erster Chef immer.«
Wegen des besseren Empfangs und vor allem weil er es hasst, wenn ich beim Telefonieren dazwischenquatsche, geht er zum Telefonieren in den Garten – und als er wieder reinkommt, sagt er strahlend: »Vielleicht haben wir am Sonntag um vierzehn Uhr ein Vorstellungsgespräch!«
Ich reiße überrascht die Augen auf und frage dann: »Gibt’s noch mehr Text, oder war’s das schon?«
Harald geht gelassen über meine Frotzelei hinweg – er weiß ja, dass er genau die Menge an Wörtern einspart, die ich zu viel rede. Zusammen bilden wir ein perfektes Team. »Die Frau, die dran war, heißt Beate. Sehr nett. Sie ist wohl die Bauleiterin eines Neubaus. Eine Villa für eine offenbar sehr reiche Deutsche. Son Vida liegt oberhalb von Palma, da wohnen die Superreichen, hat sie mir erklärt. Die Millionärin ist am Wochenende auf Mallorca, um Dinge zu regeln, da passt es gut, wenn wir vorbeikommen. Aber vorher will Beate uns mal kurz kennenlernen. Am besten heute noch.«
Ich merke, dass ich langsam nervös werde. Für mich war Haralds Anruf dort eher ein Jux – aber jetzt scheint es doch konkreter zu werden. »Äh, okay, ja. Ich kann heute ab siebzehn Uhr. Wieso will die uns denn … und wo denn? Und was zieht man da an?«
Harald schmunzelt: »Du siehst doch immer gut aus, Schatz. Ich denke, dass sie wissen will, ob wir Hippies sind. Oder Entführer. Oder Terroristen. Das Treffen heute wäre in einem Café in Palma. Sagen wir achtzehn Uhr?«
Als wir abends wieder in unserem Patio sitzen, versuchen wir, unsere Gedanken zu sortieren. »Den Termin am Sonntag hat sie bestätigt, oder?«
»Ja, ganz am Schluss«, meint Harald und grinst. »Offenbar hat sie nicht durchschaut, was für kriminelle Chaoten wir sind.«
»Na ja, viel gefragt hat sie ja auch nicht. Eher erzählt. Hattest du das Gefühl, dass sie ihre Chefin mag?«
Harald sieht mich entgeistert an: »Woher soll ich denn das wissen?«
»Na, man hat doch oft so ein Gefühl …«
»Nee, nicht ›man‹. Höchstens frau.« Er seufzt und leidet mal wieder schwer an seinen emotionalen Defiziten als Mann.
»Also, mir schien, dass sie sich nicht sehr wohlfühlt in ihrem Job. Na ja, egal. Was hat sie noch mal über die Millionärin erzählt?«
Harald rekapituliert: »Witwe eines Industriellen, Anfang 50, lebt die meiste Zeit des Jahres in Köln, Monte Carlo oder Florida, hat einen erwachsenen Sohn aus einer früheren Ehe. Haus ist fast fertig und wird gerade eingerichtet. Und unser Gehalt wäre in Ordnung. Nicht üppig, aber dafür ganzjährig. Inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld.«
»Zu Monte Carlo hat Beate doch erzählt, dass da ihre Jacht liegt und das ganze Jahr ein Kapitän nebst Steward bereitsteht. Da hatte ich das Gefühl, dass sie das ziemlich pervers findet. Bei allem Bemühen um Loyalität.«
»Was du immer alles interpretierst …«
»Und wie geht das jetzt am Sonntag? Klang gar nicht so einfach, da hinzukommen.«
»Das ganze Wohnviertel ist wohl mit einer Schranke gesichert. Wir sollen von da aus anrufen, dann holt Beate uns ab.«
Ich nehme einen Schluck Weißwein und seufze: »Ich würde jetzt ja zu gern Claudia anrufen! Oder meinen Papa! Oder Natalie und Marlene!« Harald zieht die Luft durch die Nase, und ich komme seinem Einwand zuvor: »Jaaa, ich weiß doch! ›Strengste Diskretion!‹ Das hat sie ungefähr zehn Mal gesagt, oder?«
»Genau. Und den Namen der reichen Dame kennen wir auch noch nicht. Madame Phantome …«
»Au ja, so nennen wir sie jetzt: Madame P.!«
Das Vorstellungsgespräch führt uns dann in eine Welt, die wir nicht kannten und uns bisher nicht mal haben vorstellen können. Son Vida ist so etwas wie das Beverly Hills der Balearen. Im Zentrum liegt das Luxushotel Arabella Sheraton, und rund um den riesigen Golfplatz stehen die alten und neuen Luxusvillen. Unter anderem, so erzählt Madame P. betont beiläufig, hätten hier die Besitzer bekannter Marken wie Swarovski und Coppenrath & Wiese ihre Domizile, aber auch politische Größen wie der ehemalige spanische Ministerpräsident Suárez. Der Golfplatz ist vor allem fürs Prestige wichtig – als angemessene Kulisse. Spielen tut kaum jemand der Anwohner. Und was heißt überhaupt Anwohner? Die meisten sind höchstens zwei bis drei Wochen im Jahr da. Den Rest des Jahres stehen ihre Riesenhäuser leer, und das Personal wartet auf sie und mäht den Rasen.
Am Sonntagabend sitzen wir dann beide wie erschlagen in unserem Haus – es kommt uns plötzlich absurd klein vor. Aber zugleich urgemütlich. »Gefiel dir dieser Palast eigentlich? So rein optisch, meine ich? Von außen sieht es ja aus wie das Weiße Haus.« Harald schaut mich neugierig an.
Ich schüttle mich: »Nee, überhaupt nicht! Oder ist das jetzt Neid? Das Esszimmer war so düster eingerichtet wie bei Dinner for one. Und auch die Bibliothek sah aus wie aus einem Edgar-Wallace-Film. Wie kann man an einem sonnenüberfluteten Ort wie diesem nur so schwere, dunkle Möbel hinstellen, als wäre es der Westerwald?«
Harald kratzt sich am Kopf: »Ich glaube, wenn wir den Job wirklich bekommen, kaufen wir uns zwei Tretroller. Die Hauptterrasse ist ja so groß wie eine Kirche. Und auf dem Weg von der Küche zum Esstisch wird das Essen kalt.«
»Ja, die Dimensionen sind echt einschüchternd. Aber welches Essen soll denn kalt werden? Sie hat zwar gefragt, ob wir Frühstück machen und kochen können. Aber sie hat doch gesagt, dass sie abends in der Regel essen geht. Und dass sie sowieso nur selten hier sein wird. Na, das muss ja nicht das Schlechteste sein … Und hast du die Bäder gezählt? Ich komme auf 15. Wofür nur?!?«
Harald zuckt mit den Achseln: »Ganz einfach: Weil sie’s kann.«
»Ich hab mich zwischendurch dabei erwischt, im Kopf zu überschlagen, was ihr Outfit gekostet hat. Also nur das, was sie heute anhatte. Ohne Schmuck. Aber bei tausend Euro hab ich aufgehört zu rechnen. Sonst wäre mir schwindlig geworden. Manolo Blahnik, Gucci, Yves St. Laurent … Hauptsache teuer. Geschmack ist zweitrangig.«
Und ich grüble weiter: »Ist dir eigentlich aufgefallen, dass die uns nicht die Hand gegeben hat? Weder zur Begrüßung noch zum Abschied? Und sie hat uns kein einziges Mal in die Augen gesehen. Ich meine, sie war nicht direkt unfreundlich – aber sie wirkte auf mich, als wolle sie am liebsten immer zehn Meter von uns entfernt sein. Als hätten wir eine ansteckende Krankheit.« Mich überläuft es kalt, als ich an diese Distanziertheit denke.
Harald nickt: »Haben wir doch. Die Krankheit heißt Armut. In Madames Augen sind wir bettelarm. Der Anblick unseres Autos und unserer Klamotten war für die doch geradezu eine Beleidigung. Ich könnte wetten, sie kommt selbst aus kleinen Verhältnissen – und nichts macht ihr mehr Angst als der Gedanke, wieder in so ein Leben zurückzufallen, wie wir es haben.«
Ich nicke. »Klar, hat Beate doch erzählt, oder? Sie war die Sekretärin ihres verstorbenen Mannes, bevor sie ihn seiner ersten Frau ausgespannt hat. Der Klassiker.« Ich gebe Harald einen Kuss und sage: »Dabei täte ihr das so gut, ein normales, glückliches Leben wie unseres.«
Harald küsst mich zurück. »Auch wenn wir den Job nicht kriegen: Das Gespräch heute hat uns gezeigt, was wir aneinander haben, nicht? Und wie gut wir es haben.«
Ich nicke. »Bist du eigentlich aus dem Sohn schlau geworden? Hat der uns überhaupt bemerkt?«
»Also auf mich wirkte der schwer gestört. Beate hat ja erzählt, er sei Künstler. Wenn du mich fragst: wenig Genie und sehr viel Wahnsinn.«
Ich muss kichern. Und klatsche dann in die Hände: »Los, komm, wir gehen schlafen. Morgen früh muss ich putzen. Und wir kriegen die Stelle sowieso nicht. Dann finden wir eben was anderes.«
Und nun sitze ich hier vor einem Riesenberg Schächtelchen und Tütchen und kann das alles überhaupt nicht fassen. Wir haben den Job und sollten sofort loslegen, weil Madame noch da war und uns »instruieren« wollte, wie sie das nannte.
Unangenehmerweise war ihr allererster Auftrag an uns, während ihrer Abwesenheit die ecuadorianischen Gärtner zu überwachen, die mit der Gestaltung des Außengeländes beschäftigt sind, und die polnischen Bauarbeiter, die letzte Arbeiten am Haus verrichten. Wir sollen dokumentieren, welche Fortschritte sie machen und ob sie sich unbezahlte Pausen genehmigen. Dabei gibt Madame ganz sicher, ohne mit der Wimper zu zucken, mehr für ein Abendessen aus, als die Leute im Jahr verdienen.
Wir haben ihr das Verlangte zähneknirschend zugesagt – allerdings hinter dem Rücken der Besitzerin umgehend Beate über diesen Spionageauftrag informiert. Und wir werden sicher stets nur Positives über die Arbeiter berichten.
Und nun – Madame und Sohn sind heute früh abgeflogen, nachdem Harald sie im hauseigenen BMW Coupé zum Flughafen chauffiert hat – sollen wir die Sachen auspacken, die in Paketen und Kartons herumstehen oder nach und nach eintrudeln werden. Die Einrichtung wurde nämlich ausschließlich in Deutschland gekauft und per Luftfracht hergeschickt – den Läden auf Mallorca traute Madame offenbar kein Angebot zu, das ihren Ansprüchen genügte.
Harald kommt zu mir. Er ist so blass, als hätte er gerade ein Gespenst gesehen. »Was ist los? Ist dir nicht gut?«, frage ich besorgt.
»Doch, doch, ich bin okay«, murmelt er. »Aber …« In der Hand hält er ein Stück Papier, das er jedoch vor meinen Blicken abschirmt. »Ich hab eben eine Kaschmirmatratze ausgepackt. Da hing noch das Preisschild dran. Schätz mal. 90 mal 1,80 ist sie groß. Standardgröße also.«
Ich bin überfordert. »Keine Ahnung. Sag schon.« Statt einer Antwort dreht er das Schildchen in seiner Hand um. Ich lese und bekomme weiche Knie.
Ich muss mich hinsetzen. »Nicht dein Ernst!« Die Schlafunterlage hat sage und schreibe 20.000 Euro gekostet.
»Und, was machst du gerade Schönes?«, fragt Harald ironisch. »Diamanten sortieren? Goldschmuck katalogisieren?«
»Nah dran«, antworte ich. »Ich packe das neue Silberbesteck aus. Natürlich alles von Christofle.«
Harald schaut ratlos. »Die Edelmarke«, erkläre ich. »Und guck mal: Für jedes einzelne Teil gibt es ein Tütchen, in dem ein Schächtelchen steckt. In dem ist dann noch mal ein Tütchen, und darin steckt – Abrakadabra! – ein Gäbelchen oder ein Löffelchen. Dagegen kannst du mit deiner Zauberei nicht an.«
Harald macht Stielaugen. »Ist das da alles Besteck?«
»Aber ja. So ein Zweipersonenhaushalt braucht doch mindestens hundert Besteckgarnituren. Ich werde heute sicher nicht fertig hiermit.«
Harald staunt weiter. »Ich schätze, allein die Verpackungen sind mehr wert als das gesamte Besteck, das normale Menschen in ihrem ganzen Leben haben.«
Ich weise ihn auf eine andere Ecke des Esszimmers hin, wo ebenfalls ein mannshoher Stapel Kartons steht. »Und das sind die Gläser. Ich hätte für das Liliom gern nur einmal so viele Gläser gehabt, wie diese beiden Leutchen für sich und ihre drei Gäste pro Jahr gekauft haben. Mit denen sie dann sowieso ins Restaurant gehen. Und hast du die Küche gesehen? Nur das Teuerste und Beste. Na ja, für das morgendliche Rührei muss es eben eine echte Profiküche sein.«
Harald beugt sich zu mir und flüstert: »Beate hat mir gerade erzählt, dass das Bild, das auf dem Couchtisch im Wohnzimmer rumliegt, eine fünfstellige Summe kostet. Mindestens.«
Ich schnaube verächtlich: »Mit teurer Kunst angeben, aber dann so geschmacklosen Nippes hinstellen! Hast du die Tischdeko gesehen? Diese Keramikhunde, die das Salzfass im Maul haben?«
Harald kichert. »Und der Fernseher! Versteckt hinter einer Holzverkleidung, und auf Knopfdruck kommt er raus. Wie aus einem James-Bond-Film aus den Achtzigern.«
Wir schütteln beide die Köpfe. Im Moment kommen wir uns vor wie Weltraumforscher, die eine fremde Zivilisation entdecken und es nicht fassen können. Ertragen lässt es sich nur mit Lästern und Lachen.
»Na, ich geh mal wieder rüber«, sagt Harald. »Ist dein Walkie-Talkie an?«
Ich nicke. Das Anwesen ist so riesig, dass wir uns oft nur per Funk werden verständigen können. Ein krächzendes »Wo bist du gerade?« wird eine der häufigsten Fragen sein, die wir uns gegenseitig stellen.
»Ach so!« Harald hält inne: »Hier ist übrigens alles videoüberwacht. Ein heimliches Bad im unbenutzten Pool ist also nicht drin. Aber wir haben ja unseren Strand. Heute Abend gehen wir noch schwimmen. Und dann in unser Haus. Wo man sich nicht verlaufen kann.«
Sechs Wochen später: Ich stehe im Waschkeller der Villa und heule vor Wut. Harald weiß schon, wo er mich findet, wenn mein Walkie-Talkie keinen Empfang hat. Ich hatte bereits ein paarmal solche Anfälle.
Er kommt zu mir und legt mir die Hand auf die Schulter. »Was ist denn los?«
Seit heute früh ist Madame P. hier – und die meistens recht entspannte Arbeitssituation der letzten Woche hat sich binnen weniger Stunden in das totale Gegenteil verwandelt.
Ich falle Harald schluchzend um den Hals. »Schatz, wollen wir das hier wirklich? Müssen wir uns das antun?«
Harald streichelt mich und fragt beschwichtigend: »Was ist denn passiert?«
Ich schluchze noch mal auf und erzähle dann: »Sie hat uns doch aufgetragen einzukaufen, bevor sie kommt. ›Grundnahrungsmittel und Champagner kaufen‹ hieß die Anweisung. Hast du ja gesehen, bei dir kam die Mail doch an. Und ich hab gestern eingekauft. Massenhaft. Alles, was mir wichtig schien. Und ein paar Flaschen Veuve Clicquot. Aber das war schon mal ein schwerer Fehler – man trinkt hier nur Champagne Ruinart oder Moët & Chandon, hat sie mir eben erklärt, die Schnepfe. Aber das Schlimmste kommt jetzt: Als sie vorhin entdeckt hat, dass nicht alle Lebensmittel aus diesem teuren Feinkostgeschäft sind, in das sie immer geht, hat sie Angst bekommen, es könne etwas von Lidl dabei sein. Und deswegen …«, mir kommen erneut die Tränen, »… hat sie die nagelneuen und einwandfreien Lebensmittel allesamt in den Müll geworfen. Alles. Ich hätte sie am liebsten geohrfeigt oder zumindest laut geschrien. Harald, ich möchte, dass wir hier sofort kündigen!«
Mein Mann ist genauso fassungslos wie ich. Und ebenfalls verstört von einer Szene, die er eben mitbekommen hat. »Vorhin haben Madame und ihr Sohn uns ja zu diesem komischen Appell antreten lassen …«
Ich nicke. Es war so unwürdig. Alle Angestellten und auch Beate – eine wirklich gestandene Persönlichkeit – mussten sich mit gesenktem Kopf den launischen Unmut der Herrschaften anhören. Beate wirkt ohnehin zunehmend entnervt, weil es immer neue Wünsche gibt und die Bauerei kein Ende nimmt.
»Danach haben sie den langen Gartenweg begutachtet«, erzählt Harald weiter. »Den sollten die Gärtner ja anlegen und einfassen. Du hast miterlebt, wie mühsam diese Arbeit war. Monate haben die daran geschuftet. Und jetzt hat Madame entschieden, dass ihr die Farbe und die Form der Einfassungssteine doch nicht gefallen. Obwohl sie die damals selbst ausgesucht hat, zusammen mit Beate. Scheißegal. Die müssen sie jetzt rausreißen und alles noch einmal machen. Ich glaube, Beate heult auch gerade irgendwo vor Wut. Falls es dich also tröstet: You’ll Never Walk Alone.«
»Nee, das tröstet mich nicht!«, sage ich trotzig. »Weißt du, was sie vorhin von mir verlangt hat? Morgens um acht soll immer die tagesaktuelle Frankfurter Allgemeine auf dem Frühstückstisch liegen. Was meinst du, wie schwer es war, Madame klarzumachen, dass das unmöglich ist, weil der Flieger mit den Zeitungen aus Deutschland einfach nicht so früh auf der Insel landet? Aber sie wollte das einfach nicht akzeptieren. Die denkt wirklich, die Welt soll gefälligst ihren Wünschen gehorchen.«
Harald hat auch noch einen: »Mir wurde vorhin eingeschärft, dass der BMW nicht nur immer picobello sauber, sondern auch randvoll getankt sein muss. Und sie hat mich tatsächlich losgeschickt zum Nachtanken. Ich habe genau 2,61 Liter getankt. Und vermutlich mindestens die Hälfte davon auf dem Rückweg von der Tankstelle hierher wieder verbraucht.«
Ich beginne, die Laken aus dem Trockner zu nehmen und zusammenzufalten. Die lagen sauber und gebügelt im Schrank, mussten aber nochmals gewaschen werden, bevor Madame sich darauf niederlässt.
»Harald, warum machen die so was? Sind die so weltfremd? Oder haben die einfach Spaß am Schikanieren?«
Harald überlegt: »Sicher beides. In ihrer Vorstellung dreht sich die Welt nur um sie. Und je verrückter ihre Wünsche sind, desto mächtiger fühlen sie sich. Auch der komische Appell hat eine Funktion. Wir sollen verstehen, dass wir zum Personal gehören und deshalb keine gleichwertigen Menschen sind.«
Ich staune. Harald ist wütend, aber zugleich glasklar. Offenbar macht er sich schon länger Gedanken über das, was wir hier erleben.
»Also willst du auch weg hier?«, frage ich.
»Puuuuh …«, macht mein Mann. »Also, wenn die Alte immer hier wäre, müssten wir sofort weg. Aber das ist jetzt für zehn Tage – und dann ist sie vermutlich den Rest des Winters in Florida. Nanni, es ist Oktober. Wir kriegen jetzt keine andere Arbeit, bis April nicht. Meinst du nicht, wir können wenigstens so lange durchhalten?«
Ich nicke. Er hat ja recht. Aber dann kommen mir wieder die Tränen: »Lilli und Aura fehlen mir!« Während der Anwesenheit von Madame dürfen beziehungsweise müssen wir in einem der Gästeapartments in der Villa wohnen. Mit der Badewanne aus Marmorstaub – jede der 15 im Haus ist individuell designt. Da haben wir für unsere Dienstbotenhunde lieber eine Betreuung organisiert. Nicht dass sie den edlen Palast noch entweihen.
Am selben Abend, wir liegen bereits im Bett, kommt Madame plötzlich in ihren Stöckelschuhen in unsere Wohnung marschiert. Es gibt noch keine »Dienstbotenrufanlage«, also muss sie sich selbst herbemühen.
Völlig aufgelöst beklagt sie sich, dass sie kein warmes Wasser habe. Harald kann es sich nicht erklären und riskiert den Satz: »Das kann eigentlich kaum sein. Ich habe heute Mittag noch mal alles ausprobiert mit Bea…, mit der Bauleiterin. Da war alles in Ordnung. Soll ich schnell mitkommen und nachsehen?«
Empört und fast panisch lehnt sie ab: »Auf keinen Fall betreten Sie mein Apartment!«
Als sie wieder abgerauscht ist, kommt Harald ein Gedanke: »Die hat doch so ein Antiverbrühsystem einbauen lassen überall. Wahrscheinlich fehlte ihr nur die Geduld, die paar Sekunden abzuwarten, bis heißes Wasser kommt. Na, nicht mein Problem. Schlaf gut, Schatz.«
Spricht’s, dreht sich um und schläft umgehend ein. Während ich daliege und immer wacher werde – und immer wütender auf Madame P. Ich weiß nicht, ob ich das alles noch lange aushalte: den Luxus, die Dekadenz, die emotionale Kälte, die Willkür, die Launen, die Schikanen, die Arroganz … Dass man sich, wenn man sich alles leisten kann, auch alles erlauben darf – das ist für mich neu. Ich bin anscheinend echt naiv.
Am nächsten Tag wird das Warmwasserproblem übrigens nicht mehr thematisiert – woraus man schließen kann, dass Harald recht hatte. Aber gegenüber dem Personal einen Irrtum eingestehen oder sich gar entschuldigen? Niemals! Keine zwischenmenschliche Kommunikation mit »niederen« Menschen. Sich nicht für ihr Leben interessieren. Und niemals erklären, warum man bestimmte Wünsche hat und warum man heute das Gegenteil dessen will, was man gestern angeordnet hat. So scheint es im Handbuch für Reiche zu stehen. Natürlich weiß ich, dass nicht alle Reichen so sind. Trotzdem ist das hier eine wirklich eindrucksvolle Lektion. Leider erlebe ich sie aus der Sicht des Personals und nicht aus der der verwöhnten reichen Witwe …
Die Tage mit Madame gehen dahin – und sie sind stressig. Aber nicht wegen der Arbeit und der 14-Stunden-Tage; das sind wir gewohnt. Sondern nur wegen ihrer Launen und Allüren.
Am letzten Abend vor Madames Abreise tauschen wir uns wieder aus, vor dem Einschlafen. Harald schüttelt den Kopf. Er wirkt tief verletzt.
»Ich hab sie ja jetzt jeden Abend ins Tristán gefahren. Und wieder abgeholt …«
Das Tristán ist das legendäre Luxusrestaurant von Gerhard Schwaiger im Hafenort Puerto Portals. Der einzige standesgemäße Ort für Madame und ihren Sohn. Auf meine Kochkünste, die ja ein Einstellungskriterium waren, wollte sie offenbar doch lieber nicht zurückgreifen.
»Heute Abend wollte ich mal Konversation machen und habe gefragt: ›Na, hat der Herr Schwaiger schön für Sie gekocht?‹ Und was passierte? Nichts. Ich bekam keinerlei Antwort. Nichts. Nada. Als wäre ich Luft und hätte nichts gesagt. Das ist so demütigend!«
Hat mein Mann etwa Tränen in den Augen? »Ich glaube, die Frau ist einfach sehr dumm. Ihr gestörter Sohn sitzt immer hinten, aber sie besteht auf dem Beifahrersitz. Und weißt du, warum? Sie schaltet an jedem verdammten Abend das Navi ein für diese superkomplizierte Zehn-Minuten-Strecke! Ich hab am dritten Tag mal vorsichtig angemerkt, dass ich den Weg inzwischen kenne. Und wieder: nichts. Keine Reaktion.«
Ich streichle ihm den Unterarm. »Mach dir nichts draus. Das sagt nur was über sie und nichts über dich.«
»Na ja, sie will mir damit schon was sagen«, meint Harald. »Ein Dienstbote hat keinen Orientierungssinn zu haben. Und er hat nicht besser zu sein als dieses schicke Gerät.«
»Ich hab aber noch was Gutes«, gluckse ich. »Heute Nachmittag musstest du Madame doch allein in die Stadt fahren. Da hat ihr Sohn sich in den Park gestellt und bei ohrenbetäubender Rockmusik aufs Meer gestarrt. Wirkte irgendwie extrem gestört. Und dann kam er plötzlich zu mir – ich war gerade am Handtücherfalten – und fragte, ob er etwas helfen kann. Eigentlich bettelte er geradezu um eine sinnvolle Beschäftigung. Er tat mir fast leid in dem Moment.«
Harald muss grinsen.
»Aber das ist noch gar nicht der eigentliche Knaller. Während du sie aus dem Tristán abholst, muss ich ja immer ihr Bett aufschütteln. Dabei habe ich heute mal neugierig in die Schränke gespickt. Total krasse Schuhkollektion. Nuuuur High Heels. Nichts anderes. Kein einziges bequemes Paar. Und die Schuhe natürlich alle von Christian Louboutin, Jimmy Choo, Prada … ach, das sagt dir ja sowieso nix. Aber das Beste kommt jetzt: Im Schrank lag eine Tüte mit ein paar Gläsern mit eingelegten Oliven. Und wo hat sie die Mitbringsel für die Kölner Bekanntschaft wohl gekauft?«
Harald schaut mich ratlos an. Ich pruste los: »Bei Lidl!«
Als wir uns von unserem Lachanfall erholt haben, meint Harald: »Dieses Luder! Ich sollte sie vor so einem schicken Café absetzen und warten und hab mich noch gewundert, dass sie nicht da reingegangen ist, sondern um die Ecke. Da war die tatsächlich bei Lidl! Mit einer Gucci-Tasche als Tarnung!« Er wischt sich die Lachtränen aus dem Augenwinkel und küsst mich: »Gute Nacht, Schatz. Morgen ist sie weg. Und dann können wir wieder normal arbeiten.«
Einen knappen Monat später, Mitte November, bekomme ich abends eine E-Mail. Direkt von Madame P. Ich eile zu Harald in den Wintergarten, wo er mit den dösenden Hunden sitzt und sein Abendweinchen trinkt.
»Madame ist offenbar zufrieden mit uns. Sie will, dass wir dauerhaft ihre Hausmeister sind. Wir sollen da einziehen. Hättest du damit gerechnet?«
Wir schauen uns ratlos an. Von einem permanenten Wohnen dort war nie die Rede. Sollen wir uns jetzt freuen über die Anerkennung – und über das feste Einkommen? Oder graust es uns bei der Vorstellung, dass wir Madame dauerhaft zu Diensten sein müssen? Während wir hin- und hergerissen sind, schlägt Aura plötzlich heftig mit dem Schwanz auf den Boden und jault jämmerlich. Sie scheint einen Albtraum zu haben.
Ich sage: »Ich schreib ihr erst mal, dass wir uns über ihr Vertrauen freuen, aber nur da einziehen können, wenn wir die Hunde mitbringen dürfen. Dann sehen wir weiter.«
Am folgenden Morgen, während wir uns zum Dienst fertig machen, klingelt mein Handy. Ganz schön früh, denke ich.
Beate ist dran. Sie wirkt betreten und druckst herum, bevor sie mit der Sprache rausrückt: »Ihr seid fristlos gekündigt. Das tut mir total leid.«
Mir bricht der kalte Schweiß aus. Mir hat noch nie jemand fristlos gekündigt. Und egal wer es ist – es fühlt sich nicht schön an.
Ich stammle: »Aber wieso … was … gestern Abend hat sie doch noch …«
Beate unterbricht mein Gestotter: »Es ist wegen der Hunde. Ihr hättet die bisher nicht erwähnt. Das sei ein Vertrauensbruch, der die Basis einer weiteren Zusammenarbeit zerstöre. Ich soll euch heute eure persönlichen Sachen übergeben. Unten in Palma. Das Dezembergehalt bekommt ihr noch ausgezahlt. Aber ohne Weihnachtsgeld.«
Offenbar gelten wir plötzlich als eine Art eklige Insekten, die sich dem Haus nicht mehr nähern sollen. Aber zu unserer Überraschung verspüren wir nach dieser ja eigentlich schockierenden Blitzkündigung vor allem eines: Erleichterung. Uns wird klar, dass wir in dieser dekadenten Welt nicht auf Dauer hätte arbeiten und wohnen wollen. Und ich erinnere mich noch einmal an meine Heulanfälle in der Waschküche von Madame.
Das Gute aber ist: Was wir bisher dort verdient haben, wird uns bis April durch den Winter bringen, wenn auch knapp.
Harald hebt seinen angestoßenen, billigen und furchtbar hässlichen Lieblingskaffeepott und fasst feierlich zusammen: »Das war eine interessante Erfahrung – aber zum Glück nicht unsere Zukunft. Ich glaube, wir sind gerade aus der teuersten Geisterbahn der Welt rausgeflogen.«
Und ich ergänze: »Ich würde niemals tauschen wollen mit solch weltfremden Menschen. Die sind ja regelrecht gefangen in ihrem goldenen Käfig. Deren Reichtum ist wie ein Knast. Mal ehrlich: Diese Frau ist kein glücklicher Mensch. Sondern eine arme Reiche.«