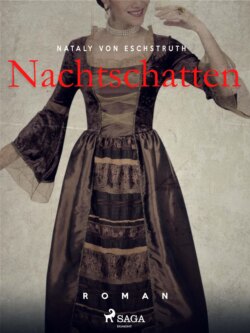Читать книгу Nachtschatten - Nataly von Eschstruth - Страница 9
Sechstes Kapitel.
ОглавлениеIm nördlichen Deutschland, nahe der Küste des wogenden Bernsteinmeeres, liegt Schloss Triberg.
Mächtige, uralte Waldungen umgeben es, kleine Seen spiegeln das Bild dunkler, melancholischer Tannen, und auf den trutzig stumpfen Türmen thront die Einsamkeit und starrt mit schläferigem Blick über das weite, flache Land, das den weitgedehnten Besitz der Majoratsherren Doos von Thüngen ausmacht.
Ehemals sassen die Freiherren wie kleine Könige inmitten ihres ungeheuren Besitzes, abgeschnitten von dem Verkehr mit der Aussenwelt, denn die Eisenbahn durchquerte das Land noch nicht, und die Nachbargüter lagen so weit ab, dass man sie bei den schlechten, oft grundlosen Wegen nur selten, und dann nur mit Schwierigkeiten, erreichen konnte.
Als vor etlichen Jahren aber eine Zweigbahn angelegt wurde, erreichte es der alte Erbherr von Triberg, dass sein Schloss eine Haltestelle im Wald bekam, und nun konnte man mit der angenehmen Möglichkeit rechnen, binnen einer Stunde zu der nächsten Provinzialstadt zu gelangen, die freilich für den Verkehr auch so gut wie nichts bot, da ihre Mauern nicht einmal Militär beherbergten. Immerhin war es in wirtschaftlicher Beziehung von grossem Vorteil, und wenn man sich auch in dem öden, recht schmutzigen Trinowo nicht sonderlich amüsieren konnte, so bildete die kleine Stadt doch bei besonderen Anlässen den Sammelplatz für die Gutsbesitzer der Umgegend und bot durch ihr Sommertheater oder durch ein Winterkonzert, das durchreisende Künstler veranstalteten, etwas Abwechslung.
Der bejahrte Freiherr Doos von Thüngen, der seit langen Jahren Schloss Triberg bewohnt, hatte nicht viel Wert auf Zerstreuung gelegt.
Er lebte mit seiner sehr kränklichen Frau in kinderloser Ehe, war ein unzugänglicher, mürrischer alter Mann, dem das Leben von Jugend auf die liebsten Wünsche versagt hatte, den es an Liebe und Glück bettelarm gelassen, obwohl es ihm den feudalsten und herrlichsten aller Besitze als schwarze Perle in den Schoss geworfen.
So war Baron Georg ein stiller, verschlossener Mann geworden, der sich von der Welt, die ihn so wenig mehr befriedigte, hinter die gewaltigen Mauern seines Schlosses zurückzog und nur noch Interesse für seine Bücher hatte — „die treuesten und selbstlosesten Gesellschafter“, wie er sagte, „die einzig imstande sind, der Phantasie das verlorene Paradies von Glauben, Liebe und Treue neu zu erschliessen“.
Die Bewirtschaftung des Gutes interessierte ihn nicht.
„Für wen soll ich schaffen und arbeiten?“ grollte er. „Einen Sohn besitze ich nicht, meinen Erben kenne ich nicht, — was kümmert es mich!“
Trotzdem wies er jeden Versuch seiner Cousine, ihm den zukünftigen Besitzer von Triberg zuzuführen, ebenso eigensinnig wie unfreundlich zurück.
„Der Knabe ist mir gleichgültig,“ antwortete er in seiner schroffen Weise der Mutter des jungen Maurus; „warum eine Komödie verwandtschaftlicher Zuneigung aufführen? Ich sehe in Ihrem Sohn lediglich einen Menschen, der voll Ungeduld auf meinen Tod wartet.“ —
Was war gegen solche Feindseligkeit zu machen? Baron Georg war zu erbittert und gönnte der verwitweten Cousine nicht das, was ihm selber so grausam versagt geblieben, — einen Sohn.
Glücklicherweise lag die Verwaltung des grossen Besitzes in sehr treuen und zuverlässigen Händen, so dass durchaus geregelte und günstige Verhältnisse vorgefunden wurden, als Baron Georg ziemlich unerwartet an einer Lungenentzündung starb.
Seine Cousine, die Mutter des nunmehrigen Besitzers von Triberg, war ebenfalls einem langjährigen Leiden erlegen, und Maurus stand als junger Ulanenoffizier in der Residenz und war so mit Leib und Seele Soldat, dass er noch keinerlei Lust verspürte, sich in jungen Jahren schon in der Einsamkeit des alten Schlosses zu begraben.
Er wusste die Güter ja in besten Händen, liess die Verwaltung derselben in nämlicher Weise wie bisher bestehen und traf nur zu dreitägigem Aufenthalt auf Triberg ein, um sich seinen Beamten als neuer Herr und Besitzer zu zeigen und etliche Formalitäten zu erfüllen.
Seine Tante bekam er nicht zu sehen.
Die Kranke war durch den Tod des Gatten aufs tiefste erschüttert und leidender wie je; sie durfte das Bett nicht verlassen und liess dem Neffen nur durch ihre Kammerfrau die Bitte aussprechen, „der junge Herr Baron möge doch die Pietät haben und den letzten Willen des Verstorbenen respektieren“.
Dieser letzte Wille war dem Testament in einem Briefe an Maurus beigefügt.
Der Verstorbene sprach den Wunsch aus, bei den ungeheuren Raumverhältnissen des Schlosses, seiner Gemahlin ihre jetzige Wohnung zeitlebens als Witwensitz zu belassen, da sie zu krank sei, um noch einen Wohnungswechsel ertragen zu können.
Maurus schrieb einen sehr herzlichen und ritterlicheleganten Brief an die unbekannte Tante, in dem er ihr sein wärmstes Beileid aussprach und ihr versicherte, dass er es sich zur besonderen Freude und Ehre anrechnen werde, wenn die gnädigste Tante ihren Aufenthalt auch ferner auf dem Schlosse nehmen und ganz wie in bisheriger Weise als Herrin in demselben schalten und walten würde! Er selber gedenke vorläufig noch seinem Säbel treu zu bleiben, und wenn er auch später einmal eine junge Gattin nach Triberg führen werde, so solle dadurch die Stille und Behaglichkeit der sehr verehrten Tante nicht gestört werden!
Die Kranke las den Brief unter Tränen.
Wie gern hätte sie dem Schreiber die Hand dafür gedrückt und ihn kennengelernt, — hörte sie doch von allen Seiten nur die besten und anerkennendsten Worte über den jungen Offizier, der die Verkörperung aller Liebenswürdigkeit und edler Männlichkeit sein sollte. —
Die Kammerfrau beschrieb ihn als schlanken, hochgewachsenen Herrn, mit ernsten, aber sehr sympathischen Gesichtszügen, mit blondem Haar und dunkelblauen Augen, für seine Jahre auffallend gesetzt, und von vornehmer Zurückhaltung, die jedoch nicht im mindesten steif und hochmütig wirke.
„Nun, — so Gott will, erlebe ich es noch, ihn einmal kennenzulernen, er wird doch öfters hier zu tun haben!“ — nickte Frau Alma in ihrer sehr leicht weinerlichen und wehleidigen Art, „und nicht wahr, liebe Buschmann, — solange wird mich ja der Barmherzige noch bei euch lassen?!“
„Das versteht sich, Frau Baronin, — viel länger noch! Nun wird es ja von Tag zu Tag besser!“ — ein Trost, den die alte Frau schon seit langen Jahren mit demselben ängstlichen Forschen und derselben Zuversicht glaubte.
Der neue Majoratsherr war abgereist, und es ward für die Witwe seines Vorgängers noch viel einsamer und trauriger, als wie je zuvor.
Früher hatte ihr Gatte manche Stunde lang an ihrer Chaiselongue gesessen und vorgelesen; das konnte aber weder Frau Buschmann, noch die Wirtschafterin, noch ein anderes Wesen im Schloss, und die Augen der Kranken vermochten es nicht, anhaltender Lektüre zu pflegen.
Auch die Karten-, Schach- und Damespiele hatten nun ihr Ende, und Baronin Alma weinte von Tag zu Tag trostloser in ihr Spitzentaschentuch und jammerte nach dem Verstorbenen, ohne dessen Pflege und Unterhaltung sie wirklich nicht mehr leben könne!
Frau Buschmann und der Arzt tuschelten zusammen und schüttelten bedenklich die Köpfe, und dann setzte sich der Doktor neben seine Patientin, drückte den Knopf des altmodischen Rohrstocks an das Kinn und sagte: „So geht das nicht mehr weiter, Frau Baronin. Sie brauchen Gesellschaft; irgendein junges, frisches Wesen, das Sie zerstreut und aufheitert!“
„Eine Gesellschafterin? Eine Fremde hier in das Haus?“ schrak Frau Alma empor. „O, niemals, bester Doktor, — wo denken Sie hin!“ —
Frau Buschmann trat resolut näher.
„Und warum nicht, gnädige Frau? Ehemals war es doch nur der Herr Baron, der keine unbekannten Gesichter um sich leiden mochte und behauptete, solch fremde Frauenzimmer genierten ihn! — Aber jetzt fällt doch dieser Grund fort, — uns allen wäre so ein nettes, munteres Fräulein, das Leben und Heiterkeit hier in die dunklen Zimmer trüge, sehr willkommen! Sie könnte musizieren, vorlesen, Dame spielen, — kurz alles, was zur Unterhaltung nötig ist!“ —
„Eine Fremde! Aber liebste Buschmann, — wie sollte ich alle Traditionen, — alle Wünsche und Vorurteile meines teuren Georgs so über den Haufen werfen! — Das wäre ja treulos! Das wäre doch schlecht!“ — und die alte Frau drückte abermals das Taschentuch gegen die Augen und weinte schon wieder.
Der Doktor und die Kammerfrau wechselten einen schnellen Blick des Einverständnisses.
„Nun, eine Fremde braucht es ja nicht gerade zu sein!“ sagte der Arzt im Tone freundlichen Zuredens. „Es wäre sogar noch viel besser und angenehmer, wenn irgendeine Verwandte, eine junge Nichte oder Cousine den Platz an Ihrer Seite ausfüllen könnte!“
„Eine Cousine? Ich wüsste wahrlich keine ... und eine Nichte ... ausser den Kindern meiner Schwester besitze ich überhaupt keine ... und die ...“
„Nun, die Komtesse Joriède!“ — rief Frau Buschmann eifrig, — „da hätten wir ja gleich eine!“
„Ich will’s überlegen, — bitte, drängen Sie mich nicht!“ wehrte die Kranke nervös ab, — und man wechselte das Thema.
Als der Doktor sich verabschiedet hatte, wandte die Baronin den Kopf jählings zu der treuen Dienerin.
„Sie waren vorhin beleidigt, liebe Buschmann, dass ich nichts von der Joriède wissen wollte, aber ... sehen Sie, — ich will ganz aufrichtig mit Ihnen sprechen! Wir stehen uns nicht sonderlich mit den Perpignaus! Als meine Schwester den französischen Attaché heiratete, erregte die Ehe sowohl in unserer wie in seiner Familie gerechten Unmut. Deutsch und französisch taugt nicht zusammen, ohne irgendwie fanatisch zu sein! — Es ist nun mal seit altersher ein zu scharfer Riss zwischen dort und hier, — und wenn auch zwei Ausnahmemenschen sich mal liebgewinnen, so kittet das doch die Extreme nicht zusammen! Wir boten alles auf, meine Schwester von der Heirat abzureden, und die Familie des Vicomte tat das Ihre, — es nützte nichts. — Nun, man gab nach. Der Vicomte Gournay de Perpignau war ein ebenso vornehmer wie vermögender Mann, meine Schwester, als Sprössling eines alten Adelsgeschlechtes, bildhübsch und auch sehr gut gestellt, konnte überall als Schwiegertochter nur hochwillkommen sein. — Sie heirateten also, und die Familien erzeigten sich auf der Hochzeit die formellen Höflichkeiten; nur mein Mann, der ja stets etwas absonderlich war, konnte sich durchaus nicht an den welschen Schwager gewöhnen. — Immerhin kam es zu keinem Zerwürfnis. Jahre vergingen. Ein Kind nach dem andern ward bei Perpignaus geboren, und du kennst in dieser Beziehung die Eifersucht meines armen Mannes, dessen höchstes Sehnen ein Sohn war. Acht Kinder im Hause der einen Schwester, — in dem der andern keines. Die gute Susanne, meine Schwester, war auch nicht sehr zartfühlend, sie schrieb so viele Dinge, die Georg noch mehr verdrossen, — er verbat sich ein für allemal den Besuch der Familie. Mein Schwager Raoul lebte in der grossen Welt, er hatte noble Passionen, er war durch seine Stellung verpflichtet, ein grosses Haus zu machen, — doch dies allein wäre von den vorhandenen Mitteln zu bestreiten gewesen. Mein Mann behauptete indes seit jeher, der Vicomte habe keinen guten Charakter. Er sei masslos egoistisch, rücksichtslos und falsch, — eine Konduite, über die wir andern natürlich lächelten, denn wir glaubten in der Eifersucht auf die acht Kinder die Wurzel dieses Vorurteils zu kennen. So ganz ungerechtfertigt war dasselbe jedoch nicht, das zeigte sich nach meines Schwagers Tode. Man munkelte, dass sich der Legationsrat in gewinnsüchtiger Weise Indiskretionen habe zuschulden kommen lassen, — gewisse Intrigen seien von ihm eingefädelt, und an seinen plötzlichen Tod infolge eines Schlaganfalls glaubte niemand so recht, — am wenigsten mein Mann. Die Vermögensverhältnisse stellten sich als recht zerrüttet heraus, — es blieb meiner Schwester gerade nur das Notdürftigste, um mit ihrer grossen Familie standesgemäss leben zu können. Selbstredend haben die Töchter keine Mitgift zu erwarten, und fünf unverheiratete Mädchen im Hause ist eine Sorge für meine Schwester. Nach dem Tode meines Mannes legte sie es mir schon sehr nahe, dass ich Joriède, die Älteste, zu mir nehmen und sie zu meiner Erbin machen solle, — aber ich besitze selber kein nennenswertes Vermögen mehr, habe dreimal in den ersten beiden Jahren meiner Ehe, als wir uns noch einbildeten, für Leibeserben zu sorgen, grössere Kapitalien gegeben, um diesen Schlossflügel auszubauen und neue Wirtschaftsgebäude auf dem alten Vorwerk aufführen zu lassen, dann bezahlte ich meinem Bruder Stephan die Schulden, — und schliesslich liess ich noch die recht kostspielige Beleuchtung und Zentralheizung hier einrichten, — Sie wissen ja, Buschmann, was das alles besagen will! — Also auf eine nennenswerte Erbschaft ist bei mir nicht mehr zu rechnen, und ausserdem werde ich nun und nimmermehr eines meiner Geschwisterkinder bevorzugen, am wenigsten Joriède, denn wie ich von verschiedenen Seiten hörte, soll gerade sie die meiste Ähnlichkeit mit dem Vater haben. Ich habe nun meiner Schwester auf all ihre Wünsche ablehnend schreiben müssen, und das nahm sie sicher sehr übel!“
„Haben sich denn Frau Baronin niemals ein Bild von der Komtesse schicken lassen, vielleicht hat sie doch etwas recht Ansprechendes in ihrem Äussern! Wie alt ist sie wohl?“
Frau von Doos-Thüngen wiegte einen Augenblick nachdenklich das ergraute Haupt.
„Sie muss mindestens sechs- oder gar siebenundzwanzig Jahre zählen ... sie ist die älteste der Töchter, zwei Söhne wurden vor ihr geboren. Und ansprechend?— Ach, liebe Buschmann, was lässt sich nach einer Photographie beurteilen, auf der die Augen, diese Spiegel der Seele, die uns in der Wirklichkeit soviel sagen — doch nur mehr oder minder schwarze Punkte sind!“ — Die Sprecherin unterbrach sich und wandte das bleiche, hagere Antlitz dem Diener zu, der auf der Schwelle erschien und respektvoll wartend neben der seidenrauschenden Portiere stehenblieb. „Was bringen Sie, Friedrich?“
„Die Posttasche, — zu Befehl, Frau Baronin.“
„Nehmen Sie ab, Buschmann, und reichen Sie mir den Inhalt! — Ach, diese furchtbaren, schwarzgeränderten Briefe, wie tut ihr Anblick meinem Herzen so weh!“
Und abermals zitterten Tränen, diese ständigen Gäste, in den müden Augen der alten Frau.
Frau Buschmann schüttelte den Inhalt der grossen Ledermappe auf den Tisch.
Journale, Zeitungen, die Lieferung eines Werkes, auf das der verstorbene Baron noch abonniert, ein paar Karten und Trauerbriefe.
Die Kammerfrau neigte sich jählings und blickte schärfer auf einen der Umschläge.
„Ah — soviel ich mich auf die Schrift entsinne, ist dies wieder ein Schreiben von Madame la Komtesse de Perpignau! Das würde ja zu recht gelegener Zeit eintreffen!“
„Ah? Tatsächlich von meiner Schwester? — Das freut mich, dass sie mir nicht grollt ...“
„Und wie ein Wink vom Himmel ist’s!“
„Meine Brille, Friedrich! Dort auf dem Tischchen neben der Chaiselongue! — Die Mappe kann fürerst hier liegenbleiben, der Postbote soll in der Küche gespeist werden. — Es ist gut, Friedrich, ich danke Ihnen!“
Frau Buschmann hatte das steife Kuvert mit der silbernen kleinen Schreibtischschere aufgeschnitten, legte den Brief voll eleganter Umständlichkeit auf eine Cuivreschale und präsentierte ihn der Herrin. Dann wandte sie sich bescheiden zur Tür. Ihre Gebieterin aber machte eine jähe Handbewegung: „Bleiben Sie, meine Getreue! Möglicherweise können wir unser Thema von vorhin weiter ausspinnen.“
Sie neigte sich näher zum Fenster und las. Mehrere Male nickte sie wie zustimmend vor sich hin, eine gewisse Betroffenheit malte sich in ihren Zügen, sie lächelte ein wenig und las eifrig weiter. Die Vikomtesse de Perpignau aber schrieb:
„Meine einzig geliebte Alma!
Tausend Dank für Deine soeben erhaltenen Zeilen, die mir durch ihre rückhaltlose Offenheit am besten beweisen, dass Dein Herz noch in der alten Liebe und Treue für die Schwester schlägt. Und in diesem gleichen Gefühl herzlichen und ehrlichen Vertrauens will ich Dir antworten und Dir auch die geheimsten Gedanken meiner Seele kundtun. Du weisst, wie die Verhältnisse bei uns liegen. Glänzender Titel — wenig Mittel — viele Kinder, die versorgt werden müssen. Die beiden ältesten Söhne kosten als Offiziere in guten Regimentern sehr viel, Charles und Dodo sollen studieren, — die Kleine hat wenigstens Passion und sehr viel geistige Fähigkeiten — je nun — und heutzutage gehört es ja zum guten Ton, auch Mädchen zu Doktoren zu machen. Was aber soll mit den andern Töchtern werden? Kein nennenswertes Talent, keine glänzende Begabung — die jüngsten sind wenigstens hübsch, während das bei Joriède Geschmackssache ist. Man findet sie interessant — pikant — und sie hat auch genug Anbeter, aber keinen darunter, der eine Frau ohne Mitgift heiraten kann. Arme Joriède! Sie wird nun siebenundzwanzig Jahre, und Du wirst es mir als Mutter nachfühlen, dass es meine grösste Sorge ist, ihre Zukunft gesichert zu wissen. Dass Du, meine teure Alma, ehemals Dein Vermögen in das Gut stecktest, ist ja nur begreiflich, da Ihr den Besitz auf der Höhe erhalten wolltet — in dem Gedanken an einen Sohn. — Gott hatte es anders beschlossen. Ach wie gern hätte ich Dir einen von meinen Prachtjungens abgegeben. Immerhin ist es doch sehr zu beklagen, dass Dein Vermögen — Lassowsches Geld, nicht unserer Familie, sondern derjenigen Deines Gatten zugute kommt. Für einen Dir wildfremden jungen Mann hast Du Dein Hab und Gut hingegeben, während Dein eigen Fleisch und Blut, Deine Neffen und Nichten darben müssen. Ich kann mir nicht denken, dass dies Gottes Willen. Eine gewisse Gerechtigkeit, ein Ausgleich macht sich doch in allen Menschenschicksalen bemerkbar, und wo er nicht von selber eintritt, sind wir wohl berechtigt, ihm durch ein wenig Intelligenz und Klugheit zu Hilfe zu kommen! —
Ahnst Du, liebste Alma, welche Gedanken mein Hirn durchkreuzen? — Findest Du nicht selber, dass es der beste Weg wäre, Dein Geld wieder Deiner eigenen Familie zuzuführen, wenn Dein Neffe Maurus, der jetzige Majoratsherr, unsere Joriède heiratete? Ich finde, dieser Gedanke ist zu schön, um nur ein Traum zu sein! Und wie leicht liesse sich das wohl arrangieren! Wenn Du unter dem Vorwand, ein junges Wesen zur Zerstreuung und Erheiterung um Dich zu haben, Joriède nach Triberg kommen liessest? Fraglos wird Maurus im Herbst zu den Jagden auch nach dort kommen, — wenn nicht, kannst Du ihn ja so gut einladen, ‚weil es Dich so lebhaft interessiert, ihn näher kennenzulernen!‘ — Auch hat er doch wohl öfters geschäftliche Angelegenheiten auf dem Gute abzuwickeln. Wenn sich zwei junge Menschen in der Einsamkeit täglich sehen und miteinander verkehren, so führt sie das besser und sicherer zusammen, wie sechs Wintersaisons mit allen Bällen und all der Konkurrenz, die eine Dame der andern macht. — Du kannst auch Dein Teil dazu tun, liebste Alma, kannst Maurus den Gedanken etwas nahelegen, indem Du ihm in zarter Weise andeutest, dass Jorièdes Erbteil in dem Besitze stecke! — Joriède ist ganz Persönlichkeit, einen Mann zu fesseln, sie wird sich fraglos sehr geschickt benehmen, denn — du liebe Zeit, dem armen Wurm sitzt nun das Messer an der Kehle, und Besitzerin von Triberg zu werden ist keine Bagatelle. Auch hörten wir, dass Dein Neffe ein sehr hübscher, vornehmer, ernst denkender und solider Mann sein soll; auf ihn wird die moralische Verpflichtung gegen Joriède mehr Eindruck machen, wie auf einen leichtlebigen Sausewind!
Also Herzens-Alma! Hilf uns! Sieh, ich habe Dir mein ganzes Herz rückhaltlos bis in das innerste Fältchen aufgedeckt! Ach, Du kennst nicht die Angst und Sorge einer Mutter um ihr Kind, — sie entschuldigt alles, selbst dieses Heiratsprojekt, das Dir vielleicht recht frivol und unweiblich vorkommt! Nicht wahr, meine inniggeliebte Alma, Du versagst dem armen Mädchen Deine Hilfe nicht? Vorläufig weiss Joriède noch nichts von diesem Plan, sie ist nur erfüllt von dem Gedanken, zu Dir eilen zu dürfen, Dich zu hegen, zu pflegen, zu zerstreuen und zu amüsieren! Leider ist sie nicht sehr musikalisch, aber ein paar einfache kleine Lieder singt sie! — Und ein goldenes Herz hat das Kind! — Sie opfert sich auf in der Sorge für mich und ihre Geschwister, gewöhnt zu dienen und zu helfen, — o, sie würde Dich auf Händen tragen und Dein guter Engel sein! Anspruchslos und bescheiden ist sie, — gewillt, sich überall nützlich zu machen! In vielen Dingen freilich auch noch ein wenig unerfahren! Ich habe die Kinder stets durch viel Liebe und Güte verwöhnt, ich hatte ja nichts anderes mehr auf der Welt als wie sie! — Das fühlt mir Dein armes, wehes Herz wohl am besten nach, meine Alma! Du hast ja soeben auch Dein Liebstes und Einzigstes begraben, Du weisst, wie der Witwenschleier jedes Sonnenlicht verfinstert, wie furchtbar es ist, zurückbleiben zu müssen, wenn die kalte Erde alles verschlingt, was uns das Leben noch teuer und wert machte! O, diese Vereinsamung! Sie ist das furchtbarste Schicksal! Und bedenke, wie einsam, wie todesverlassen meine unglückliche Joriède ihr Leben lang sein wird, wenn ich einmal von ihr gerufen werde, — wenn Du jetzt nicht erbarmend Deine Hände nach ihr ausstreckst — —“
Die Leserin liess den Brief leise aufschluchzend niedersinken. So geteilt ihre Gefühle auch anfänglich bei der seltsamen Lektüre gewesen waren, so sehr gewann jetzt die Rührung die Oberhand, und namentlich die letzten Zeilen, die so sehr auf die Tränendrüsen wirkten, verfehlten ihre Wirkung nicht.
Baronin Doos von Thüngen war eine von Herzen gutmütige und nicht allzu scharfgeistige Frau, und da sie auch nie Gelegenheit im Leben gehabt, viel Energie zu betätigen, so war sie leicht zu beeinflussen.
Die Aufrichtigkeit ihrer Schwester tat ihr wohl, wenngleich sie anfänglich ihren Plan nicht sonderlich billigte, und wenn sie es bedachte, so recht nachdrücklich überlegte — ja, dann hatte die Vikomtesse wirklich recht! Es war eine Ungerechtigkeit, dass sie ihr Geld den eigenen Angehörigen entzog, um es einem Fremden zu geben. Und schliesslich — war Joriède Vikomtesse Gournay de Perpignau nicht eine vortreffliche Partie für Maurus? Bei ihm kam es doch wahrlich nur auf die Titel und nicht auf die Mittel an! — Ist es ausserdem nicht ein erfreulicher Gedanke für sie, dereinst die eigene Nichte und nicht eine fremde, gleichgültige, unsympathische Dame als Herrin und Nachfolgerin im Besitz von Triberg zu sehen? Wahrlich, der Plan der Schwester war so übel nicht. Wenn sich die Herzen der jungen Leute in Liebe finden, wird Baronin Doos die herzlichste Freude darüber empfinden!
Sie trocknete die überströmenden Augen, seufzte ein paarmal tief auf und blickte dann ganz erschrocken auf Frau Buschmann, — sie hatte die Anwesenheit der Getreuen ganz vergessen. „Ah — Sie warten noch auf Antwort, liebe Buschmann!“ lächelte sie und strich mit der nervös zitternden Hand über den Brief: „Ja, es bleibt nichts anderes übrig! Lassen Sie zwei Zimmer für die Komtesse herrichten, sie wird für längere Zeit zu uns kommen!“
„O, welch eine Freude! Das wird ein neues, frohes Leben geben!“ knickste die Kammerfrau freudestrahlend und küsste die Hand ihrer kranken Gebieterin.