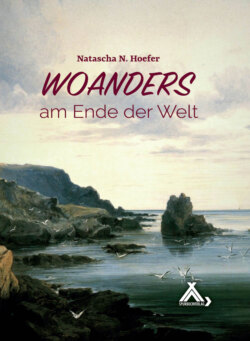Читать книгу Woanders am Ende der Welt - Natascha N. Hoefer - Страница 10
Оглавление4. Erste Eindrücke
Staub tanzte in dem Lichtstrahl, der durch die Dachluke eindrang. Staub bedeckte den Nachttisch neben dem Bett. Staub überzog wie Puderzucker den Schirm der Lampe, die auf dem Nachttisch stand, und Staub lag als sichtbare Schicht auf dem Dielenboden. Florians Blick blieb an dem schweren Schrank aus dunklem Holz hängen, der die karge Einrichtung vervollständigte. Der war nicht nur mit Staubflocken bedeckt. Die Fäden eines immensen Spinnennetzes spannten sich von seinen oberen Kanten zur Zimmerwand. Die war aus Feldstein und nur bis auf Mannshöhe verputzt. Weitere Spinnweben zierten die alten Dachbalken und den Rahmen der Dachluke. Die Spinnen selbst bevölkerten gut sichtbar ihre Behausungen.
Danke, Boris, dachte Florian. Und in diesem Moment freute er sich auf das Gesicht seines Kompagnons, wenn der das belgische und die – wie viele waren es? – drei? –, also die drei französischen Strafmandate erhalten würde …
In der letzten Nacht hatte Florian nur noch Strom und Wasser in Betrieb gesetzt und herausgefunden, wo eine Toilette war (Erdgeschoss neben Treppenaufgang; historisches Toilettenbecken mit Kette) sowie das nächstliegende Waschbecken (keines im Toilettenraum, dafür in der Küche). Nun stieg er aus dem Bett, stakste auf den Fußballen über den schmutzigen Boden. Vielleicht hatte er nicht genug geschlafen, ihm fröstelte es; im Schrank mit den Spinnweben fand er einen nur leicht versifft aussehenden Bademantel, den er überzog, und ein paar Schlappen.
Er verließ das Schlafzimmer und erkundete die Räume des Hauses bei Tageslicht. Oben, dem Schlafzimmer gegenüber, fand er eine Rumpelkammer und ein Bad mit Warmwasserboiler und einer Badewanne unter der Dachschräge, mit Wasserhahn und Duschschlauch. Sollte man da etwa im Liegen duschen? Unten befanden sich, abgesehen von der famosen Toilette, die Küche und der Hauptraum des Hauses, der dominiert wurde durch einen langen Esstisch aus massiver Eiche. Dieser Tisch war das erste Möbelstück, das Florian in Boris’ Haus gefiel. Die kleine Wohnecke am allerdings imposanten Kamin hingegen – nun ja; sie bestand aus einer verblasstroten Sitzgarnitur, einer niedrigen Truhe mit einem dickleibigen Fernsehgerät darauf und einem Rattanregal mit ein paar Büchern. Florian zog eines heraus und blies die Staubflocken fort. Ein Bretagne-Reiseführer, auf Deutsch. Immerhin.
Die Küche war ebenso staubig, von Spinnen bewohnt und museumsreif eingerichtet wie der Rest des Hauses. In einem Hängeschrank, dessen Tür ihm beinah ins Gesicht schlug (eine Halterung fehlte) fand Florian wider Erwarten ein paar Lebensmittel: eine Packung Spaghetti, eine Dose Kekse und ein Glas Kaffeepulver; doch das Pulver roch seltsam, und die Kaffeemaschine sah auch nicht vertrauenserweckend aus. So saß Florian am Ende an dem kleinen Tisch mit der Resopalplatte, eine bretonische Trinkschale mit seinem deutschen Schnellkaffee vor sich, den er zubereitet hatte mit Hilfe seines Gießener Wasserkochers. Hoffentlich vermisste Katharina den – hoffentlich vermisste Katharina ihn, ging es Florian durch den Kopf, und er fühlte sich wie zerschmettert.
Aus Frust aß er die halbe Dreihundert-Gramm-Dose der gefundenen Kekse auf, »Galettes bretonnes, pur beurre«. Sie schmeckten erstaunlich lecker. Und dann kam ihm eine Idee, was er tun konnte, um zumindest vorübergehend das Gefühl der Vereinsamung und Trostlosigkeit beiseitezuschieben, das Besitz von ihm ergriffen hatte, und etwas Sinnvolles zu tun. Er holte das Tagebuch seiner Oma und die Tabelle zum Dechiffrieren der alten Schrift.
Im Wohnzimmer setzte er sich an den großen Tisch. Behutsam, neugierig und furchtsam zugleich schlug er das alte Buch auf und begann, angestrengt zu entziffern: »15. August 1942. Die Marineschule war große Klasse. Jetzt geht es in den Krieg, ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen soll.« Die weißen Kreuze, Colleville-sur-Mer, der Soldatenfriedhof. Freude auf den Krieg?! Stockend entzifferte er weiter, fand mühsam in die ungewohnten Schwünge, Bögen und Haken der Offenbacher Schrift hinein, vergaß die Zeit und die Umgebung um sich und allmählich wurde aus dem Entziffern ein langsames Lesen und die Geschichte seiner Oma vor Florians innerem Auge lebendig …
Mit einem lauten Schnaufen kommt die Dampflok vor ihnen zum Stehen. Hektische Betriebsamkeit herrscht um sie herum auf dem Bahnhof von Stralsund. Auf dem Bahnsteig sind sie angetreten, die sechzig Funkhelferinnen, darunter Marlene.
Marlene ist stolz und etwas aufgeregt. Fertig dazu ausgebildet, den Funkverkehr mit der U-Bootwaffe zu führen und feindlichen Funkverkehr aufzuzeichnen, wartet sie mit ihren Kameradinnen auf den ersten, echten Einsatz! Ihre Aufgabe ist verantwortungsvoll, hat man ihr und den anderen eingebläut. Die U-Boote müssen die Feinde von der europäischen Küste fernhalten und die Konvois des Nachschubs für das Reich sichern. Ja, der Krieg – jetzt wird es ernst damit. Nicht nur für die Blitzmädchen, wie die Landser die jungen Funkhelferinnen nennen. Neben ihnen stehen hundertzwanzig frisch gebackene Unteroffiziere der Marine am Gleis. Die Stimmung ist angespannt, aber freudig. Alle wissen, der Krieg ist in die entscheidende Phase getreten. Seitdem die deutschen Truppen an der Atlantikküste stehen, ist er so gut wie gewonnen! Fahren sie bis dorthin, bis an den Atlantik?
Der Waggon, der die Funkhelferinnen zu ihrem Einsatzort bringen soll, ist ein betagter Passagierwaggon, mit Plattformen an beiden Enden. Die Fenster sind mit dunklem Papier verklebt. Marlene trägt einen großen Koffer, ihre Kameradin und alte Freundin Gisela einen Seesack über der Schulter.
»Ich wollte, ich hätte auch so einen Seesack«, seufzt Marlene.
»Wenn du willst, tauschen wir, ich hätte lieber einen Koffer«, lacht
Gisela und rempelt Marlene absichtlich leicht an.
»He«, protestiert die und beeilt sich, hinter Gisela das Abteil zu betreten.
Die Abteile sind einzeln, für jeweils sechs Personen. Jedes hat eine eigene Tür zum Bahnsteig. Durch den Waggon gehen, wie es in den modernen Zügen der Reichsbahn möglich ist, geht hier nicht.
Im Abteil, das sie mit Traute (ausgerechnet!) und drei weiteren Kameradinnen teilen, zieht Gisela sofort ihr Federmesser aus der Tasche und schneidet ein Loch in das Tintenpapier, das auf die Fenster geklebt ist.
»Was machst du, das ist verboten«, protestiert Traute, die so gerne ein Spielverderber ist.
»Du brauchst ja nicht rausgucken«, versetzt Gisela und grinst.
»Hört auf zu streiten«, mahnt Marlene und lässt sich gegenüber
Gisela auf den Fensterplatz fallen.
In der Abteiltür erscheint Leutnant zur See Rosen. »Nun, die Damen, alles zu Ihrer Zufriedenheit?«, fragt er, und als sie ihm das versichert haben, wirft Rosen mit Schwung die Abteiltür zu.
»Haben wir ein Glück, dass der mitfährt«, seufzt Gisela und lockert sich die Schulter, über der sie den Seesack getragen hat. Rosen ist ein schneidiger Bursche, blond, aber mit dunklen Augen; die Funkhelferinnen schwärmen für ihn.
Um neun Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Im Zentrum des Reichs ist vom Krieg nicht viel zu spüren. Alles ruhig draußen, der Zug nimmt rasch Fahrt auf und gut zwei Stunden später stehen die Waggons auf dem Anhalterbahnhof in Berlin.
»Berlin!«, ruft Marlene sehnsüchtig aus und schaut zu Gisela.
»Wir werden nicht aussteigen dürfen«, gibt die bedauernd zurück. In diesem Moment wird die Abteiltür aufgerissen. »Sie dürfen sich jetzt am Bahnhof die Beine vertreten, der Zug zu Ihren Einsatzorten wird im Laufe des Tages zusammengestellt und dann soll es morgen früh weitergehen«, verkündet Rosen mit strahlendem Lächeln.
»Wo schlafen wir denn?«, will Gisela wissen.
»Ihr Waggon ist ein Schlafwagen, die Sitze werden zu Liegen gemacht und dann können Sie darauf schlafen«, erklärt Rosen.
Marlene und ihre Kameradinnen gehen in der großen Bahnhofshalle spazieren. Es herrscht reger Betrieb, viel Feldgrau ist zu sehen. Soldaten, die auf Heimaturlaub sind; Soldaten mit Marschbefehlen in das ganze Reich, aber auch ein paar Zivilisten, vorwiegend Frauen, eilen zu ihren Zügen. Die vielen Uniformen und die Plakate mit Aufschriften wie »Feind hört mit«, »Gib, was du kannst, für das Winterhilfswerk« sind aber das einzige, was daran erinnert, dass Krieg herrscht.
Den Nachmittag verbringen die Funkhelferinnen aus Marlenes Abteil mit Spielen. Verpflegung kommt aus der Gulaschkanone. Am Abend richten die jungen Frauen bald ihre Betten und gehen schlafen.
Was ist das? Von draußen hört Marlene das Getrappel vieler Stiefel. Das hat sie geweckt. »Gisela, bist du wach?«, fragt sie ins Dunkel. Jetzt sind Flugzeuge zu hören – Explosionen!
»Wir müssen raus«, ruft jemand; dann gibt es viel Gedränge im Abteil, bis sie sich auf den Bahnsteig schieben. Dort hallen Kommandorufe wider, Rosen eilt auf sie zu. »Es gibt nicht genug Schutzräume«, ruft er ihnen aufgeregt entgegen. »Der Feind kommt aus dem Westen. Die Bolschewiken haben keine Flugzeuge mit solcher Reichweite!«
Die Flieger scheinen gleich über dem Bahnhof zu sein, wie nah und laut die Explosionen über ihnen! Aber dann – nein, Marlene irrt sich nicht – entfernen sich die feindlichen Flieger. Ist die Gefahr vorbei? Wirklich? Doch nach Minuten scheint es wirklich so. Die Frauen sehen sich an, wollen wieder in ihr Abteil gehen.
Gisela drückt Marlene flüchtig die Hand.
»Meinst du, unser Viertel …«, beginnt Marlene besorgt …
Florian hielt inne. Was sollte das heißen, unser Viertel? Die Funkhelferinnen waren in Berlin – seine Oma stammte aus Wetzlar! Ein flaues Gefühl beschlich ihn. Er hatte nicht einmal geahnt, dass seine Oma im Krieg Funkhelferin gewesen war, und jetzt wollte das Tagebuch ihn mit einer weiteren überraschenden Information konfrontieren? Er kannte doch seine Oma – meinte doch, sie zu kennen! Mit neuer Anspannung las er weiter.
»Meinst du, über unserem Viertel …«, beginnt Marlene besorgt, aber bevor Gisela antworten kann, ruft Rosen von hinten: »Wir warten noch! Vielleicht kommt noch eine Angriffswelle.«
Müde und verstört warten Marlene und ihre Kameradinnen eine ganze Zeit lang, bis Rosen endlich Entwarnung gibt.
»Der wollte sich doch nur wichtigmachen«, schimpft Gisela, endlich im Abteil.
Marlene liegt noch lange wach. Sie ist im Krieg. Sie hat den Bombenangriff unversehrt überstanden. Und ihre Familie? Neuigkeiten von daheim werden sie erst erreichen, wenn sie an ihrem Einsatzort ist und den Eltern geschrieben hat, wo sie sich befindet.
Der Zug fährt durch eine wunderschöne Landschaft. Auch die brave Traute nutzt inzwischen jede Gelegenheit, durch die verbotenen Löcher zu schauen, die Gisela in die Papierverdunklung geschnitten hat. Zweiundzwanzig Personenwaggons und dazu mehrere Tieflader mit militärischem Gerät ziehen die beiden Dampflokomotiven durch das fremde Land. Auf dem ersten und dem letzten Tieflader sind Flugabwehrgeschütze aufgebaut. Doch bislang mussten sie noch nicht eingesetzt werden.
Sie sind in Frankreich, in der Normandie. Doch hier werden sie nicht bleiben. Rosen hat von den neuen U-Boothäfen am Atlantik gesprochen. Sie fahren also in die Bretagne, noch viel weiter in den Westen! Von dort werde der Krieg entschieden, hat der Leutnant feurig gesagt.
Von Berlin war der Zug zunächst einen Tag und eine Nacht Richtung Frankreich gefahren. Die vielen Stopps hatten auf die Stimmung gedrückt. Am achtzehnten August hatte der Zug dann im Bahnhof Metz gestanden – die Strecke nach Paris war gerade zerstört gewesen. Gestern Abend haben sie endlich Dieppe erreicht. Auch hier sind Geleise zerstört; aber die Eisenbahnpioniere arbeiten hart an der Reparatur, so Rosen. Nun steht der Zug also bei Dieppe auf einem Abstellgleis. Verlassen darf niemand die Waggons, trotz der brütenden Hitze. Erst abends erlaubt Rosen, zumindest für eine Weile die Türen zu öffnen.
Vier Tage in dem Abteil haben dazu geführt, dass die jungen Frauen noch vertrauter miteinander sind, als sie es in der Marineschule schon waren. Das hilft, die Strapazen der Reise zu überstehen. Es ist gut, solche Kameradinnen um sich zu haben.
Marlene schreckt hoch. Es muss mitten in der Nacht sein, sie hat tief geschlafen. Doch plötzlich, heftiges Maschinengewehrfeuer, Explosionen! Gisela und sie spähen angestrengt durch ihre Gucklöcher. Überall Feuergefechte und feindliche Soldaten! Im Licht der Flakscheinwerfer sieht Marlene Fallschirmspringer zu Boden schweben. Manche werden noch in der Luft von den Maschinengewehrsalven getötet. Traute hat sich auf ihrer Liege zusammengekrümmt und weint leise vor sich hin.
Zwei Stunden dauert der Spuk, dann wird es am Bahnhof endlich ruhig. Heftige Gefechte sind nur noch aus der Ferne zu hören. Rosen öffnet die Abteiltür. »Es ist vorbei, meine Damen«, verkündet er heftig.
Die Frauen steigen unsicher aus dem Waggon. Rosen hat einen Karabiner, den er ständig im Anschlag behält. Sie sind noch keine fünf Schritte gegangen, da löst sich aus dem Dunkel die Silhouette eines Mannes, eines Mannes mit erhobenen Armen. »I surrender«, ruft er laut und tritt ihnen entgegen.
Rosen reißt den Karabiner hoch und schießt. Der Mann fällt auf sein Gesicht.
»Aber – aber er hat sich doch ergeben!« Marlene kann nicht fassen, was sie angesehen hat.
Rosen fährt zu ihr herum. Marlene schreckt vor dem harten Glanz seiner Augen zurück.
»Das war ein Trick, der Feind ist heimtückisch«, sagt Rosen, mühsam beherrscht. Dann spielt ein merkwürdiges kleines Lächeln um seine Lippen, als er hinzusetzt: »Sie müssen noch viel lernen, Fräulein Probst …«
Marlene sieht weg.
Sie und ihre Kameradinnen gehorchen wortlos, als der Leutnant sie zurück in den Waggon drängt.
Schweigend sitzen sie in ihrem Abteil.
»So ein Schwein«, sagt Gisela in die Stille.
Marlene geht Rosens kalter Blick nicht aus dem Kopf, sein merkwürdiges Lächeln, seine herablassende, gönnerhafte Belehrung. Und diesen Mann hatte sie attraktiv gefunden? Eine Gänsehaut überkommt sie. Und: Oh nein, es gibt Dinge, die ich nicht lernen will und niemals lernen werde, rebelliert sie innerlich!
Der Gefechtslärm ist jetzt weit weg. Die Frauen legen sich wieder auf ihre Liegen. Doch an Schlafen ist nicht zu denken. Sie warten. Horchen in die Nacht und warten.
Irgendwann, Marlene weiß nicht, wie lange sie so lagen, reißt Rosen die Tür auf. Draußen ist es dämmrig, ein neuer Tag beginnt.
»Alles wieder ruhig«, versichert Rosen. Ein Versuch der feindlichen Armee, am Strand von Dieppe zu landen, sei erfolgreich abgewehrt worden.
Keine der Frauen lächelt den attraktiven Marinesoldaten an. Nicht nur Marlene ist Rosen nach dem Schuss auf den unbewaffneten Soldaten unheimlich geworden.
»Die Eisenbahnpioniere sorgen dafür, dass es weitergeht, meine Damen«, sagt Rosen aufmunternd und lässt sie unter sich.
Schon bald ruckt der Waggon an, die Fahrt geht weiter. Marlene und Gisela schauen wieder durch ihr Guckloch am Fenster; doch die Landschaft kommt ihnen nicht mehr so schön vor wie am Tag zuvor.
21. August 1942. Der Zug steht im Bahnhof von Brest. Requirierte Lastwagen stehen zur Weiterfahrt bereit. Marlene hat in den sechs Tagen im Eisenbahnabteil den Vorteil eines Koffers zu schätzen gelernt. Gisela muss mehrmals am Tag ihren Seesack komplett auslehren, weil das, was sie sucht, wieder ganz nach unten gewandert ist. Marlene hat in ihrem Koffer ihre penible Ordnung problemlos wahren können.
Die Frauen besteigen die Ladefläche eines Renault-Lastwagens. Marlene setzt sich auf ihren Koffer. Die LKW-Plane ist an den Seiten aufgerollt. Der Fahrer ist ein grobschlächtiger Matrose, der sich als Robert vorstellt. »Auf geht’s in die Sommerfrische«, ruft er. Rosen setzt sich auf den Beifahrersitz und die Fahrt geht los.
Es ist merkwürdig still um sie herum, merkwürdig friedlich. Die Geschehnisse der Reise scheinen wie weggewischt, dieser Aufbruch hat wirklich etwas von einer Fahrt in die Sommerfrische. Marlene kann sich an der neuen Umgebung nicht satt sehen. Wie gut tut es, die Meeresluft einzuatmen, nach der stickigen Luft des Zugabteils! Sie staunt, als sie die Granitfelsen sieht, schwarz und zerklüftet, denn sie fahren auf einer Küstenstraße oberhalb des fremden Meeres entlang. Das also ist der Atlantik!
Die Lastwagen fahren im Konvoi in Richtung einer Halbinsel namens Crozon. Marlene freut sich fast wie ein Kind, als die Lastwagen nach einigen Kilometern auf eine Fähre auffahren. Eine Schifffahrt! Danach geht es wieder auf einer Küstenstraße weiter. Plougastel, liest Marlene auf einem Ortsschild. Sie weiß nicht, wie der fremde Name ausgesprochen wird. Loperhet, Daoulas; nach Le Faou ist die Landstraße bald von dichtem Wald umgeben und wird kurvig und eng. Plötzlich fährt der Konvoi aus dem Wald heraus auf eine lange Hängebrücke. Der Fluss tief unter ihnen glitzert in der Sonne.
»Was ist das für ein Fluss?«, fragt Marlene laut.
Gisela beugt sich seitlich über die Ladefläche des Lastwagens. »Robert, was ist das für ein Fluss?«, ruft sie.
»Aulne, der fließt in die Bucht von Brest. Das ist die Bucht, an der wir entlangfahren«, dröhnt Robert zurück.
Hat er »Olln« gesagt? Oll findet Marlene den Fluss unter ihr gar nicht. Sie muss lachen.
»Voilà, die Halbinsel Crozon«, verkündet Robert laut, als sie auf der anderen Seite der Brücke angekommen sind.
Marlene ist nicht die einzige, die von der Fahrt durch die fremde Landschaft regelrecht berauscht ist. Die Sonne brennt; links erhebt sich jetzt ein rundlicher Berg, laut Robert der Ménez-Hom, Möwen schreien über ihnen, obwohl sie inzwischen auf dem Festland der Halbinsel sind und sich von der Küste weiter entfernen. Nach einiger Zeit nähert sich der Konvoi einem Ort, sie sehen Häuser und darüber einen spitzen Kirchturm.
»Telgruc, Ihr Kurort, meine Damen«, ruft Robert, als er am Rande des Dorfes anhält.
»Absitzen«, befiehlt Rosen.
Zwei Baracken an der Straße. Es riecht nach frischem Holz und Teer. Ein paar junge Männer in Zivil, sehr einfach, fast armselig gekleidet, stehen vor dem Eingang der rechten Baracke. Es müssen Einheimische sein, Kriegsgefangene.
»Allez, Allez!«, ruft Rosen.
Die Kriegsgefangenen kommen zögernd näher. Marlene sieht, dass einer klobige Holzschuhe an den Füßen trägt.
»Vite, vite«, schnauzt Rosen die fremdartigen Gestalten an.
Diese ergreifen die Gepäckstücke der Frauen. Marlene hält zögernd ihren Koffer fest, als einer, mehr Junge als Mann, auf sie zukommt.
»S’il vous plaît, Mademoiselle«, sagt der Junge, seine Stimme klingt sanft.
Marlene schaut ihm in die schwarzen Augen und lässt unwillkürlich den Koffer los.
»Vite«, brüllt Rosen und stößt dem Jungen den Kolben seines Karabiners in den Rücken.
Erschrocken und empört sieht Marlene Rosen in das Gesicht und in seine kalt glänzenden Augen. Der Leutnant zieht die Mundwinkel spöttisch nach unten und wendet sich ab. Schnell schaut Marlene zurück zu dem jungen Mann mit ihrem Koffer. Der hat sich einige Schritte von ihr entfernt, dreht sich plötzlich zu ihr zurück – und zwinkert ihr zu.
Florian zuckte zusammen. Jemand klopfte vehement an die Haustür. Der Verwalter? Und er war noch im Bademantel! Egal, er sprang auf.
Der Mistkerl war groß, Marie musste zu ihm hochschauen, aber ansonsten war er eine jämmerliche Erscheinung: unrasiert, ungekämmt, blaue Ringe unter müden Augen, die ganze Gestalt in einen vertrieften Bademantel gehüllt. Dass der Jammerlappen sie seinerseits vom Kopf bis zu den Füßen taxierte, machte Marie nur noch wütender! Na und? Dann trug sie eben ihren ausgelutschten Pyjama und die alten charantaises an den Füßen! »Was fällt Ihnen ein, meine Blumen zu töten?«, barst es aus ihr heraus.
Die erschrockenen Augen des Typs weiteten sich. Auch das noch, der konnte nicht einmal Französisch! Marie kramte aus den Kammern ihres Gedächtnisses nach passenden deutschen Worten. »Sie haben getötet meine hortensias!«, fuhr sie den Dreckskerl an und zeigte hinter sich, Richtung Tatort.
Der Deutsche reckte sich, um über sie hinwegzuspähen, behauptete aber: »Ich verstehe nicht.«
Aber dass der sich dumm stellte, kam gar nicht in Frage! Entschlossen packte Marie den Mann am Ärmel und zog ihn hinter sich her, quer über den Hof bis zu ihrer Hausecke mit dem Desaster. »Voilà«, stieß sie traurig triumphierend hervor. Doch der Typ gab sich aalglatt und zuckte die Achseln, als würde ihn das alles nichts angehen! So nicht, dachte Marie und packte ihn erneut am Ärmel, um ihn zu seiner Protzkarosse zu ziehen, auf deren Kotflügel die abgerissenen Blüten für sich sprachen. Und endlich zeigte der Hortensienmörder ein Lebenszeichen: »Oh nein!«, rief er aus, »das war es also! Oh nee, Scheiße …« Und er streichelte dem Kotflügel die Blüten herunter – um nach Kratzern im Lack zu suchen!
Das war Marie zu viel. »Heho, das dicke Auto lebt, aber nicht meine hortensias«, brüllte sie, im vollen Bewusstsein dessen, dass sie eben die Kontrolle verlor.
Der Deutsche richtete sich auf und sah plötzlich gar nicht mehr hilflos aus wie ein Kaninchen. »Jetzt schreien Sie nicht so«, schrie er zurück, »das ist gestern Nacht passiert, es war dunkel ohne Straßenlaternen, ich habe das nicht gesehen!«
»Nicht gesehen? Und das? Mein Haus? Sie haben es auch nicht gesehen, vielleicht? Sie sind fast gefahren in mein Haus! Fast in mein Haus gefahren«, korrigierte Marie ihre Wortstellung und spie noch aus: »Eh, merde!«
»Das stimmt, ja, oh Mann, das war knapp … Wenn dem Cayenne was passiert wäre …«
»Ho, la pauvre Cayenne, das arme, arme Auto!«, Marie äffte übetrieben einen mitleidigen Tonfall nach, dann fixierte sie den Saukerl gnadenlos und brüllte: »Und meine hortensias?« Sie ballte die Fäuste und stampfte auf.
Der Fremde hob abwehrend die Hände. »Das ist eben blöd gelaufen, das kann schon mal passieren, auf so einem engen Feldweg …«
»Das ist kein enger Feldweg, das ist die alte Straße! Und sie ist nicht eng für normale Autos; nur für Panzer!« Marie schnappte nach Luft. Ha, sie war stolz darauf, sich an dieses Wort zu erinnern: Panzer, das hatte sie von Paul gelernt, dessen Brüder in der Résistance gekämpft hatten, gegen feindliche Panzerfahrer wie diesen!
»Was reden Sie da von Panzern?«, fragte der Fremde halb erschrocken, halb irritiert. »Wir sind nicht mehr im Krieg, seit 1945! Aber es tut mir aufrichtig leid, dass ich Ihre Hortensien angefahren habe, und ich werde Ihnen den Schaden bezahlen.«
Marie presste die Lippen zusammen, ehe sie verkündete: »Ich weiß nicht, wie das ist in Ihrem Land, aber hier in der Bretagne denken die Menschen nicht, alles ist mit Geld zu bezahlen!« Sie wandte sich ab. Dass ihr die Tränen gekommen waren, durfte der bescheuerte Deutsche nicht sehen. Ihre geliebten Hortensien! Wenn der wüsste, was sie ihr bedeuteten … Aber so einem wie dem da war das doch egal!
»Ist ja dramatisch«, ließ der Deutsche jetzt fallen, »aber Ihre Hortensien wachsen wirklich ganz schön in den Fahrweg hinein…«
»Sie wollen sagen, ich bin schuld?« Marie fuhr noch einmal herum. Das war nun wirklich … Sie rang nach Luft, dann stieß sie aus: »Meine Hortensien haben das Recht, in diesem Land, das ist ein freies Land, in Freiheit zu wachsen – en liberté, c’est clair? Wenn Sie noch einmal eine Blüte mit ihrem Panzer berühren, dann …« Sie blitzte ihn drohend an und ließ ihn stehen. »Grand niais germanique«, fauchte sie noch vor sich hin (großer germanischer Trottel) und wischte sich wütend die Tränen fort, egal, ob er das sehen würde oder nicht.
Da hatte Olivier wohl Recht, mit seiner Warnung vor bretonischen Zicken, sagte Florian sich bitter. So ein Konflikt hatte ihm gerade noch gefehlt. Aber hatte sie geweint, als sie gegangen war? – Unmöglich. Und wenn, dann bloß aus lauter Wut. Gift und Galle war sie gewesen, eine Furie!
Er brauchte jetzt eine Dusche. Ob die Badewanne dreckverkrustet war oder nicht, war ihm egal, er musste jetzt duschen!
Während er in zusammengekauerter Körperhaltung unter der Dachschräge hockte und das ganze Bad vollzuspritzte (musste ja ohnehin geputzt werden), ging Florian wider Willen die Nachbarin nicht aus dem Kopf. Was hatte die gehabt, das war doch eine totale Überreaktion von ihr gewesen? Aber natürlich war es blöd, dass das mit den Hortensien passiert war. Nur mal ehrlich, was sollte er tun, wenn sie nicht zumindest seine materielle Entschädigung annehmen wollte? Und sie hätte ihn wirklich nicht derart anschreien müssen!
Der Verwalter kam nicht, und Florian bekam Hunger. Die Mittagszeit war längst rum, und er musste irgendwoher etwas zu essen beschaffen. Außerdem machte es ihn halb wahnsinnig, dieses Warten. Er würde jetzt einen Rundgang durch Mengleuff machen.
Er verließ das Haus und folgte dem Feldweg (oder der alten Straße, wie die Furie den sagenhaften Weg also nannte), in entgegengesetzte Richtung ihres Hauses. Der eigentliche Dorfkern lag wohl rechts von ihm, lauter Feldsteinhäuser mit ummauerten Höfen, auf unübersichtliche Weise ineinandergeschachtelt; sein Weg aber, die famose alte Straße, führte ringförmig um diesen Dorfkern herum.
Florian hatte das Dorf fast komplett umrundet, als er es vorzog, umzukehren; bis zum Haus der Furie wollte er nicht gehen! So kam er ein zweites Mal an einem Haus vorbei, das bereits zuvor seine Aufmerksamkeit erregt hatte, und blieb davor stehen. Dieses Gebäude war nicht besonders schön mit seinem grauen Verputz, der an der Schlechtwetterseite rötlich verfärbt war; aber der Garten … Ein reines Meer von Farben und Düften, von Blumen und blühenden Sträuchern! Und um das alles noch pittoresker zu machen, erschien nun eine alte Dame mit einem Eimer, aus dem sie Korn unter ihre frei umherlaufenden Hühner warf.
Die Dame war alt, aber hellwach. Obwohl Florian keinen Laut von sich gegeben hatte, hatte sie ihn sofort entdeckt. »Degemer mat«, sagte sie und trat an das Gartentor.
»Wie? – Äh, bonjour«, gab Florian zurück.
»Je peux vous aider?«, fragte die Alte.
»Do you speak English?«, versuchte es Florian.
Die Alte lachte und machte eine abwehrende Handbewegung.
»Hm, supermarché?«
Die alte Dame sagte etwas von »Telgruc« und »dimanche«, das hieß Sonntag. Das Kopfschütteln dazu sprach für sich.
»Das dachte ich mir«, Florian zuckte resigniert die Achseln.
Nun stellte die alte Dame ihm eine Frage, in der das Wort »habiter« vorkam. »Ich wohne da hinten, là«, Florian zeigte vage in Richtung seiner Unterkunft.
»La maison à côté de celle de Marie? C’est vous, le propriétaire?« Florian blähte die Backen auf. Marie – hieß so seine schreckliche
Nachbarin?
»Attendez, Monsieur«, sagte die alte Dame und wies ihm an, am
Gartentor stehenzubleiben. Was hatte sie vor?
Sie verschwand in ihrem Haus und kam kurz darauf mit einem Eierkarton und einer Flasche Wasser zurück. »Tenez«, sagte sie und hielt ihm beides hin. »Des oeufs tout frais!« Sie strahlte ihn an, ehe sie hinzufügte: »Trista tra ’zo er béd: Eun oaled heb tan, Eun daol heb bara, Eun ti heb maouez2.«
»Wie bitte?«, fragte Florian zurück. War diese Sprache etwa Bretonisch gewesen?
»Pour vous, pour vous! Ah, attendez!«, rief die alte Dame, schlug sich an die Stirn und verschwand noch einmal in ihrem Haus. Was jetzt noch, fragte Florian sich und musste lächeln. Als seine Wohltäterin eine Untertasse mit einem großen Stück Butter auf dem Eierkarton platzierte, hatte er Mühe, seine Gaben festzuhalten.
»Du bon beurre, du beurre breton! Ça ira?«, fragte seine neue Bekannte.
Brot, Ein Haus ohne Frau.
»Klar, ça va«, grinste Florian. Er wollte der alten Dame vorschlagen, ihre Lebensmittel zu bezahlen. Doch dann fielen ihm die Worte dieser Marie ein: »In der Bretagne denken die Menschen nicht, alles ist mit Geld zu bezahlen!« Starker Spruch, echt bühnenreif, dachte Florian ironisch. Trotzdem wollte er nicht noch einmal ins Fettnäpfchen treten. Also sagte er nur: »Merci, merci beaucoup. Hm, à propos: Je m’appelle Florian Reinart.«
»Moi, c’est Yvonne Le Roux«, gab die alte Dame heiter zurück. Sie winkte ihm zu und fuhr fort, ihre Hühner zu füttern.
Yvonne Le Roux. Ein warmes Gefühl stieg in Florian auf. Es gab also doch auch freundliche Nachbarinnen in der Bretagne.
Zurück in Boris’ Küche, drehte Florian todesmutig am Verschluss der Gasflasche – er hatte keine Erfahrung damit – und schaffte es, eine Herdflamme zu entzünden. Das war schon mal etwas. Dann machte er sich Rührei, in Butter gebraten. Er fragte sich, was Yvonne Le Roux ihren Hühnern zu fressen gab, ein so orange-gelbes Eigelb hatte er noch nie gesehen. Die Butter schmeckte salzig, und das nicht wenig. Das war praktisch, so musste er nicht würzen, und Gewürze gab es nicht in Boris’ famosem Ferienhaus. Als Nachtisch aß Florian von den leckeren Frühstückskeksen. Danach holte er sich den Bretagne-Reiseführer und setzte sich hinter das Haus in den Garten. Gartenstühle gab es nicht, aber einen Felsstein, dessen glatte Oberfläche zum Sitzen einlud.
Florian reckte sich und ließ den Blick schweifen. Aus dem Grundstück konnte man etwas machen, fand er. Es war groß, mit Wildblumen und diesen interessanten Felsbrocken hier und da im hohen Gras. Um den Garten herum lief eine uralt aussehende Mauer aus Feldstein, die, wie die Rückseite des Hauses, teilweise mit Efeu, Rosen und Brombeerzweigen überrankt war. Nur zum Nachbargrundstück hin (zum Glück war nichts von der Kratzbürste zu sehen!) ersetzten blühende Ginsterbüsche und pieksige Stechginsterbüsche die Umfriedungsmauer. Auch das Haus, so ungepflegt es war, war an sich ein reizvoller historischer Bau. Es war ein Fehler, es so herunterkommen zu lassen. Das Ensemble hier könnte ein kleines Idyll sein. Das musste man der Furie von drüben lassen, ihr Haus mit dem Garten und dem alten Nebengebäude war ein kleines Idyll.
Florian seufzte und öffnete den Reiseführer. Crozon waren mehrere Seiten gewidmet. Steilklippen und Grotten, Strände und Fischerorte mit bunten Häusern, die Fotos sahen vielversprechend aus. An einem davon blieb sein Blick hängen. Es zeigte eine Hafenansicht; in den Hafen hinaus führte eine schmale Landzunge, die das Hafenbecken schützend umschloss. Auf der Landzunge standen eine kleine Kapelle und ein blockartiger historischer Wehrturm aus rotem Stein. Der Ort hieß Camaret-sur-Mer. Der Reiseführer sprach auch von einem hervorragenden Fischrestaurant, Chez Philippe.
Florian schlug den Reiseführer zu. Die Möwen kreischten über ihm und sprachen von der Nähe des Meeres. Es war ein herrlicher Sommertag, und er hatte keine Lust, länger auf den Verwalter zu warten.
»Ah, du lebst noch.« Wie zu erwarten, hörte Isabelle sich am anderen Ende der Leitung pikiert an.
»Mehr oder weniger, ja. Aber es geht mir nicht gut«, gab Marie aufrichtig zurück und reckte sich dabei, das Telefon am Ohr, um durch das Fenster Richtung Ginsterhecke zu sehen. War er im Garten? Von hier aus sah sie es nicht. Verdammt, sie wollte in den Garten, aber nicht, wenn der bescheuerte Deutsche in seinem war!
Isabelle seufzte hörbar. »Ich kann mir denken, dass du am Boden zerstört bist. Nach all den Jahren, in denen du gehofft hast … Willst du mir endlich alles erzählen?«
»Euh – nein. Ich – kann noch nicht darüber reden, ohne die Fassung zu verlieren und so weiter. Deshalb konnte ich mich auch bei niemandem melden, nicht mal bei dir. Aber ich spüre, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um wieder ein bisschen unter Menschen zu gehen. Du fehlst mir. Wollen wir nicht ausgehen? Den Sommerabend genießen, etwas Leckeres essen … Ich lade dich ein!«
»Bei dir, in deinem neuen alten Haus?«
»Lieber ein anderes Mal; ich würde gern wegfahren. Wie wär’s?« Nachdem Isabelle zugesagt hatte, fühlte Marie sich erleichtert.
Heute Abend würde sie nicht in dumpfem Brüten versacken, sie würde mit ihrer Freundin lecker essen gehen, und vorher, jetzt gleich, würde sie schwimmen!
Die Küste lag zwei Kilometer von Mengleuff entfernt, Marie war die Strecke schon zu Fuß gegangen, aber heute hatte sie Lust auf Fahrtwind. Auf ihrem alten Rennrad strampelte sie eilig am Nachbarhof vorbei (er war irgendwo da; das Drecksauto parkte an derselben Stelle im Hof wie am Morgen), dann ging es den Hügel hoch und aus dem Dorf hinaus. Sie erreichte die Kuppe, von hier an ging es nur noch abwärts. Vor sich, oder genauer unter sich, sah sie das Meer; es war, als würde sie mit dem Fahrrad gleich von der Landstraße abheben und über den Ozean fliegen …
Plötzlich war das Auto hinter, jetzt direkt neben ihr – Marie schwenkte nach rechts, bremste, konnte dem Graben eben noch ausweichen … Schwer atmend stand sie und schaute dem Auto nach, das sie fast von der Straße gedrängt hatte. Natürlich, ein silberner Porsche Cayenne … War das Absicht gewesen?! »Das geht zu weit! Wir sind nicht wirklich im Krieg«, rief sie ihm nach. Dann atmete sie tief durch und fuhr weiter.
Der Cayenne parkte auf ihrem Parkplatz. Wütend kettete Marie ihr Fahrrad an einer Aussichtsbank fest. Aber klar war er hierhergefahren. Alle parkten hier, die zum Strand der großen Bucht wollten. Zum Glück lag ihre Lieblingsbucht woanders.
Marie folgte dem Küstenwanderweg, der an dem Parkplatz losging. Zwischen Heidekraut und Ginster wand er sich am Abgrund entlang. Nach einem knappen Kilometer bog sie auf den schmalen Pfad ab, der die Steilküste hinunterführte, zu einer kleinen, geschützten Bucht. Kaum jemand hatte Lust, das Strandzeug bis dorthin zu schleppen. Für gewöhnlich hatte Marie ihre Bucht für sich alleine. Umso größer der Schock, als es heute anders war.
Entgeistert starrte Marie auf das männliche Wesen, das in einigen Metern Entfernung arglos auf dem Bauch lag und sich die Sonne auf die blasse Haut knallen ließ. – Langsam und leise trat sie den Rückzug an. Sie war lange nicht mehr in der großen Bucht schwimmen gewesen, vielleicht doch keine schlechte Idee, für einmal. Aber nur für einmal! Das ging nicht an, dass dieser Deutsche hier auftauchte, sich an ihren Hortensien verging, sie selbst fast umfuhr mit seinem Panzer, dann ihre Bucht in Besitz nahm und sie obendrein zur FKKZone erklärte!
Florian war begeistert. Obwohl der Autositz im sonnenverbrannten Rücken sich nicht angenehm anfühlte, genoss er seine erste Erkundungsfahrt über die Halbinsel Crozon. Diese Landschaft, er war dabei, sich in sie zu verlieben! Diese Ausblicke auf das Meer! Immer, wenn man es wiedersah, hatte es eine andere Farbe, leuchtendes Türkis, tiefdunkles Blau oder Hellblau mit weißer Schaumkrone. Hinter jeder Kurve konnte es auftauchen, die Küste war so zerklüftet. Mal führte die gewundene Straße auf einen Hügel, mal hoch hinauf auf die Steilküste, dann wieder talwärts direkt an den Meeresrand, zu größeren oder kleineren Stränden. Felsnasen rahmten sie ein, weit streckten sie sich vor in die See. Hier und da tauchten Granitinselchen zwischen den Wellen auf. Es war schön, einfach schön!
Und nicht nur die Landschaft sprach Florian an, auch die Architektur. Hier standen wirklich überall alte, teils uralt aussehende Häuser aus bräunlichem Feldstein, erfrischend wenig oder gar nicht modernisiert. Die meisten hatten dunkelgrau-glänzende Schieferdächer, wenige waren strohgedeckt. Alle hatten sie hölzerne Fenster und Türen, die im Kontrast zu den Farben des Steins und des Schiefers in kräftigen Farben gestrichen waren. Und genau so ein Haus hatte Boris! Und er machte nichts daraus! Nein wirklich, das konnte er nicht verstehen. Er würde die Läden an Boris’ Haus übrigens blau streichen. Ein intensives Mittelblau, ähnlich wie an dem Haus der unmöglichen Nachbarin. Geschmack hatte die Frau schon, das ja. Aber Geschmack ist in manchen Fällen nicht alles.
Jetzt fuhr er eine steile Anhöhe hinauf und vorbei an zwei Ortsschildern: das obere war auf Französisch, das untere auf Bretonisch. Bretonisch hieß Camaret also Kameled. Dann bremste Florian abrupt, denn die Aussicht, die sich jenseits der Hügelkuppe vor ihm auftat, war überwältigend. Tief unter ihm lag der Hafen, wie aus der Vogelperspektive sah man auf ihn, mit seinen weißen Segelchen auf dem tiefblauen Wasser und mit einem roten Punkt, das musste der Wehrturm aus dem Reiseführer sein, und daneben, ganz winzig, ein graues Kirchlein …
Marie und Isabelle fielen sich vor dem Chez Philippe in die Arme. Ach, es war doch schön, sich wiederzusehen! Sie setzten sich an einen Tisch auf der Terrasse, und als der Kellner kam, bestellte Isabelle Kir mit Cidre als Aperitif.
»Warum das? Gibt es etwas zu feiern?«, fragte Marie.
»Natürlich«, erwiderte Isabelle vergnügt. »Das Leben ist schön, besonders, wenn man seine beste Freundin nach langer Zeit wiedersieht und sie eine richtige Entscheidung getroffen hat. Aber ich weiß schon, du kannst oder willst nicht darüber reden, du freie Frau!«
Marie musste wider Willen lachen. Isabelle war wunderbar. Sie strahlte ihre eigene Heiterkeit aus und einen schier unermüdlichen Optimismus.
Der Kellner kam und stellte Brot, ein Töpfchen Butter und eine Karaffe Wasser auf den Tisch. Sobald er weg war, beugte Isabelle sich vor und rüttelte ihre Freundin am Arm. »Seit Januar wusste ich genau, dass es dieses Jahr Zeit war für deinen Schritt! Und du wusstest es auch, gib es zu.«
Marie runzelte die Stirn. Und das war das Nervende an Isabelle: dass sie im vergangen Jahr auf Esoterik gekommen war. Sie hatte diese verrückte Hellseherin entdeckt, die unschuldigen Opfern die Zukunft mit Karten auslegte oder sie mit einem Bleilot auspendeln wollte. Isabelle war so begeistert von der Frau gewesen, dass sie Marie einmal mitgeschleppt hatte, damit auch die in den Genuss einer Wahrsagung käme. »Was hat die Hellseherin dir noch einmal wörtlich gesagt?«, fragte Isabelle jetzt, vertraulich leise.
»Da kommt der Kir«, lenkte Marie ab.
Sie warteten, bis der Kellner wieder gegangen war. Dann prosteten sie sich zu und kosteten das erfrischende Getränk.
»He, du hast noch nicht auf meine Frage geantwortet«, griff Isabelle den Faden dann wieder auf. »Die Hellseherin hat dir gesagt, dass du bald dem Mann deines Lebens begegnen wirst!«
»Na, der lässt dann wohl auf sich warten, oder hast du ihn schon gesehen?«, fragte Marie ironisch. »Überhaupt, solche Sprüche kannst du in jedem Groschenmagazin nachlesen, findest du nicht? Du glaubst doch nicht wirklich an solche Prophezeiungen?«
»Hm, ich bin nicht ganz sicher. Weißt du, die Hellseherin hat mir schon Dinge vorhergesagt, die dann wirklich passiert sind.«
»Ah. Dass dein Freund dich einmal mehr betrogen hat?« Marie biss sich auf die Lippen. »Entschuldige. Das war gemein.«
Isabelle zog einen Flunsch. »Genau, das war es! Aber dafür wiederhole ich dir, was dir die Hellseherin geweissagt hat, sie sagte: Ich sehe einen Mann, der dich in Todesgefahr bringt, und ich sehe einen Mann, der dir gut tun wird. Dieser Mann stand dir immer schon nahe, auch wenn du ihn nie gesehen hast. Er wird dein Leben verändern, denn er ist deine Bestimmung. Siehst du? Ich habe nicht vergessen, was du mir damals erzählt hast! Und du hast es auch nicht …«
Verlegen sah Marie sich nach allen Seiten um. Hoffentlich hatte niemand den Unfug gehört! »Isabelle, das ist Blödsinn«, zischte sie. »Und zum Glück! Ich habe gar keine Lust darauf, einem Mann zu begegnen, der mich in Todesgefahr bringt.«
»Dafür kommt dann der andere, der dir gut tut und deine Bestimmung ist. Ich finde das nicht übel.«
Marie verdrehte die Augen, musste aber grinsen. »Es gibt übrigens wirklich einen neuen Mann in meinem Leben«, sagte sie verschwörerisch.
Isabelle riss die Augen auf.
»Ein Deutscher, mein neuer Nachbar. Um es dir aber gleich zu sagen: Der hat weder das Zeug zum Mann fürs Leben, noch zu einem, der mich in Lebensgefahr bringt. Wobei – ja doch! Heute hätte er mich fast umgefahren, als ich mit dem Rad unterwegs war …«
»Erzähl!«
»Dann mach dich auf das Schlimmste gefasst.«
Florian streckte die Beine unter dem Tisch aus. Das musste ein gutes Restaurant sein, die Terrasse war voll, und er hörte um sich nur Französisch: lauter Einheimische. Zum Glück hatte er einen der Tische am Rand der Terrasse erwischt, von dem aus er die Aussicht zum Meer hin genoss. Die Sonne stand noch immer hoch am Himmel und spiegelte sich auf dem stillen Wasser des Hafenbeckens; am Horizont zeichneten sich die Silhouetten der tour Vauban und der kleinen Kapelle ab. Im roten Wehrturm war er nicht gewesen, aber in der Kapelle. Dass die Engländer ihr den Turm abgeschossen hatten, 1697, hatte ihn weniger beeindruckt als die MG-Einschusslöcher im Dachgebälk. Das waren, dem Reiseführer nach, Spuren der Befreiung Camarets durch die Amerikaner.
Aber es war ein zu schöner Abend, um über den zweiten Weltkrieg nachzugrübeln und über das Tagebuch seiner Oma. Der Kellner kam und Florian gab seine Bestellung auf. Er hatte sich für die Meeresfrüchteplatte entschieden; so etwas war hier sogar erschwinglich.
»Am liebsten würde ich den Typ vergraulen, und zwar schnellstmöglich! Hast du keine Idee, wie ich das machen könnte?« Marie sah Isabelle flehentlich an.
»Nein, aber weißt du was? Ich bin froh, dass dieser neue Nachbar da ist.«
»Wie bitte?«
»Wie es scheint, lenkt der dich von deinem Kummer ab.«
»Wie meinst du das jetzt?«, fragte Marie verblüfft.
»Den ganzen Abend hast du nur über einen Mann gesprochen, und es ist nicht der, von dem ich gedacht hatte, eine Menge zu hören.«
»Hm. Vielleicht ist sogar etwas dran. Vielleicht habe ich heute wirklich weniger an – ihn gedacht …«
»Kannst du wirklich nicht einmal seinen Namen aussprechen?«
»Doch«, sagte Marie langsam, »heute Abend vielleicht schon. Sylvain.« Sie wartete, aber die gewohnten Tränen wollten nicht kommen. Also holte sie tief Luft und begann, erstmals einem anderen Menschen von ihrer Trennung zu erzählen.
Florian riss die Augen auf, als die Meeresfrüchteplatte vor ihn gestellt wurde. »This is for one person?«, hakte er beim Kellner nach und hob einen Finger. Der Kellner nickte, wünschte ihm »bon appétit« und ließ ihn mit der Pyramide von Meeresfrüchten allein. Na denn, sagte sich Florian und musterte die ungewohnten Bestecke, die neben der Meeresfrüchteplatte ihrer Benutzung harrten. Vorerst griff er dann doch zur herkömmlichen Gabel und pulte eine Miesmuschel aus ihrer Schale. Miesmuscheln hatte er schon gegessen, mit denen kam er klar; für den Hummer gab es die Schere, für die Austern das Messer und die Spießchen mussten für die Meeresschnecken sein. Er würde das schon in den Griff kriegen.
»Sag mal, du lachst doch nicht über meine Probleme?«, fragte Marie schroff ihre Freundin.
Isabelles Gesicht wurde ernst. »Blödsinn, ich lache doch gar nicht, und schon gar nicht über dich! Was denkst du! Ich habe jedes Wort über dich und den Dreckskerl gehört! Ich lache nur ein bisschen über den da. Dreh dich mal unauffällig um. Er sitzt schräg rechts hinter dir. Unauffällig!«
Marie tat es – und ließ die Gabel los, die in die Hummersauce fiel. »Oh nein!« stieß sie hervor, aber nicht wegen der Soßenspritzer auf ihrem T-Shirt.
Isabelle, die den Ausruf ihrer Freundin noch anders interpretierte, beteuerte nachdrücklich: »Doch, das ist es ja eben. Das macht der schon die ganze Zeit! Der hat von Meeresfrüchten keine Ahnung«, sie kicherte. Der Mann, den sie beobachtet hatte, kämpfte eben mit der Schere, die ihm helfen sollten, den Hummer zu bewältigen. Besonders geschickt war er aber nicht …
Marie beugte sich zu ihrer Freundin vor und zischte: »Das ist er!«
»Wer?«, fragte Isabelle laut zurück.
»Na er – der Panzerfahrer und Hortensienmörder!«, raunte Marie entnervt.
»Echt?« Isabelles Blick schoss noch einmal zu dem Mann hin. »Der sieht gar nicht aus wie ein Deutscher«, stellte sie fest.
Marie verdrehte die Augen. »Warum, weil er nicht blond ist?«
»So oder so, der ist niedlich. Was ist der für ein Sternzeichen?«
Marie starrte ihre Freundin an. »Niedlich? – Mal ehrlich, willst du unbedingt ein Dessert? Ich würde gern gehen.«
»Du bist viel zu emotional, wie immer«, bemerkte Isabelle. »Ist doch nicht schlimm, wenn dein Nachbar zufällig im selben Restaurant mit uns sitzt. Ich werde jedenfalls nicht wegen ihm auf mein Dessert verzichten. Und das solltest du auch nicht.«
»Na toll, soll ich dir vielleicht seine Telefonnummer beschaffen?«
»Das Sternzeichen würde mir vorerst genügen.«
»Aïe!« Etwas Hartes hatte Marie am Hinterkopf getroffen. Sie hob das Geschoss vom Boden auf. Eine Meeresschnecke. Langsam wandte sie sich um. Auch er sah zu ihr – sein Gesicht annähernd so rot wie der Hummer auf seinem Teller.
»Sorry. Aus den Fingern geflutscht«, rief er zu ihnen hinüber und lächelte zerknirscht.
»Wirklich süß«, gluckste Isabelle. Aber Marie war der Appetit vergangen und sie setzte sich bald damit durch, das Restaurant ohne Dessert zu verlassen und ihrer Freundin stattdessen ein italienisches Eis in der Waffel zu spendieren.
Florian tat es leid, seine Nachbarin und ihre Freundin gehen zu sehen. Er hätte sich gerne richtig bei ihr entschuldigt – für sämtliche »Pannen« des Tages. Er hätte sie zu etwas einladen sollen, zu einem Nachtisch oder einem Wein. Aber plötzlich schien diese Marie es ja sehr eilig zu haben; und er kämpfte seinerseits noch immer mit seinem Hummer und Co … So blieb Florian noch einige Zeit im Chez Philippe und rundete sein Festmahl zuletzt mit einer köstlichen Mousse au chocolat blanc ab. Die war leichter zu essen; mit Löffeln kannte er sich aus.
Auf seinem Rückweg nach Mengleuff musste Florian später anhalten und aussteigen. Wegen des Sonnenuntergangs, über einer Bucht. Die Sonne war eben hinter der Horizontlinie des Meeres versunken; trotzdem war die Atmosphäre noch voller Licht. Durchdrungen von einem Licht, das intensiv violett war. Der Himmel hatte dieselbe Farbe wie das Meer. Nur durch die gekräuselte Spur der Wellen konnte man Wasser und Luft voneinander unterscheiden. Dann riss plötzlich die dünne Wolkenschicht auf und legte den kristallklaren Abendhimmel frei, transparentes Blau mit einem Hauch Gelb-Orange … Florian überkam eine Gänsehaut angesichts dieses bezaubernden Naturschauspiels. In diesem Moment meldete sein Handy, das er ohne zu überlegen nach dem Restaurantbesuch eingeschaltet hatte, eine Nachricht. Auf dem Display sah er ihren Namen: Katharina.
Er hatte eben an Katharina gedacht, den magischen Augenblick mit ihr teilen wollen, nun meldete sie sich von sich aus. Sofort las er ihre SMS: »Wo bist du? Es gibt viel zu regeln! Ich will die Scheidung.« Etwas in Florians Bauch zog sich zusammen, und es war nicht der Hummer. Er versuchte tief durchzuatmen, den plötzlichen Brechreiz zu bekämpfen. Aus einem Impuls heraus startete er einen Rückruf – die Mailbox ihres Handys sprang an, sie hatte das Gerät ausgeschaltet.
»Scheiße! Verdammt, Katharinaaa!«, schrie er ihren Namen über das Meer; aber was nützte das? Sie war tausendzweihundert Kilometer weit weg, und innerlich noch viel weiter …
Marie hatte gleich gewusst, dass es regnen würde. Wenn der Sonnenuntergang so violett war, kündigte das einen Wetterwechsel an. Sie zog die Strickjacke fester um sich und setzte sich mit der Mappe auf das alte Bettgestell vor dem Altar-Schrank.
Es war mitten in der Nacht, aber wie so oft konnte Marie keinen Schlaf finden. Daher fing sie an, in Elodies alten Mappen zu blättern. Denn einen Stapel davon hatte sie ja noch nicht durchgesehen, und die Neugier war stärker als die Abschreckung durch das unheimliche Fundstück von neulich, das Portrait des deutschen Offiziers. Und so saß Marie da, bis sie dreizehn Mappen durch hatte. Alles Modezeichnungen, aus den neunziger bis fünfziger Jahren (nach unten hin wurden die Mappen des Stapels älter). Eine beachtliche Sammlung. Und dazwischen, immer wieder, Portraits, Portraits, Portraits. Gesichter von Menschen, die Marie nie gekannt hatte. Bis sie zur letzten, untersten Mappe kam. Und das waren keine Modezeichnungen mehr, nein; das waren die Zeichnungen der ganz jungen Elodie, aus der Bretagne!
Marie war zutiefst bewegt, als sie vertraute Landschaften wiedererkannte – gewisse Blicke von der hiesigen Steilküste; nahe Wegekreuzungen mit Kalvariensteinen; knorrige alte Apfelbäume – und ihr Haus, von der Rückseite! Und da, da war auch die Wasserpumpe! Noch nicht sichtbar verrostet. Wie seltsam, sie so auf Papier zu sehen, festgehalten von Elodies jugendlicher Hand! Und dann … Zutiefst gerührt hob Marie das Blatt heraus, ein Portrait ihres papys als Junge. Dem Datum nach war der kleine Erwann zwölf Jahre alt gewesen; aber diesen wachen und verschmitzten Blick, den kannte sie gut, das war noch immer ganz der ihres papys!
Lange konnte sie sich von dem Anblick dieses Bildes nicht lösen; als sie es doch beiseitelegte, erschien darunter ein verblasstes Schwarz-Weiß-Foto, auf dicke Pappe gezogen. Ein Mann mit schwarzem Haar und Schnurrbart; er trug eine Seemannsuniform. Um eine Ecke des Fotos war ein schwarzes Trauerband geklebt. Marie ahnte, wen sie vor sich hatte. Sie wandte das Foto um. Da stand es, in Elodies Handschrift: »Andenken an meinen geliebten Vater.« Marie schluckte. Ihr Urgroßvater Cadiou war bei einem Unwetter auf See ertrunken. Wann war das gewesen? Sie wusste es nicht genau.
Unter dem Trauerfoto lagen noch ein brauner Postumschlag und darunter vereinzelte Postkarten, anscheinend von Freunden an Elodie geschrieben, viel später, als sie bereits in Paris lebte. Marie hatte keine Lust mehr, das weiter durchzusehen. Sie fühlte sich ausgelaugt, vielleicht würde sie jetzt schlafen können.
Eine wahre Sturzflut prasselte auf das Dach; eingelullt von dem Tosen, schlief Marie wirklich bald ein.
Vergeblich wälzte Florian sich im Bett herum. Ihm gingen die Worte durch den Kopf, die er noch eben gelesen hatte. Seine Oma hatte ihre ersten Eindrücke von der »Fremde« beschrieben; sie hatte von dem Heimweh geschrieben, von der Sehnsucht nach ihren Eltern und von der Einsamkeit in ihrer Kammer, im Haus einer schweigsamen Witwe namens Madame Keroas. Einsamkeit in der Fremde, ja, das konnte er nachvollziehen. – Seine Oma hatte so genau geschildert, wo ihr Quartier in Telgruc gelegen hatte; würde er das Haus dort noch finden, am Kirchplatz?
Lange lag er noch wach, dachte mal an Katharina, mal an die junge Marlene, allein im Haus der Witwe Keroas. Er konnte innerlich nicht abschalten, obwohl er zutiefst erschöpft war. Er lag nur da und lauschte, lauschte auf das Prasseln des Regens auf dem Dach, eines Regens, der plötzlich losgegangen war, mit Urgewalt, niemals hätte Florian mit Regen gerechnet… Er schlief ein.
2 Die drei traurigsten Dinge auf Erden: Ein Herd ohne Feuer, Ein Tisch ohne