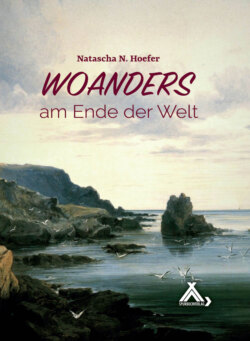Читать книгу Woanders am Ende der Welt - Natascha N. Hoefer - Страница 13
Оглавление7. Verhängnisvolle Begegnungen
Sie reden kein Wort. Marlene starrt aus dem Fenster der Limousine. Sie hat sich rechtfertigen müssen, erklären, wo sie die Nacht über geblieben ist und warum sie die Botschaft nicht überbracht hat. Sie hat den durchweichten Umschlag zurückgegeben. Der Oberst hat sie durchdringend angesehen, als er das geöffnete Siegel sah. Aber er hat nichts dazu gesagt. Dann hat sie die Geschehnisse wahrheitsgemäß erzählt – aus der Ich-Perspektive, sie hat nie »wir« gesagt. Sie hat seine Rolle, die Rolle ihres neuen, einzigen und unmöglichen Freundes, im Unklaren gelassen. Sie hat gefürchtet, dass man nach ihm ruft, um auch ihn auszufragen. Der Oberst tat es nicht. So hat sie alles andere erzählt – nur den Fremden in der Kapelle hat sie weggelassen. Hat der Oberst ihr trotzdem etwas angemerkt? Sobald sie auf die Kapelle kam, ist er hellhörig geworden. Warum will er die Kapelle jetzt sofort sehen? Marlene hat Angst. Angst davor, Spuren vorzufinden, des fremden Mannes von letzter Nacht und der Kameraden, die er haben könnte. Er kannte ihn, diesen Mann; er könnte Ärger bekommen, sollten sie ihn erwischen. Sie hofft, er ist schon weit weg. Dabei weiß sie, sie dürfte das nicht hoffen.
»Wie weit noch?« Der Oberst dreht sich zu ihr und sieht sie an, forschend.
»Noch ein paar Kilometer, Herr Oberst. Die Kapelle liegt direkt an der Straße, auf der linken Seite.« Marlene bemüht sich um präzise Aussagen.
Der Oberst dreht sich wortlos zurück.
Sie sehen den Kirchturm aus der Ferne. Sie muss nichts sagen, der Oberst befiehlt dem Chauffeur, rechts am Straßenrand anzuhalten. Er steigt aus der Limousine und überquert die Landstraße. Soll Marlene mit? Der Oberst hat keinen Befehl dazu gegeben. Marlene bleibt sitzen und beobachtet ihn, wie er über die steinerne Schwelle den Kirchhof betritt.
Nach wenigen Minuten kehrt der Oberst zurück. »Abgeschlossen«, sagt er.
Seltsam, schießt es Marlene durch den Kopf. Letzte Nacht stand die Kapelle offen. Wer hat abgeschlossen seitdem, wann? Und dann, warum hat der Oberst nicht den Chauffeur geschickt, um zu überprüfen, ob das Kirchenportal offen ist? Er hatte es eilig, die Kapelle zu sehen, allein. Hat er einen Verdacht? Gegen wen? Marlenes Gedanken überstürzen sich.
Der Chauffeur fragt: »Aufbrechen, Herr Oberst?«
»Nein. Die Deutschen sind kein Volk der Barbaren. Wer hat den
Schlüssel zu diesem Gotteshaus? Finden Sie das heraus!«
Der Befehl geht an den Chauffeur, der aus der Limousine steigt. Er steuert die Tür des nächstgelegenen Hauses an. Ein relativ großes Haus, vielleicht das des Pfarrers.
Die Tür öffnet sich nicht unter den anhämmernden Fäusten. Der Chauffeur versucht es bei den anderen der wenigen Häuser. Doch alles ist verlassen. Keine arbeitenden Menschen, keine spielenden Kinder. Die Stille um sie ist unnatürlich.
Im letzten Haus, bei dem der Chauffeur es probiert, öffnet sich doch eine Tür. Eine gebeugte Alte humpelt heraus. Der Chauffeur spricht mit ihr; die Alte antwortet und schüttelt den Kopf.
»Sprach nur den Kauderwelsch von hier, Herr Oberst«, meldet der Chauffeur. »Aber sie sagte etwas vom curé in Promodern. Das ist dieses größere Dorf im Südosten.«
»Plomodiern. Gut. Fahren Sie nach Plomodiern und holen Sie den Schlüssel beim Pfarrer«, befiehlt der Oberst. »Sie bleiben hier«, dies an Marlene.
Sie steigt aus der Limousine, der Chauffeur startet und fährt ab.
»Kommen Sie«, fordert der Oberst sie auf. »Wir sehen uns die Kapelle genauer an.«
Marlene ist verwirrt, als der Oberst eine kleine galante Verbeugung macht, um ihr den Vortritt in den Kirchhof zu lassen. Folgsam tritt sie über den Schwellenstein. Sie kommt sich ungelenk vor, spürt den Blick des Obersts in ihrem Rücken.
»Wissen Sie, welchen Zweck diese steinernen Schwellen erfüllen?«, fragt er.
»Nein, Herr Oberst.«
»Sie tragen eine symbolische Bedeutung. Sie grenzen den heiligen
Kirchengrund vom Bereich des profanen Lebens ab.«
Marlene nickt, ohne zu begreifen. Worauf will der Oberst hinaus? Er ist schon ein paar Schritte weitergegangen und umrundet die drei Kalvariensteine. Vor dem höchsten, dem mittleren, bleibt er stehen.
»Diese kniende Figur ist bemerkenswert«, sagt er.
Marlene sagt nichts. Was soll sie auch dazu sagen?
»Ich vermute, dass es sich um eine Darstellung der Maria Magdalena handelt. Eine schöne junge Frau mit sanften, regelmäßigen Gesichtszügen und langen, offenen Haaren. Sie betet Jesu an, und das gleich zweifach: direkt über ihr liegt er tot auf dem Schoß seiner Mutter – und darüber hängt er noch einmal, leidend am Kreuze. Obwohl der Granit steingrau ist, sieht man doch: Maria Magdalenas Locken sind rotblond.« Der Oberst schaut zu Marlene.
»Ja, jawohl, Herr Oberst«, stammelt sie.
Er lächelt. Mitleidig? Herablassend? »Wie alt sind Sie?«
Marlene fühlt sich erröten. »Siebzehn Jahre, Herr Oberst«, antwortet sie.
Der Oberst wendet den Blick zurück zu der knienden Maria Magdalena. »Aus welcher Richtung sind Sie vergangene Nacht bei dieser Kapelle angekommen?«, fragt er beiläufig.
»Von dort, Herr Oberst«, sie zeigt in Richtung des Berges. Jetzt beginnt das Verhör, denkt sie.
Doch sie irrt sich. Der Oberst befiehlt: »Kommen Sie«, und sie umrunden gemächlich die Kapelle. Er weist sie auf die grotesken Zierfiguren und auf die Wasserspeier hin – ein dicker Mann, ein affenähnliches Wesen, das aber ein Löwe sein soll, mit Mähne; langgezogene Mäuler, durch deren Zahnreihen bei Regen das Wasser herausschießt. Gestern Nacht muss es so gewesen sein. Ein ganzer Sturzbach muss zwischen diesen scharfen Zähnen hervorgeschossen sein, denkt Marlene. Heute ist der Himmel blau und rein, ohne Wolken. Nur das Gras durchnässt ihre Schuhe. Die Nacht ist hier draußen wie fortgewischt. Doch drinnen – was wird drinnen sein? Wo bleibt der Chauffeur mit dem Schlüssel?
Zerstreut hört Marlene die Worte, mit denen der Oberst die Architektur der Kapelle beschreibt. Renaissancekuppel, Barocktor, drei Galerien, Rhythmisierung des Kirchturms – vergeblich versucht Marlene, dem Sinn dieser Begriffe zu folgen. Wo ist er jetzt? In Sicherheit?
Endlich das ersehnte Motorgeräusch. Marlene blickt rasch zum Oberst, der in seinen Erläuterungen gestockt hat. Seine Wangen sind gerötet, in seinen Augen, die in Richtung Landstraße spähen, liegt ein Funkeln, das Marlene beunruhigt. Sie beißt sich auf die Lippen. Was erwartet der Oberst in der Kapelle? Mittlerweile weiß sie genau, was geschieht, wenn sie, die Deutschen, auf Konspiratorennester stoßen. Die Einheimischen wissen es auch. Haben sie deshalb den Ort verlassen? Und die gebeugte Alte? Vielleicht wollte sie nicht. Lieber zuhause sterben.
Der Oberst hat sie wortlos stehengelassen und ist auf dem Weg zum Kirchenportal. Eigenhändig schließt er auf. Lautlos schwingt die Tür in ihren Angeln – unerwartet lautlos für eine so alte Tür. Der Oberst atmet ein, senkt den Kopf, als ob er sich durch ein niedriges Tor bücken müsste, und verschwindet im dunklen Kircheninneren.
Marlene zögert. Dann geht sie ihm nach.
Es ist drinnen gar nicht so dunkel. Nach einigen Sekunden haben sich Marlenes Augen an das Dämmerlicht gewöhnt.
Der Oberst steht mit dem Rücken zu ihr, vor der Altarwand der Kirche. Der Goldglanz und die kräftigen Farben sind noch überwältigender als bei Nacht, im bloßen Schein der Öllampe. Marlene tritt selbst fasziniert näher, um die Reihe der bunten Figuren, der plastischen Bilder und des bewegt wirkenden Schnitzwerkes zu betrachten. Es stellt Ranken dar, erkennt sie, Blätter und Traubenreben, Schleifen um Engelsköpfe, alles goldschimmernd, voller Schnörkel und Kurven, ein einziges Gewimmel.
Marlene fühlt sich befremdet von dem Gold und dem Glanz, der Pracht und Verspieltheit dieses Kirchenschmuckes. Er ist so anders als der von zuhause, aber auch zu der Welt der armen Bauern- und Fischerhäuser von hier will er nicht passen. Noch weniger zu der Welt der Bomben und Maschinengewehre.
Sie tritt ganz nah an die hölzerne Balustrade heran, die den Altarbereich vom Kirchenschiff abtrennt, beugt sich ein wenig darüber. Nichts. Keine Decke, keine Öllampe mehr. Sie atmet auf. Schnell späht sie zum Oberst hinüber. Hat die Richtung ihres suchenden Blickes ihm etwas verraten? Nein. Der Oberst hat kein Auge für sie. »Ha. Direkt vor der Haustür«, stößt er heiser aus. Er schreitet die Altarwand von rechts nach links und von links nach rechts ab, ein Heiligenbild nach dem anderen fixierend. Er seufzt tief auf, blickt zu Marlene und sagt:
»Gehen wir.«
Florian schlug die Kladde zu und blickte auf die Kapelle vor sich. Es war anders, den verstörenden Eintrag ein zweites Mal zu lesen – vor Ort, dort, wo alles passiert war.
Er saß auf dem Sockel des größten der drei Kalvariensteine, dem mit der knienden Maria Magdalena. Er hob den Kopf. Ja, diese Figur war schön. Er griff in den neuen Wanderrucksack und holte den gleichfalls neuen Skizzenblock und die Bleistifte heraus. Er hatte auch den Fotoapparat dabei; aber die Lust, einmal wieder zu zeichnen, hatte neulich in Camaret von ihm Besitz ergriffen. Wenn er zeichnete, war das eine andere, eine intensivere Art, Gegenstände, Orte oder Menschen zu erforschen.
Er stand auf und entfernte sich vom Kalvarienstein, um die Maria Magdalena aus günstigerer Perspektive zu skizzieren. Im Stehen, ohne feste Unterlage, war das nicht einfach; trotzdem verspürte er am Ende eine lange nicht mehr empfundene Zufriedenheit angesichts seiner gelungenen Skizze. Er setzte sich wieder auf den Sockel des Kalvariensteins, um jetzt die Kapelle zu umreißen. Ihren Turm mit der Kuppel, aus dem ein schmalerer, wiederum oben abgerundeter Türmchenabschluss erwuchs. Die Kuppelform war typisch für Renaissance- und Barockarchitektur; Marlenes Oberst hatte Bauzeit und Stil der Kapelle richtig eingeschätzt, der Mann hatte sich mit Architektur und Kunstgeschichte ausgekannt.
Florian hatte den Eintrag zur Entstehung der Kapelle an einem uralten Wegekreuz im Reiseführer nachgelesen, aber was ihn eigentlich interessierte, stand nicht darin: Welche Bedeutung hatte die Chapelle Sainte-Marie im zweiten Weltkrieg gehabt? War sie ein Konspiratorennest gewesen? Diese Frage stellte er sich zeichnend erneut; ehe er den Skizzenblock wegsteckte und aufstand, um die Kapelle zu umrunden.
Die groteske Figur des dicken Mannes, vielleicht ein Mönch, und das affenartige Löwenviech waren noch da, auch die brutal aussehenden Wasserspeier. Einen davon musste er doch noch skizzieren; dieser Wasserspeier glich einem Krokodilmaul mit Riesenzähnen, die ineinander verkantet waren. Vorne sah man das Loch für das abfließende Wasser. Florian setzte ein paar letzte Striche auf das Blatt und hielt inne. Sie war unheimlich, diese Begegnung mit den steinernen Zeugen der Vergangenheit seiner Oma. Es war fast, als würde er eine Zeitreise machen und Dinge sehen, die niemand sehen durfte. Andererseits wollte seine Oma, dass er sie sah. Sonst hätte sie ihm ihr Tagebuch nicht gegeben.
Plötzlich hatte er keine Geduld mehr zum Weiterzeichnen. Von wo aus hatte seine Oma sich damals der Kirche genähert? Jetzt sah er es. Nur nach hinten, zum Berg hin, war in der Kirchhofmauer eine Öffnung, eine Einfahrt. Von dort also. Von dort musste Marlene in den Kirchhof gefahren sein, bei Nacht und Unwetter auf einem Motorrad, festgeklammert an diesen Kriegsgefangenen, den sie nur den
»Jungen« oder einfach »er« nannte oder einmal ihren »neuen und einzigen und unmöglichen Freund«.
Florian betrat die Kapelle. Diesen Augenblick hatte er sich für zuletzt aufgespart. Würde sie noch so aussehen, wie Marlene es beschrieben hatte?
Es war nicht mehr 1942, und für die modernen Touristen hatte man Scheinwerfer angebracht, die die Altarwand beleuchteten. Florian überkam eine Gänsehaut. Er tat es dem Oberst nach und schritt die Reihe der Heiligenfiguren ab, deren Farben nicht verblasst waren. Sie schienen unheimlich lebendig in ihren Nischen oder auf ihren Sockeln für ihn zu posieren.
Hatte der Oberst das hier sehen wollen? Und zwar unbedingt, nicht als Barbar, sondern dank des Schlüssels, den der Chauffeur aus dem nächstgrößeren Dorf holen musste? Für Konspiratoren hatte der sich doch nicht interessiert! Dabei, dieser Mann, der bei Nacht und Gewitter in der Kirche aufgetaucht war, war der nicht im Widerstand gewesen? Und der junge Kriegsgefangene selbst? Konnte er im Widerstand und zugleich ein Kriegsgefangener gewesen sein?
Florian trat hinaus in das blendende Licht. Er würde zu Fuß den Berg besteigen, beschloss er. Er hatte gesehen, dass es von der Kapelle aus einen Wanderweg zum Gipfel gab.
Marie fuhr an der Chapelle Sainte-Marie vorbei auf den Parkplatz. Es war ein idealer Tag zum Wandern – klarer Himmel, heiße Sonne, aber ein erfrischender Wind. Sie hatte die Nase voll von Gartenarbeit, sie brauchte mal eine Abwechslung.
Sie holte den Rucksack aus dem Kofferraum. Er enthielt zwei große Baguette-Sandwiches, einen Apfel und eine Flasche Wasser zum Picknicken. Dass der deutsche Cayenne am anderen Ende des Parkplatzes stand, bemerkte sie nicht.
Sie machte einen Haken über den Kirchhof und grüßte die schöne, aber etwas finstere Kapelle. Dann ließ sie sie im Rücken, um der Landstraße ein Stück weit zu folgen. Die wand sich, begleitet von einem glucksenden Bachlauf, in ein Tal hinunter. Aber Marie wollte hinauf; also bog sie bald in einen steilen Schotterweg ein, dessen Steine in der heißen Sonne weiß aufleuchteten. Auch die staubige Erde war weißlich-beige. Nach ein paar Hundert Metern endete der Weg vor einem Schild, das daran erinnerte, dass man sich in einem Naturschutzgebiet befand, in dem Fahrzeuge verboten waren. Der Fußpfad, auf dem es jetzt weiterging, wäre ohnehin für kein Fahrzeug befahrbar gewesen, meinte Marie kopfschüttelnd.
Sie kraxelte über Felsbrocken und Wurzeln, die sich hartnäckig im Boden festkrallten. Auf dieser Höhe des Berges wuchsen noch spärliche Haine aus windgebeutelten Kiefern. Nachdem sie eine Kieferngruppe durchschritten hatte, schaute Marie sich um: Unter ihr, bereits in der Ferne, lag die Chapelle Sainte-Marie, umgeben von gelben Feldern mit Heuballen und frischgrünen Weidewiesen. Weiter links erstreckten sich die Hügel in Richtung Châteaulin, bedeckt mit Feldern und Wäldern. Rechts sah man einen Streifen Blau am Horizont – das Meer.
Marie atmete auf und schritt weiter. Der Wind zerzauste ihr Haar. Der Wind war auf dem Ménez-Hom immer da, oft genug stürmisch. So stieß sie bald nur noch auf vereinzelte Bäume, denen man ihren Kampf mit den Stürmen ansah: Ihr Astwerk war dünn, an der Nordseite manchmal gänzlich abgebrochen, so dass die Bäume wie Schilder gen Süden zeigten. Hin und wieder ragten ganz nackte Stämme wie Pfähle aus dem Boden. Die hohen Gräser, die den Ménez-Hom überzogen, neigten sich und blitzten in der Sonne auf wie grüne Wellen.
Ganz oben, auf dem yed, würden Menschen sein; ein Fahrweg führte dorthin, der Genuss der Panoramaaussicht war beliebt. Doch hier, um Marie herum, war keine Menschenseele. Nur Weite, Stille, das Rauschen des Windes. Und dann doch eine einsam dahinwandelnde Silhouette – ein zweiter Wanderer hatte zum Besteigen des Berges seine Füße dem Auto vorgezogen.
Sie folgte ihm in einiger Distanz, bis sie bemerkte, dass der Abstand zu ihm sich verringerte. Zunächst beschloss sie, ihrerseits langsamer zu gehen. Dann wurde ihr das zu nervend, zumal die Person stehengeblieben war, um etwas zu fotografieren. Was hatte der Wanderer entdeckt, fragte Marie sich? Einen Hinkelstein oder den Rest eines Hünengrabs? Die Kelten hatten auf dem Ménez-Hom Belen gehuldigt, dem Gott des Lichts. Außerdem gab es hier noch Mauerreste zu sehen, bei denen man nicht mehr wusste, ob sie von den Kelten stammten, von der Festung Aiqins des Normannen oder schlichtweg vom Teufel, wie der Volksmund behauptete. Manche Grundsteine hatten den Umriss eines marc’h, eines Pferdes, was schließlich nicht mit rechten Dingen zuging.
Als der Wanderer sich umdrehte, um seinen Rucksack aufzuheben, blitzte etwas weiß an seiner Hand auf. Ein Verband. Oh nein! Er!
Aber auf ein Treffen mit diesem Florian hatte Marie nun gar keine Lust! Entsprechend erleichtert war sie, als sich ein paar Minuten später ihre Wege trennten: Der Deutsche überquerte die Fahrstraße zum Gipfel und folgte weiter dem Fußpfad; Marie würde folglich den Fahrweg hochgehen. Als sie sich wenig später noch einmal umwandte, hatte der blöde Kerl es sich allerdings anders überlegt. Er ging nun hinter ihr die asphaltierte Straße hoch. Na toll!
Auf dem Parkplatz am Ende der Straße schloss Marie sich kurzerhand einer Gruppe von Ausflüglern an. Sie wandte sich um, wo war er? Da! Schnell wandte sie ihm den Rücken zu, als er an ihrer Gruppe vorbeiging. Jetzt schlurfte er auf den steinernen Rundtisch zu, der den höchsten Punkt des Berges markierte, stemmte die Hände in die Hüften und schaute um sich. Unschlüssig schlenderte er ein paar Schritte weiter, blieb dann abrupt stehen. Er zückte den Fotoapparat und drückte ab. Aber da war doch gar nichts, wunderte Marie sich. Nur die gelbe Markierung des Wanderweges. Jetzt schaute der Deutsche sich eifrig nach allen Seiten um. Er schien etwas Interessantes entdeckt zu haben, denn er hastete los.
Marie trat aus der Ausflüglergruppe heraus. Sie musste wissen, was ihren Nachbar derart gefesselt hatte. Der stapfte durch hohes Gras auf ein Buschmassiv zu. Vielleicht musste er mal, dachte sie und blieb lieber stehen. Aber dann zückte er wieder die Kamera – und fotografierte die Büsche. Er ging um die Büsche herum und knipste sie aus anderer Perspektive. Dann hatte er ein weiteres Buschmassiv entdeckt – es gab nicht viele hier oben – und nahm Kurs darauf. Hatte der einen Knall?
Marie näherte sich ihrerseits dem Grünzeug, das Florian begeistert und systematisch abgelichtet hatte. Und jetzt sah auch sie es: Inmitten des Buschmassivs war eine Treppe! Unten war das Fundament eines Kellers, überwuchert von Efeu, Farn, Gräsern, Brennnesseln und Dornenranken. Ein Keller? Nein! Das Baumaterial war Beton, erstaunlich intakt, nur hier und da von lichen überzogen, gelblichem Moos. Der Rest eines Bunkers.
Marie stieß einen leisen Pfiff aus. Sie sah nach ihrem Nachbar. Der machte gerade Fotos des zweiten Buschmassivs, das er entdeckt hatte. Eine zweite Bunkerruine? Marie sah mit neuem Argwohn um sich. Ja. Es war ihr vorher nie aufgefallen. Aber die einzigen Büsche, die auf der Bergkuppe wuchsen, standen hier, ganz oben auf dem yed, und zwar in ringförmiger Anordnung. Yed bedeutete
»Ausguck«. Seitdem Menschen den Ménez-Hom bestiegen hatten, hatten sie den Berg strategisch genutzt: Von hier aus hatte man ein Dreihundertsechzig-Grad-Panorama und konnte die umliegende Gegend kilometerweit im Auge behalten. Die verdächtigen Buschmassive zeigten wie die Ziffern einer Uhr in alle Richtungen.
Marie ging ein paar Schritte zurück, sie musste etwas überprüfen. Ja, so war es: Dieser Mann, dieser Florian, der ihr gestern Blumendünger geschenkt hatte, dieser Mann hatte vorhin nicht das gelbe Zeichen des Wanderwegs fotografiert. Das Zeichen war aufgemalt auf ein Stück deutschen Weltkriegsbeton.
Marie griff sich an den Kopf. Sie war erschüttert. Sie hatte immer so gerne die Landschaft von hier oben aus gesehen – die Windungen des Flusses Aulne, der in die Bucht von Brest einmündete; die Hügelketten im Osten; die Küsten der Bucht von Douarnenez und von Crozon, die wie zwei gebogene Arme am Horizont aufeinander zustrebten, dazwischen das schimmernde Meer. Sie hatte das alles nie mit einem militärischen Blick angesehen, und es plötzlich zu tun, war ein Schock für sie.
Der noch größere Schock war aber die andere Erkenntnis. Marie fühlte sich schwach. Sie hatte gewusst, dass ihr Nachbar ein rücksichtsloser Klotz mit einem Protzauto war, der auf Blumen und Nachbarinnen keine Rücksicht nahm. Aber das hätte sie ihm doch nicht zugetraut. Pierre hatte Recht gehabt. Florian war kein gewöhnlicher Tourist. Er war in die Bretagne gekommen, um Nazi-Bunker zu fotografieren. Und wenn ein Deutscher das tat, und zwar derart begeistert, dann … war Florian selbst ein Nazi?! Dann war er wohl ein Nazi.
Sie hatte den Eindruck, sich setzen zu müssen; genau in dem Moment setzte er sich, und zwar in den Schatten eines Nazi-Mauerrests, und nun blätterte er in einem schwarzen Heft. Marie wollte gar nicht wissen, was das für ein Heft war! Und diesen Mann – Marie wurde von Schamgefühl überkommen –, diesen Mann hatte sie vorgestern, widerwillig immerhin, beinah sympathisch gefunden; aber nein, es war schlimmer: Bei der Berührung ihrer Finger hatte buchstäblich etwas zwischen ihnen gefunkt!
Sie machte auf dem Absatz kehrt und ging. Sie hatte keine Lust mehr auf wandern.
Vergeblich versuchte Florian sich vorzustellen, wie dieser Berg mit der sagenhaften Aussicht unter deutscher Besatzung ausgesehen hatte. Hier war seine Oma hingeschickt worden, um irgendeinem Offizier diese merkwürdig nichtssagende Nachricht des Obersts zu überbringen. Er holte die Kladde aus dem Rucksack hervor. Also noch einmal, wie war das alles gewesen? Da war die Passage, so hatte alles angefangen …
Marlene ist im Büro des Obersts, auf der Kommandantur. Sie ist überrascht, fast erschrocken darüber, dem hohen Befehlshaber gegenüberzustehen. Er ist noch nicht lange da, gerade eine knappe Woche. Vorher war er im Landesinneren gewesen, Kommandant auf Schloss Trévarez, eine zentrale Schaltstelle der deutschen Besatzung. Mehr weiß Marlene von ihm nicht. Was will er von ihr, einer einfachen Funkhelferin? Sie weiß nicht, was sie erwartet.
Der Oberst fragt, ob sie schon einmal auf dem Ménez-Hom war. Sie bejaht das. Er legt ein Couvert vor ihr auf den Tisch. Es ist versiegelt. Es enthalte eine Botschaft für Oberstleutnant Hähnel. Ob sie sich den Namen merken könne? Jawohl, das kann sie. Die Botschaft sei persönlich abzugeben, an den Oberstleutnant selbst. Der Oberst legt einen von ihm unterzeichneten Passierschein daneben. Er soll den Durchlass zu Hähnel garantieren.
Marlene nimmt beide Dokumente mit klopfendem Herzen an sich. Warum gerade sie? Doch Befehl ist Befehl.
Als sie zögernd stehenbleibt, will der Oberst wissen, ob sie noch Fragen habe. Ja. Wie soll sie auf den Berg kommen? Sie kann nicht fahren. Der Oberst ruft Leutnant Rosen herein. Rosens Blick streift sie, dann steht Rosen vor dem Oberst stramm. Dem verdankt sie also ihre Mission, ahnt Marlene. Als ob sie seine Bevorzugung wollen würde! Rosen erhält den Befehl, einen Fahrer und ein Fahrzeug bereitzustellen. Nach einigen Minuten erscheint er mit einem Jungen. Viel mehr als das ist der Kriegsgefangene nicht. Es ist der, der Marlene zugezwinkert hat, als sie vor Monaten in Telgruc ankam. Aus der Entfernung hat sie ihn seitdem hin und wieder gesehen.
Der Oberst hebt skeptisch die Augenbrauen. Aber Rosen sagt: »Das ist ein fixer Junge. Fährt jedes Fahrzeug, spricht Französisch und sogar etwas Deutsch. Stimmt’s, Erwin?«
»Jawohl«, sagt der Junge, der bestimmt nicht Erwin heißt, und seine Mundwinkel zucken. Macht er sich über Rosen lustig? Und das vor dem Oberst?
»Der Erwin ist zuverlässig«, betont Rosen, »der ist in seiner Gesinnung fast deutsch.«
»Breiz a tao?«, fragt der Oberst. Marlene hat von den bretonischen Nationalisten gehört, die für Hitler sind, weil sie glauben, der Führer überlasse ihnen nach dem Endsieg die Bretagne.
»Nein«, hebt Rosen an, aber …« Den Rest versteht Marlene nicht, weil Rosen sich zum Oberst beugt und flüstert.
Der Junge tut ganz unbeteiligt.
»Gut«, beschließt der Oberst.
Man hat ihnen einen Kübelwagen gegeben. Sie fahren langsam vom Hof, an einer Gruppe Soldaten vorbei. »He, Erwin«, ruft einer, »grüß deine Schwester von uns! Lad sie mal ein!« Die Soldaten lachen. Warum? Was ist mit seiner Schwester? Verstohlen sieht sie den Jungen an. Der beißt sich auf die Lippen.
Schweigend brausen sie die Landstraße entlang, als der Wind plötzlich da ist, urplötzlich. Kein Wind – ein Sturm! Wütende Böen rütteln am Wagen. Es ist, als hätte man das Licht ausgemacht. Sie hätten noch knappe zwei Stunden Tageslicht haben müssen, aber mit einem Mal ist es fast dunkel. Wie schnell die Wolken bleigrau geworden sind! Erste Tropfen fallen auf die Windschutzscheibe. Marlene fröstelt.
Der Junge lenkt den Kübelwagen konzentriert durch die Kurven. Der Weg steigt allmählich an. Dann erkennt Marlene die Kreuzung, an der sie links abbiegen müssen – die Straße zum Gipfel des Berges.
Sie haben mehr als die Hälfte des Weges geschafft, doch am liebsten würde Marlene umkehren. Das hier ist erst die Ruhe vor dem Sturm, ahnt sie, und jetzt schon fühlt sie sich in dem bebenden Wagen auf dem kahlen, einsamen Berg ungeschützt und verloren. Unsicher blickt sie zu dem Jungen hinüber, doch der sagt nichts. Er hat das Tempo gedrosselt, oder der Wagen kann nicht mehr schneller, denn der Sturm peitscht ihnen entgegen. Kiesel, Sand, die Zweige von Buschwerk schlagen prasselnd auf das Glas der Windschutzscheibe. Kann ein Kübelwagen von bloßem Wind fortgerissen werden, schießt es Marlene durch den Kopf?
Ein Blitz zuckt über den Himmel. Der Donnerschlag, der unmittelbar folgt, ist eine Explosion. Dann geht es los. Hagelkörner schlagen auf sie nieder, die Scheibenwischer stocken im Druck von zu viel Ansturm, die Atmosphäre ist fast schwarz um sie, mit orangefarbenen Schimmern, nur wenn die Blitze den Himmel überziehen, leuchtet fahl die karge Landschaft auf und das niedergedrückte Gras wird für Bruchteile von Sekunden grell sichtbar. Dann tut es einen Schlag, eine Bewegung vor ihnen, der Junge reißt den Lenker herum, der Wagen steht – was war das?! Der Junge öffnet die Tür des Fahrzeugs, der Wind reißt sie ihm aus der Hand, Hagelkörner springen in die Fahrerkabine, das Tosen ist noch lauter hörbar. Der Junge springt hinaus – Marlene folgt ihm. Der Sturm ergreift sie, sie fasst nach der Tür, die plötzlich auf sie zuschlägt, doch sie fühlt sich zur Seite gerissen. »Ça va?«, ruft der Junge. Dann zeigt er nach vorn: »Der Baum!«
Der Baumstamm liegt quer über der Straße. Ein bloßer Pfahl, ohne Äste, die Reste eines toten Baums. Wäre das Ding auf das Verdeck des Kübelwagens gefallen, sie hätten selbst tot sein können. Das ging noch einmal gut. Aber jetzt kommen sie hier nicht weiter.
Der Junge schiebt sie zurück in den Wagen. Mit Mühe gelingt es ihm, die Tür zu schließen. Jetzt sitzen sie fest, auf halber Höhe dieses entsetzlichen Berges, der der Hölle gleicht! Marlene hat Angst. So etwas hat sie noch nie erlebt, nicht für denkbar gehalten. Sie krallt die Hände in die Sitzbank, jedes Mal, wenn ein neuer Donnerschlag ihr die Ohren zerreißt. Der Wagen steht, aber er vibriert verdächtig, manchmal ruckt er so, dass sie denkt, nun reißt der Sturm sie fort in das Tal. Und dann, dieser Auftrag! Selbst wenn sie es könnte, sie darf nicht zurück. Sie muss ja nach da oben!
»Wir warten«, sagt der Junge und lächelt ihr zu. Zaghaft lächelt Marlene zurück.
Sie weiß nicht, wie lange sie schon da sitzen. Das Unwetter tobt mit unablässlicher Wucht. Nur hagelt es nicht mehr. Regenfluten stürzen auf sie herab. Blitze überziehen noch immer den Himmel, der nun komplett schwarz ist. Marlene hält sich noch immer mit beiden Händen am Sitz fest.
»Du hast Angst?«, fragt der Junge.
Sie sollte ihm das vertrauliche »Du« verweisen. Aber die Frage kam so freundlich. Marlene schießen Tränen in die Augen. Die Frage kam wie von einem Freund. »Ja«, sagt sie und wendet das Gesicht ab.
»Ça ira«, hört sie den Jungen sagen, »es wird gehen.«
»Ich hoffe, es wird bald weggehen«, versucht Marlene ein Wortspiel. Sie weiß nicht, ob der Bretone das versteht.
»Bald heißt bientôt, nicht wahr?«
Marlene bejaht das.
»Es wird bald weggehen«, behauptet der Junge. »Aber nicht sehr bald«, fügt er hinzu.
»Das dachte ich mir.«
Sie sitzen wieder eine lange Zeit schweigend. Marlene ist in ihren Gedanken zuhause, bei ihren Eltern, von denen sie seit Wochen nichts mehr gehört hat.
»Jetzt wird es bald weggehen«, verkündet der Junge nach einiger Zeit und reißt sie aus ihren Träumen.
Ach ja? Noch immer regnet es in Sturzbächen, es blitzt und donnert. Aber es stimmt, die Abstände dazwischen sind größer geworden, und der Kübelwagen ruckt nicht mehr so bedrohlich im Sturm.
»Nach oben?«, fragt der Junge.
»Ja, nach oben«, gibt Marlene entschlossen zurück.
»Auf einem anderen Weg«, sagt er.
»Gut«, stimmt sie zu. Ihr ist bewusst, dass der Erfolg ihrer Mission damit ganz von dem Jungen abhängt. Sie weiß nicht, wo sie sind und wie sie jemals den Gipfel erreichen sollen.
Der Junge dreht den Zündschlüssel. Nichts. Er versucht es noch einmal. Der Motor des Kübelwagens bleibt stumm. »Dame, ha!«, schimpft der Junge.
Marlene ist erschrocken. Nun hängen sie wirklich fest, in Nacht und Einöde. Sie friert und ist hungrig. Und sie hat einen Auftrag. »Was machen wir?«, rutscht es ihr heraus. Sie schämt sich, sie weiß, sie sollte Befehle erteilen.
»Warte«, sagt er und springt hinaus, in das verregnete Chaos. Marlene reißt ihre Tür auf. »Wo willst du hin?«, schreit sie, sie kann
ihn nicht sehen.
»Warte im Auto«, hört sie ihn, dann nichts mehr. Marlene schließt die Wagentür. Jetzt ist sie allein.
Marlene hat sich auf dem Sitz zusammengerollt, die hochgezogenen Knie hält sie zwischen den Armen. Sie hat einmal versucht, aus dem Wagen zu steigen und zu Fuß Richtung Gipfel zu gehen, aber sie musste nach wenigen Metern zurück in den Schutz des Wageninneren. Sie weiß nicht, ob der Junge zurückkehren wird. Wahrscheinlich nicht. Warum sollte er? Es ist seine Chance, der Kriegsgefangenschaft zu entfliehen.
Obwohl sie steif vor Kälte ist, nickt sie ein. Ein Geräusch bringt sie zu sich – das Geräusch eines Motors. Sie rappelt sich auf, öffnet die Tür. Ein gelbliches Licht ist hinter dem Wagen aufgetaucht – der Scheinwerfer eines Motorrads
»Tu viens?«, ruft der Junge.
Während sie ungelenk aus dem Laster klettert, fragt Marlene sich, wo er das Motorrad herhat. Nun hat er es gewendet. Sie steigt hinter ihm auf. Sie ist noch nie Motorrad gefahren. Zögernd legt sie die Arme um ihn. Dann ruckt es, als er Gas gibt, und sie drückt sich fester an ihn.
Er fährt nicht schnell, trotzdem reißt die Luft an ihnen, es ist noch genug von den stürmischen Windböen da. Der Regen peitscht ihr in das Gesicht, sie drückt den Kopf auf die Schulter des Jungen. Sie fahren bergab. »Wir müssen hoch«, ruft sie ihm ins Ohr.
»Je sais«, ruft er zurück.
Sie legt das Gesicht wieder auf die schützende Schulter. Sie gleiten durch Nacht und Regen. Es fühlt sich nach Gefahr an, aber es ist kein nur schreckliches Kribbeln. Bis sie von der Straße abbiegen. Plötzlich hüpft das Motorrad, sie fahren über Erde und Stein. Das Hinterrad rutscht manchmal kurz weg, auf dem nassen und unebenen Boden, Marlene muss sich mit aller Kraft ihrer taub werdenden Hände am Jungen festhalten, um nicht vom Beifahrersitz zu gleiten. Lange wird sie diese Fahrweise nicht mehr aushalten. Doch sie fahren bergauf – es kann nicht mehr weit sein?
Ein Donnerschlag lässt sie zusammenzucken. Marlene fällt auf, wie lange nur noch das Prasseln des Regens und das Rattern des Motors zu hören gewesen waren, sonst nichts mehr. Wo kommt der Donner erneut her? Ein Netzwerk von Blitzen überspannt den Himmel. Sie sieht eine Mondlandschaft um sich, ohne Bäume, hier und da weiße Formen, Gestein. Der Junge flucht, stoppt das Motorrad. »Ça recommence«, stellt er fest.
Es geht wieder los, ja, Marlene sieht es. Das Motorrad steht, mit laufendem Motor.
»Ist es noch weit?« schreit Marlene, um den Donner zu übertönen. Aber in dem Moment weiß sie schon selbst, dass der Gipfel des Berges zu weit unter diesen Umständen ist.
»Nach unten! Wir müssen!«, hört sie den Jungen.
»Ja«, ruft sie. Und dann geht es wieder los. Der Wind ist kein Wind mehr, er nimmt ihnen den Atem, der Junge hat Mühe, das Motorrad auf seiner Spur zu halten, sie rasen bergab, der Junge bremst nicht, er weiß, es ist ein Wettlauf mit der Zeit, das Unwetter wird schlimmer werden! Es ist ein Sturzflug, Marlene hat Panik, zigmal meint sie, sie stürzen, aber es geht immer weiter, sie springen über etwas, das im Weg lag, das Motorrad kommt schlingernd wieder auf, und weiter, nach unten, immer weiter, nur geben Marlenes jetzt taube Hände nach, sie spürt es … Der Junge schreit etwas, sie kann ihn nicht verstehen, aber es wirkt: Sie nimmt sich zusammen, drückt ihre Finger, die sie nicht mehr fühlt, um den Körper zusammen, an den sie sich festhält, der ihr einziger Halt ist.
Dann rollen sie plötzlich über Asphalt. Das Motorrad beschleunigt. Die Hoffnung gibt Marlene neue Energie. Sie spannt den schmerzenden Körper an, das Motorrad jagt einen Hügel hinauf, sie rollen langsamer, dann an einer Mauer vorbei auf weichen Untergrund. Die Räder drehen durch, lassen Schlamm auffliegen, dann greifen sie, und langsam schlingern sie auf ein Gebäude zu. Sie halten an der Wand der Kirche.
Mit zittrigen Beinen steigt Marlene ab. Fast sinkt sie zu Boden. Sie ist am Ende. Sie lehnt sich an die Kirchenwand, neben das Motorrad. Der Junge nimmt sie am Ellenbogen, zieht sie mit sich. Sie gehen immer an der Kirchenwand entlang, dann stoßen sie auf ein Portal. Der Junge drückt die schwere Klinke, zu Marlenes Überraschung schwingt das Portal auf. Sie treten ein.
Es riecht muffig. Die Kälte ist nicht geringer als draußen. Doch es ist trocken hier, und das Tosen des Unwetters dringt nur gedämpft durch die dicken Mauern.
Der Junge bewegt sich sicher durch den finsteren Raum, springt über etwas hinweg. Dann ein Zischen, eine Flamme. Das Zündholz erlischt, doch wird sein kleines flackerndes Licht durch das warme, größere einer Öllampe ersetzt. Wo kommt sie her? Der Junge steht hinter einer Balustrade. Er steht in einem hellen Glanz, der nicht nur von der Lampe herkommt. Marlene staunt. Sie tritt näher an die Balustrade heran. Goldgeflimmer überall, Augen, die über sie hinweg in die Kirche schauen, dramatische Gesten, rote und blaue und gelbe Gewänder – es sind nur die Statuen von einem Altaraufbau, aber der erstreckt sich über den Lichtschein der Öllampe hinaus über die ganze Rückwand der Kirche.
»Voilà«, der Junge reicht ihr etwas über die Balustrade, es ist weich, eine Decke. Marlene legt sie sich ungelenk um. »Komm«, fordert der Junge sie auf und leuchtet ihr den Weg bis zum Altar, wo die Balustrade sich öffnet. Marlene scheut sich ein wenig davor, den Altarbereich zu betreten, aber der Junge nimmt sie an der Hand und zieht sie zu sich. Er stellt die Öllampe auf den Boden und macht Marlene Zeichen, sich zu setzen. Dann lässt er sich neben sie fallen.
»Die Schuhe«, sagt er schlotternd und zieht seine Schuhe aus. Marlenes Finger sind taub. Der Junge muss ihr helfen, ihre durchnässten Schuhe auszuziehen. »Die Jacke«, sagt er dann mit klappernden Zähnen. Er zieht seine aus und hängt sie über die Balustrade, dann die von Marlene. Der Junge wickelt sie fest in ihre Decke. »Le reste séchera«, versichert er.
»Ich glaube nicht, dass hier etwas trocknet«, antwortet Marlene, deren Zähne ebenfalls klappern.
»Tu parles français?«, bringt der Junge heraus.
»Ein wenig.«
Sie schweigen, lauschen dem Gewitter da draußen und dem Klappern ihrer Zähne. Die Decke tut gut, aber sie reicht nicht aus. Und der Junge hat gar keine.
»Tu as froid?«, bringt er nach einer Weile schlotternd hervor.
»Weniger als du«, sagt Marlene. Sie wickelt sich aus ihrer Decke und reicht ihm einen Teil. Er rückt näher an sie heran und sie legen die Decke um sie beide. Es ist das erste Mal, dass Marlene einem Jungen so nah ist. Sie berührt aus Versehen seine Hand, sie ist eiskalt. Nach und nach hört Marlene auf zu zittern und die Erschöpfung überwältigt sie. Im Halbschlaf lässt sie sich fallen, gegen den Jungen, wie sie noch restweise wahrnimmt. Er fühlt sich angenehm warm an.
Ein Lichtschein dringt durch ihre geschlossenen Augen. Blinzelnd versucht Marlene zu erkennen, was los ist. Jemand leuchtet ihr in das Gesicht. Der Junge brummt wie ein verschlafenes Kind, das nicht geweckt werden will. Dann plötzlich ist er doch wach, springt auf, verfängt sich in der Decke. Er sagt etwas zu der Person mit der Lampe. Die Worte kann Marlene nicht verstehen, sie sind bretonisch. Aber die Stimme des Jungen klingt erleichtert. Er kennt den Eindringling offenbar.
Leise stellt der dem Jungen knappe Fragen. Er leuchtet ihr erneut voll in das Gesicht. Marlene dreht sich fort. Sie versteht: Der Fremde will wissen, was sie hier zu suchen hat. Wer ist das? Was macht er hier, mitten in der Nacht? Will auch er sich vor dem Unwetter schützen? Was machte er dann da draußen? So lange nach Sperrstunde! Wer schleicht nach der Sperrstunde noch herum, wenn nicht …? Diese Decke und diese Öllampe in der einsamen Kapelle, die nicht abgeschlossen war. Marlene drückt sich mit dem Rücken an die Balustrade, an der sie lehnt, intuitiv zieht sie die Decke um sich zusammen. Weglaufen würde nicht helfen. Wohin sollte sie? Sie meint, in der Hand des Mannes, die er in seiner Jackentasche hält, etwas Eckiges, Großes zu erkennen – eine Waffe. Es ist kein Problem für den Fremden, sie auf der Stelle zu töten. Niemand sieht es, niemand hört es. Marlene schaut flehentlich zu dem Jungen.
Überraschend ruhig antwortet der dem Fremden. Ist seine Ruhe nur vorgetäuscht? Marlene weiß es nicht, aber sie fühlt sich selbst ein wenig ruhiger. Sie beobachtet den Mann, dessen Züge sie, noch immer geblendet von der Lampe, nicht ausmachen kann. Doch auch er hat aufgehört mit seinen brüsken Schritten vor und zurück, mit seinen zackigen Gesten. Er hört den Erklärungen des Jungen zu, den Rechtfertigungen, warum sie, Marlene, hier ist. Ihr Herz pocht wild. Der Mann ist noch nicht zufrieden mit den Erklärungen, seinerseits hebt er zu einer Rede an, es klingt wie ein Sermon, er liest dem Jungen die Leviten, aber nicht mehr so böse, mehr wie ein großer Bruder den kleinen zurechtweist. Der Junge hört sich alles an, dann sagt er wieder ein paar Sätze in diesem Tonfall, der eine so große Ruhe ausstrahlt.
Der Fremde senkt den Kopf. Jetzt wird über sie gerichtet, weiß Marlene. Noch kann sie aufspringen, durch die dunkle Kapelle rennen, sich zumindest nicht wie ein zusammengekauertes Kaninchen erschießen lassen. Sie fängt einen Blick des Jungen auf. Hat er ihr zugezwinkert?
Der Mann brummt etwas vor sich hin und boxt den Jungen gegen die Schulter. Der legt dem Mann einen Arm um den Hals. Der Mann gibt ihm einen Klaps auf den Hinterkopf. Dann stellt er ihre Öllampe ab und geht. Marlene sieht ihm nach, wie er im Dunkeln außerhalb des Lichtkegels verschwindet. Sie kann es kaum fassen. Da dreht sich der Fremde noch einmal um und sagt etwas, das ermahnend klingt, trotz allem bedrohlich. Marlene will, dass er endlich weggeht! Das Kirchenportal schlägt zu. Danke, lieber Gott. Sie ist nicht besonders gläubig, aber sie wiederholt innerlich ihr Stoßgebet.
Der Junge setzt sich neben sie, sie reicht ihm seinen Teil der Decke und er legt ihn wortlos um sich. Er lächelt ihr zu. »Alles gut«, sagt er. Ja, sie weiß das. Sie hat keine Scheu mehr davor, sich an ihn zu lehnen, den Kopf an seine Schulter. Sie schließt die Augen und schläft wieder ein.
Sie wacht auf, weil etwas fehlt. Seine Wärme, sein Geruch. Marlene schaut um sich. Dämmerlicht erfüllt die Kapelle. Sie steht auf, er ist fort. Ja, fort, seine Jacke und Schuhe liegen nicht mehr an ihrem Platz. Natürlich, jetzt endlich hat er die Gelegenheit ergriffen zu fliehen.
Marlene zieht ihrerseits Jacke und Schuhe an. Alles noch klamm, aber nicht mehr triefend. Sie tritt vor die Kapelle. Die Sonne steht noch niedrig, ein leichter Dunst liegt über der Erde. Aber regnen tut es nicht mehr. Es riecht nach Feuchtigkeit und Laub – zum ersten Mal riecht es nach Herbst, nach Oktober. Marlene wandelt von der Kirche fort, um sich einen versteckten Ort für ihr Bedürfnis zu suchen und die steifen Glieder zu bewegen. Sie geht einmal um die Kapelle herum. An der Frontseite, am Rande der Landstraße, steht der Junge neben dem Motorrad, dessen Sitze er mit dem Ärmel abwischt. »On y va?«
Marlene strahlt ihn an. Sie kann nicht anders.
Sie besteigen das Motorrad und brausen los. Das Wasser der nassen Straße spritzt unter ihren Reifen. Sie sehen den Sonnenaufgang nicht, die Sonne ist ihnen im Rücken. Aber sie sehen ihren eigenen langen Schatten, der vor ihnen her huscht. Und sie sehen das Licht der Sonne. Sie fahren aus dem Dunst heraus, und die Sonne färbt die Landschaft vor ihnen goldgelb. Es ist ein lebendiges Goldgelb, nicht das feierliche, verfallend-alte des Altaraufbaus in der Kirche. Das goldgelbe Licht tönt die Farne, die Büsche, die Bäume, die weiten Wiesen um sie herum noch grüner. Der gelbe Stechginster am Straßenrand glüht ihnen entgegen, rauscht an ihnen vorbei, liegt schon wieder hinter ihnen. Goldgelb glänzend erstreckt sich zu ihrer Linken das Meer.
Sie rasen die Straße entlang, bergauf, bergab, neigen sich in die Kurven, Marlene fühlt sich schwerelos, frei wie eine Möwe. Sie möchte auch schreien wie eine Möwe, aber sie tut es nicht. Sie legt ihren Kopf auf seiner Schulter ab, nur noch einmal. Sie wünscht, dieser Augenblick möge nie zuendegehen.
Das Motorrad verlangsamt, als Telgruc vor ihnen auftaucht. Der Junge hält an. Marlene begreift. Sie steigt ab. Jetzt ist der Moment des Abschieds gekommen. Sie weiß nicht, was sie empfinden soll. Sie ist wie ein Seemann, der wieder festen Boden unter den Füßen hat, fühlt noch den Rausch dieser einzigartigen Fahrt. Aber da sind noch die anderen Gefühle … Sie steht neben ihm, sie sehen sich an, keiner sagt etwas. Dann grinst er plötzlich und fragt: »Comment t’appelles-tu?«
Marlene nennt ihren Namen. Er nennt auch seinen. Sie versteht ihn nicht. Er sagt ihn noch einmal. Marlene wiederholt ihn. Er nickt. Dann wendet er das Motorrad auf der nassen, goldglänzenden Landstraße und rast davon, der Sonne entgegen.
Marlene schaut ihm nach, bis er verschwunden ist.
Wenn die Botschaft nicht gewesen wäre, wäre das alles nicht passiert. Die Botschaft. Marlene holt das Couvert hervor. Es ist feucht, das Siegel hat sich gelöst. Marlene zögert. Sie ist vollkommen allein, niemand sieht sie. Sie will wissen, wofür das alles gut war. Behutsam zieht sie das zusammengefaltete Blatt hervor. Es ist kaum mehr als eine Notiz. Die Tinte ist großteils verlaufen, aber die Schrift ist noch lesbar: »Lieber Hähnel, herzlichen Dank bezüglich Ave Maria! Alles gut angekommen. Deine Kiste Champagner erwartet Dich.« Gruß und Unterschrift. Das war es. Mehr nicht.
Marlene faltet das Blatt wieder zusammen, schiebt es in das Couvert zurück. Dafür also. Dafür also?! Dafür die Stunden des Frierens und Hungerns, sie kann kaum mehr stehen vor Hunger und kaum mehr denken! Dafür die Stunden der Angst, vor dem Unwetter, vor dem Fremden in der Kapelle! Dafür – ja dafür auch alles andere …
Marlene geht los. Aber sie geht langsam. Vielleicht wird sie noch mehr Ärger bekommen, je später sie meldet, dass sie ihre Mission nicht erfüllt hat. Wobei sie nicht glaubt, dass die Sache in irgendeiner Weise wichtig war oder eilig. So oder so. Sie will, dass er einen Vorsprung hat, wenn sie anfangen, ihn zu suchen.
Florian ließ die Kladde sinken. Wer war er gewesen, der junge Kerl? Aber er konnte verstehen, warum seine Oma nie seinen Namen notiert hatte. Wie sicher war so ein Tagebuch damals gewesen, in dieser Zeit, in der so viele Nazi-Deutsche ihre Nachbarn, Kollegen, Freunde und Familienangehörigen ausspionierten? Dass sie seinen Namen nicht verraten hatte, war also verständlich; noch immer nicht verstehen konnte Florian aber, was damals weiter geschehen war.
Denn als Marlene später am Tag mit dem Oberst von der Kapelle zurückgekommen war, hatte der Kübelwagen, den sie auf dem Berg gelassen hatten, im Hof der Kommandantur gestanden, und daneben – er selbst, der Junge. Er war zurückgekommen, war nicht geflohen. Stand da, als hätte er nichts Besseres zu tun, als heimlich Marlene zuzuzwinkern – genau das hatte er nämlich getan. Also, Mut hatte der junge Mann gehabt, aber ein bisschen blöd war er wohl auch gewesen, sich so eine Chance entgehen zu lassen. Und seine Oma? War hin- und hergerissen gewesen, zwischen Erleichterung, Fassungslosigkeit und … unsinniger Freude.
Ach Oma. Was für eine schreckliche Zeit. Und wie konntest du das nur aufschreiben? Name hin, Name her, wenn dir jemand Böses gewollt hätte, wäre so eine Geschichte auch so kompromittierend genug gewesen! Seine Oma …
Bestürzt und nachdenklich schob Florian die Kladde tief in den Rucksack. Seine Hand stieß dabei an das Handy. Mechanisch zog er es heraus. Keine Nachrichten, von niemandem. Dabei musste Boris heute den Karmann Ghia aus der Werkstatt abholen. Es war Zeit, ihn zu kontaktieren; später. Aber jetzt … Er konnte nicht anders, er musste anrufen … Natürlich ging niemand dran. Aber nach dem sechsten Freizeichen kam das Klicken des Anrufbeantworters, und dann: »Dies ist der Anschluss von Katharina und Florian Reinart. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, wir rufen gerne zurück.«
Florian drückte schnell den Knopf mit dem roten Hörerzeichen. Er wollte keine Nachricht hinterlassen. Er wollte nur Katharinas Stimme hören; sie hatte das Band besprochen. Er wählte seine Nummer noch einmal.