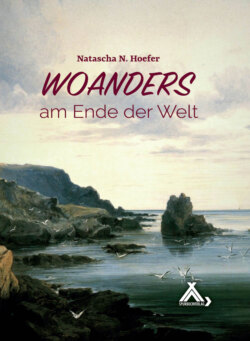Читать книгу Woanders am Ende der Welt - Natascha N. Hoefer - Страница 7
Оглавление1. Neuanfang
Marie stand auf, sah sich in ihrem Behandlungsraum noch einmal um. Sie hatte aufgeräumt, mit persönlichen Dingen den Raum ohnehin nie überfrachtet. Undenkbar, jetzt einfach hier fortzugehen, schoss es ihr durch den Kopf! Und prompt musste sie an ihre Patienten denken – Noirot, der scheue Kater, der sich nur von ihr berühren ließ … Der alte Milou, der immer knochiger wurde, immer blinder und schwerhöriger; aber wie er sich freute, sie an ihrem Geruch zu erkennen, wenn er kam, damit sie mit ihm seine Ergotherapie machte … Milou und Noirot, sie waren angemeldet für morgen, aber sie würde morgen nicht da sein, wie sollte es gehen ohne sie? – Sie musste sich auf den Schreibtisch aufstützen, weil ihr plötzlich die Kraft fehlte. Sie liebte ihre Patienten, sie liebte ihren Job als Veterinärin! Und jetzt musste sie das alles aufgeben, weil es ja doch so nicht weitergehen konnte, nein, es ging nicht länger!
Entschlossen raffte Marie sich auf, verließ das Zimmer. Doch schon im Flur knickte sie wieder ein, verschwand in der Toilette, anstatt direkt bei Sylvain reinzugehen. »Zieh es durch, Marie«, beschwor sie ihr Spiegelbild über dem kleinen Waschbecken. Und doch kam er hoch, der Schwall der Erinnerung.
Der Tag ihres Vorstellungsgespräches. Sie war hier drin gewesen, um sich kurz frischzumachen. Der Mann, dem sie beim Verlassen des Toilettenraums die Tür fast ins Gesicht gerammt hätte. Seine braunen Augen, dieser Blick, voller Bewunderung, aber zugleich voller spitzbübischer Galanterie. Komplizenhaft hatten sie sich zugelächelt. Als hätten sie es beide vom ersten Moment an gewusst.
Sie hatte den Job bekommen, natürlich, war jetzt seine Kollegin (und Ludovics; aber der war nur ein harmloser Kollege, der sich aus ihrer ganzen Geschichte dezent raushielt). Ihr erstes Röntgen also; Patient: Brutus, ein humpelnder und gereizter Rottweiler-Dogge-Mischling.
»Wie viel wiegt der Kerl?« (Frage vom erfahrenen Doktor Sylvain an die junge Novizin.)
»Keine Ahnung, nicht so wichtig.« (Keck zurück.)
»Wie wollen Sie ihn dann zum Röntgen narkotisieren, Mademoiselle Cadiou?« (Mit charmantem Lächeln.)
»Gar nicht, Monsieur Cozic.« (Lächelnd zurück.)
»Was soll das heißen, gar nicht?« (Zu perplex bis hin zu beunruhigt, um weiterzulächeln.)
»Vertrauen Sie mir nicht? Sie haben mich doch eingestellt …« Und Sylvain hatte zugesehen, wie sie es gemacht hatte: Beruhigung des Tiers durch Zureden und Akupressur, d.h. Massieren bestimmter Druckpunkte – et voilà. Ruhig und brav auf den Röntgentisch, und zack, schon gab es die schönsten Aufnahmen. Danach hatte Sylvain sie nur noch »die Hundeflüsterin« genannt. Und ihr später, sehr viel später gestanden, er habe seit dem Tag, an dem er ihre zarten Finger Brutus’ Nacken und Rückgrat massieren sah, davon geträumt, wie es wäre, selbst von ihr so berührt zu werden …
Ja, berührt hatten sie sich, und es war unglaublich gewesen.
Jener verhängnisvolle Abend, drei Jahre später – volle drei Jahre hatten sie es platonisch miteinander ausgehalten! Aber dann. Vorgeblich hatten sie beide geglaubt, die unliebsame Bereitschaftsschicht zu Heiligabend zu haben. Marie hatte sehr gut gewusst, dass nur sie sie gehabt hatte. Er war trotzdem aufgetaucht. Und dann … sie hatten die Kontrolle verloren. Der Anfang von etwas … Unbeschreiblichem. Sie hatte nicht gewusst, dass zwei Menschen sich wirklich derart verfallen konnten; wirklich, nicht nur in Büchern oder in Filmen!
Sylvain, zu den unmöglichsten Uhrzeiten vor ihrer Wohnungstür.
»Du bist da – mein Gott, Marie, tut es gut, dich zu sehen. Komm her!« Seine Umarmungen, seine Liebkosungen. Als ob sie der Rettungsanker seines Lebens wäre. Aber sie, jedes Mal, mit flatterndem Herzen: »Wie viel Zeit hast du?« »Eine Stunde; die Kinder sind im Musikunterricht …« »Béatrice ist mit den Kindern bei ihren Eltern – Marie, wir haben ein Wochenende für uns!« »Sie ist beim Yoga, die Kinder sind bei Freunden – bestimmt anderthalb Stunden noch …« Geraubte Augenblicke – wie schön das klingt! Aber das reicht nicht für ein Leben!
»Schluss damit!«, zischte Marie ihrem Spiegelbild zu. »Schluss mit dem ewigen Warten und Hoffen! Ich kann nicht mehr! Es ist genug! Du weißt es, Marie, du weißt es! Die Kinder sind ausgewachsene Teenager inzwischen, und er hat nicht vor, sein Versprechen einzulösen! Er wird nie zu dir stehen, er hat keinen Mumm! Was er hat, Familie und Geliebte all inclusive, das will er nicht verlieren – aber wenn er seine Familie nicht verlieren will, verliert er zuletzt eben mich … Ist auch überfällig, verdammt!«
Marie drehte heftig den Wasserhahn auf, trank einen Schluck aus der zitternden Hand und verließ die Toilette.
»Hey, du bist da?« Sylvain strahlte sie an und sprang vom Rechner auf.
»Ich bin schon seit drei Tagen wieder zurück aus Paris.«
»Ich weiß; und ich wollte die ganze Zeit schon mit dir reden – nur, diese Woche war für mich extrem schwierig. Béatrice war krank – bzw., sie ist es immer noch; schwere Erkältung, da musste ich pünktlich heim, und sie rief hier dauernd an, weil ich ihr noch Medizin und so mitbringen sollte …«
Marie verschränkte die Arme.
»Aber ich hatte so sehr darauf gehofft, heute Abend einen ruhigen Moment mit dir zu haben. Wie war es also auf dieser Beerdigung? Deine Tante war das, nicht wahr?«
»Meine Großtante, Elodie, die Schwester meines Großvaters Erwann!«, empörte sich Marie nun doch wider Willen. Sie hatte ruhig bleiben wollen, aber erst die übliche Béatrice-Leier, und dann hatte er sich nicht einmal gemerkt, wer Elodie war!!
»Großtante Elodie – sollte ich die kennen?«, fragte Sylvain jetzt auch noch arglos. Aber dann schob er rasch nach: »Hör zu, mein herzliches Beileid natürlich, und jetzt erinnere ich mich, klar: Großtante Elodie aus Paris; das war die Modemacherin, die du mal im Altenheim besucht hast, oder?«
Marie nickte, sie konnte nicht reden, wischte sich stumm die Tränen weg.
Sylvain wollte sie in den Arm nehmen. »Ich wusste nicht, dass du ihr so nahe … Komm her, lass dich trösten.«
»Lass dich trösten – als ob das so einfach wäre!«, platzte es aus Marie heraus und sie stieß ihn weg. »Weißt du, wie ich mich auf dem Friedhof gefühlt habe? Vor ihrer Urnenwand – es war nicht mal ein echtes Grab, nur eine Urnenwand! Und sie hätte in der Bretagne beerdigt werden sollen, sie war Bretonin! Sie hat die Bretagne geliebt, diese ganze blöde Zeremonie in Paris war ganz falsch!«
»Mein armer Schatz. Warum hast du mir das nicht vorher erzählt?«
»Das hast du mir doch gerade erklärt – Béatrice hin, schwere Erkältung her! Du warst nicht sprechbereit. Aber diesmal stecke ich das nicht mehr weg, Sylvain. Vor Elodies Urne ist mir etwas klar geworden. Ein menschliches Leben ist zu kurz, um es mit so etwas wie unserer Affäre zu verschwenden.«
»Du weißt sehr gut, dass das zwischen uns mehr als eine Affäre ist.« Sylvain war blass geworden.
»Ich stand allein vor Elodies Urne. Natürlich, meine Familie war auch da; aber ich fühlte mich allein, auf mich zurückgeworfen. Ohne einen Lebensgefährten, der mit mir mitfühlen und dessen Liebe mich in meiner Trauer stützen würde.«
»Ich fühle mit dir mit. Immer. Jetzt.«
»Aber du warst nicht da! Niemand aus meiner Familie hat dich jemals gesehen. Niemand weiß von dir. Niemand von deiner Familie weiß von mir – natürlich nicht! Wir sind in niemandes Augen ein Paar, wir sind Schatten im Leben des anderen. Ich hätte dich gebraucht, bei dieser Bestattung, nicht als Schatten, sondern ganz real neben mir. Aber du warst nicht da.«
Sylvain blähte die Backen auf, rang die Hände.
»Und sag jetzt bitte nichts. Erneuere keine Versprechen, die du nicht halten willst. Du willst deine Frau in Wahrheit nicht verlassen. Jetzt sagst du, weil die Kinder noch da sind; aber wenn die einmal ausgezogen sind, wirst du sagen, du kannst Béatrice erst recht nicht allein lassen.«
»Marie, das…«
»Nein, ich bin noch nicht fertig!« Sie holte Atem. »Ich habe Elodies Haus und eine gewisse Summe geerbt. Damit kann ich mir meine Freiheit leisten. Es ist aus zwischen uns. Ich gehe fort aus Brest. Es tut mir leid, enorm leid für die Praxis. Aber es geht nicht anders.«
»Gehen? Was soll das heißen, wohin willst du denn gehen?«
»Nach Mengleuff. Das ist auf Crozon.«
Sylvain schloss langsam die Augen, blinzelte, als wolle er aus einem Alptraum erwachen. »Marie, ich – ich kann nicht aufhören, dich zu lieben.«
Marie wandte sich ab und ging.
Wenn er sie aufhalten, wenn er sie an sich reißen, wenn er sich jetzt entscheiden würde, für sie! Aber er tat es nicht.
Marie startete den Wagen. Minuten lang hatte sie nur dagesessen und gehofft, inbrünstig gehofft, er würde noch kommen – darum kämpfen, sie nicht zu verlieren! Nicht einmal das.
In fiebriger Hast verließ sie das Zentrum der Großstadt, fuhr auf die Schnellstraße Richtung Quimper auf, zwang sich, wegen der Radarkontrollen nicht schneller als hundertzehn zu fahren.
Wie lange war sie nicht mehr in Mengleuff gewesen? An Elodies vierundachtzigstem Geburtstag, vor zehn Jahren, hatte diese verkündet, sie sei zu alt, um in die Bretagne zu fahren. Damit hatten Maries sommerliche Besuche bei ihrer Großtante aufgehört. Aber einmal noch war sie vor ein paar Jahren nach Mengleuff gefahren, um von außen das vereinsamte Haus ihrer Vorfahren zu sehen und sich in den verwilderten Garten zu schleichen, das Paradies ihrer Kindheit … Doch es hatte zu wehgetan, das Verwildern und den Verfall mitanzusehen und sich dabei zu sagen: Elodie wird nie mehr kommen; nie mehr, weil sie in einem Altenheim in Paris sitzt … und dort sitzen wird bis zu ihrem Tod.
Da war sie endlich, die Ausfahrt nach Châteaulin – auch hier war Marie ewig nicht mehr gewesen. Sie überquerte das Stadtzentrum und den breiten Fluss Aulne über die einstige Eisenbahnbrücke, verließ Châteaulin über die Weststadt wieder und bald wurde die Landschaft um sie wilder, rauer. Die Landstraße stieg an, um seitlich am Berg Ménez-Hom vorbeizuführen; dahinter erstreckte sich die Halbinsel Crozon, und dann dauerte es nicht mehr lange und Marie fuhr durch Telgruc, an der Dorfkirche vorbei, und dann Richtung Meer … Endlich kam der unscheinbare Abzweig, der rechts in die Senke hinunterführte und dann wieder hinauf, zu dem winzigen Dorf, das Mengleuff war. Marie holperte über den Feldweg, der ringförmig um den Dorfkern führte, und da lag es, das Haus. Elodies Haus – nein, ihres.
Sie verlangsamte, ließ den Blick über das alte Gemäuer aus Feldstein schweifen, hielt aber noch nicht an. Der Weg vor dem Haus war zum Parken zu eng. Sie fuhr um die nächste Kurve und hielt dort am Rand eines Feldes. Alles wie früher, stellte sie fest. Es gab ihr ein unerwartetes Gefühl der Ruhe.
Ohne Hast nahm sie den Schlüssel ihres Hauses aus dem Handschuhfach und stieg aus. Schwalben sirrten um sie herum, sie hörte die Schreie der Möwen, die höher als die Schwalben flogen. Das Brummen eines entfernten Traktors drang an ihr Ohr. In der Nähe zirpten Grillen. Sonst war es still.
Sie ging am Hof des Nachbarhauses vorbei und warf einen Blick hinüber. Das Haus stand leer, war in schlechtem Zustand. Dann wandte sie sich – und ihr Herz klopfte dabei – ihrem eigenen Haus zu. Kaum zu glauben, sie hatte ein Haus! Sie hatte nie zu hoffen gewagt, sich von ihrem kargen Einkommen ein Haus leisten zu können; aber dass Elodie an sie, Marie, gedacht hatte, dass sie selbst, Marie Cadiou, das alte Haus ihrer Vorfahren bewohnen würde …
Und es sah gar nicht so heruntergekommen aus, wie sie es befürchtet hatte. Der allgegenwärtige Efeu musste regelmäßig beschnitten worden sein, auch wenn das letzte Mal wohl ein Jahr her sein konnte, so wie das Grünzeug sich über die Regenrinne hinaus hochwand. Riesig geworden war das Hortensienmassiv, das um die rechte vordere Hausecke wuchs; aber leider war es vertrocknet. Oder doch nicht ganz? »Ich gieße euch gleich«, versprach Marie den Hortensien. Mit der Fingerspitze schabte sie ein Stück Farbe von einem geschlossenen Fensterladen. Blau, nicht mehr braun. Sie würde Tür und Läden blau streichen. Die duftenden Rosensträucher neben den Fenstern bogen sich weit über den Feldweg vor; sie mussten zurückgeschnitten werden, waren aber nicht vertrocknet. Marie sah nach oben. Das Schieferdach sah noch gut aus, zumindest auf dieser Seite des Hauses.
Sie steckte den Schlüssel in das alte Schloss und drehte. Die Tür schwang auf, ein Geruch nach Feuchtigkeit schlug Marie entgegen. Aber nicht so schlimm, wie sie befürchtet hatte. Wer auch immer den Efeu gebändigt hatte, er hatte hin und wieder gelüftet.
Im Halbdunkel tastete sie sich nacheinander zu den Fenstern, öffnete sie und schlug die Läden zurück. Ja, alles hier drinnen sah aus wie in ihrer Erinnerung, nur schien das Ganze geschrumpft zu sein. War dieser Raum, der Hauptraum des Hauses, schon immer so klein gewesen?
Sie ging in den Anbau mit dem Badezimmer, öffnete die Luke im Dach; ging dann über die Holztreppe nach oben. Ihr wurde bewusst, dass sie niemals im Obergeschoss gewesen war; Elodie hatte es nicht erlaubt. Gespannt drehte sie den Knauf der linken Tür. Ein eisernes Bettgestell und ein alter Schrank, sonst nichts. Aber aus den Erzählungen ihres Großvaters Erwann wusste sie, dass er und seine Brüder hier geschlafen hatten, vor … bald hundert Jahren, ja … Beklommen trat Marie ein, öffnete auch hier Fenster und Dachluke, sah sich noch einmal nach dem Bettgestell einer anderen Zeit und dem schweren Schrank um, verzichtete vorerst darauf hineinzusehen und betrat stattdessen den Raum rechts des Treppenabsatzes. Elodies Schlafzimmer.
Der alte Schrank hier war mit seinen Schnitzereien und der Spiegeltür schöner als der im Nebenraum; aber das kurze alte Bett unter dem Kruzifix an der Wand wollte Marie nicht gefallen; brrr, sie konnte sich nicht vorstellen, darin zu schlafen. Es war noch gemacht; es sah aus, als erwartete es Elodie – eine Tote …
Marie ging wieder nach unten. Da war es noch, das einstige Schrankbett. Das war einmal Elodies erstes Bett gewesen, als Kind hatte die Arme kein eigenes Zimmer gehabt. Und da – da war das Büffet mit dem alten Geschirr ihrer Vorfahren – und da – das indische Schränkchen… Marie trat darauf zu, strich flüchtig mit den Fingern darüber. Sie hinterließen eine Spur in der Staubschicht. Kurz zog sie einen Türflügel des kleinen Möbelstücks auf. Alle noch da, ihre Schätze. Als wäre die Zeit stehengeblieben…
Marie blinzelte. Für einen Moment war sie wieder das kleine Mädchen gewesen, das nach dem Crêpes-Essen mit den Dingen aus diesem Schrank spielen durfte. Sie drückte die Tür des Schränkchens wieder zu, ließ sich auf einen staubigen Stuhl fallen, stützte die Arme auf den hölzernen Esstisch auf und weinte.
Drei Stunden später hatte Marie Strom und Wasser in Betrieb genommen, einen Eimer aufgetrieben und die Hortensien begossen, altes Putzzeug gefunden und das Hausinnere gereinigt, bis sie es einigermaßen hygienisch fand. Jetzt fühlte sie sich zermalmt von den Ereignissen des Tages. Aber sich auf Elodies altem Bett ausstrecken, konnte sie einfach nicht.
Sie holte Reisetasche, Schlafsack und Isomatte aus dem Auto und suchte das zugewucherte Heckenloch, durch das man vom Feldweg aus den Garten betrat. Ihren Garten. Sie bahnte sich einen Weg durch das hüfthohe Gras. Die Feldsteine an der Rückwand des Hauses fühlten sich unter ihren Händen noch warm an. Nahe der Wand trampelte Marie das hohe Gras nieder und breitete Isomatte und Schlafsack aus. Sie setzte sich in das Nest, das sie sich zwischen den hohen Grashalmen geschaffen hatte. Die Grillen zirpten jetzt neben ihr, das Gras duftete herb. Marie holte einen Apfel und eine Flasche Wasser aus ihrer Reisetasche. Langsam aß und trank sie. Mit der Dämmerung kam ein kühler Luftzug. Marie legte sich auf den Rücken und deckte sich halb mit dem Schlafsack zu.
Es war der vierzehnte Juni. Sie würde sich dieses Datum merken. Der Tag ihres Neuanfangs, in Mengleuff. Sie versuchte, ihren Kopf von allen Gedanken zu leeren. Sah zu, wie der Himmel über ihr sich allmählich dunkelblau färbte. Fledermäuse huschten über den Garten hinweg, eine Eule rief, hell traten die ersten Sterne vom klaren Himmel hervor. Irgendwann kroch Marie in ihren Schlafsack, drehte sich auf die Seite, zog die Knie an und schlief ein.