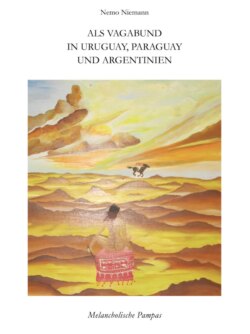Читать книгу Als Vagabund in Uruguay, Paraguay und Argentinien - Nemo Niemann - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 2
Tristeza gris – Graue Traurigkeit
Venedig bedeutet Kanäle, Gondolieren, Markusplatz, auch Metapher von Tod und Vergänglichkeit inmitten architektonischer Juwelen. Athen, auch wenn wir nie dort waren, heisst Akropolis, Omoniaplatz, vielleicht Perikles. Amsterdam verbinden wir mit Fahrrädern, gardinenlosen Fenstern, Grachten und de seuten dirns.
Aber Montevideo? Selbst spanische Freunde, Andalusier, deren Vorfahren bei der Eroberung, Besiedlung und Kolonisierung so zahlreich eine Rolle am Rio-de-la-Plata-Delta spielten, wissen spontan wenig prägnantes zu assozieren. Bestenfalls verwechseln sie es mit Buenos Aires und erinnern sich an Uruguays Weltmeisterschaftssieg im Fußball. Ja doch, die Gauchos! Viel Rindfleisch. Und Matétee trinken sie andauernd. Aber es ist ein armes Land! – Das, amigos, ist eine Frage, die auf dieser Reise auch beantwortet sein will.
Vor allem: Was heisst dort Armut?
Das erste, was dich bei der Ankunft auf dem kleinen Flughafen Carrasco trotz aller Müdigkeit anspringt, ist ein unübersehbares, prägnantes Schild mit der Aufschrift dengue. Und du hast dich nicht gegen dieses malariaähnliche Fieber impfen lassen, obwohl du davon gelesen hattest.
Gleich zwei Taxis hat N. für euch organisiert. Es sind Kleinwagen mit wenig Platz. Die Fahrer sind sorgsam durch Glas von den Fahrgästen getrennt und du sitzt gepresst wie ein polnisches Kochhuhn auf dem Hintersitz mit angezogenen Armen und Beinen. Wieviel romantischer wäre es doch gewesen, diese Hafenstadt vom Wasser aus zu betreten. Es hängt viel davon ab, von woher man das erste Mal eine Stadt betritt. Dieser Eindruck nämlich bleibt haften. Bei deiner ersten Reise vor der wirklichen Reise – mit dem Finger und Stift auf den Karten – hast du dir eingebildet, es werde leicht sein, sich in dem typisch spanischen Schachbrettmuster horizontaler und vertikaler Straßen in der 1,3 Millionenstadt zurechtzufinden. Aber hupend, nach links und rechts wedelnd, hetzen nun die beiden Taxis wie zwei wild gewordene, kläffende Hunde, echte galgos, auf Abkürzungen und Diagonalen durch die Stadtlandschaft. Du versuchst in der seltsam amorphen Architektur zu lesen. Unglaubliche Stilmischungen und verwirrende Kontraste wohlhabender, gediegener und verkommener Gebäude rauschen wie ein nervöser Videoclip vorbei. Nobles steht neben sachlich Nüchternem, Ungepflegtes neben Herausgeputztem, Hüttenähnliches neben Verfallenem. Gartenanlagen, die keinen Gärtner kennen, andere, die von mindestens drei Heinzelmännchen gehegt werden. Dazwischen immer wieder Baulücken und kariöse Ruinen. Ein urbaner Wildwuchs, den offenbar nur eine Norm zügelt: über ein Stockwerk geht es, bitte sehr, nicht hinaus! Es scheint einen Gestaltungswillen gegeben zu haben. Gleichzeitig erweckt alles den Eindruck, es sei etwas dazwischen gekommen, das diesen Willen gebrochen hat.
Dann hören die Gärten und großen Bäume am Straßenrand auf. Die kläffenden Taxihunde werden ruhiger und achten nun aufmerksam auf Schlaglöcher. Das Stadtviertel, durch das es nun geht, heisst Buceo. Auch hier geht es nicht über ein, zwei Stockwerke hinaus. Vorgärten sind selten oder winzig.
Der vorherrschende Farbton ist jetzt von grauem Verputz bestimmt. Eine leicht verhangene Morgensonne müht sich vergeblich, fröhlichere Farbtöne zu zaubern. Unerwartet springt das grelle Violett eines flachen Eckhauses ins Auge: ein Lebensmittelladen macht fröhlich auf sich aufmerksam. Gleich gegenüber kommen die gehetzten Hunde zur Ruhe, halten vor N.‘s Neuerwerbung, einem schmucklosen, soliden Flachbau mit kleinem Vorgarten und islamisch vergitterten Augen. Blassgrau, mit einem zagen Schuss Hellblau, passt es sich in das Graugrau der anderen Anlieger ein.
»Welcome home, mum!« sagt stolz die Tochter und führt M. behutsam die kleine Treppe hinauf ins Umzugschaos ihres erst vor einer Woche bezogenen neuen Heims. Kinderlärm. Gepäckaufbewahrung. Kaffeegeruch. Ein Begrüssungsweinchen. Reisebefindlichkeiten. Eine kleine Führung durch Haus und Hinterhofgarten: Farben! Ein knospender Advokadobaumriese. Ein blühender Feigenbaum neben einem spriessenden Zitronengewächs. Den grünen Rasen verschlingen Haufen von Bauschutt. M.‘s künftige Wohnstatt präsentiert sich als Skelett, das in den kommenden zwei Monaten neue Organe und frische Häute bekommen soll. T. fragt N. nach Preisen aus. Kaum angekommen, hat seine Recherche schon begonnen.
Warum gibt es hier so preiswerte Immobilien? Weil Uruguays Bevölkerung überaltert ist, junge Menschen keine Arbeit finden und migrieren, wenn sie können. Dann ein Satz, den ihr mehr als einmal hören werdet: »No hay plata en el Rio de la Plata.« Am Silberfluss gibt es kein Geld. Uruguays Zeiten als die »Schweiz Südamerikas« liegen weit zurück, sind Geschichte.
Noch einmal quetscht ihr euch an diesem Ankunftstag in Montevideo in ein enges Taxi. Gern hättet ihr den Fahrer angewiesen, den Weg zum Palacio Salvo im Stadtzentrum über die sieben Kilometer lange Promenade am »Meer« zu nehmen. Aber die Siesta ruft, Augen und Herz sind müde.
Je näher ihr ins Zentrum gelangt, umso grauer wird Montevideos Grau. Das Sonnenlicht bleibt fahl. Endlos zieht sich die Diagonale Fructuosa Rivera, eine der Hauptschlagadern der Stadt mit ihrem lebhaften Gemisch aus Wohnhäusern, Bars, Läden, Holzhändlern und fletes – Kleinspeditionen – hin. Man meint nie anzukommen.
Der erste Eindruck bleibt haften. Montevideo lebt mit einer Traurigkeit aus Grautönen.
Später, wieder daheim, findest du bei Uruguays bekanntesten literarischen Jornalisten, Eduardo Galeano, eine Erklärung. In dem gerade erschienen Buch Espejos (Spiegel), schreibt er: »Montevideo war nicht grau. Es wurde grau gemacht. Damals, um 1890, konnte einer der Reisenden, der die uruguayische Hauptstadt besuchte, ein Loblied auf die Stadt singen, wo lebhafte Farben triumphieren. Die Häuser hatten damals rote, gelbe, blaue Gesichter… Etwas später erklärten Besserwisser, dass dieser barbarische Brauch eines europäischen Volkes nicht würdig sei. Für einen Europäer – egal was die Landkarte sagte – musste man zivilisiert sein. Um zivilisiert zu sein, musste man ernst sein. Um ernst zu sein, musste man traurig sein. Zwischen 1911 und 1913 verfügten die Ordenanzen der Gemeinde dann auch, dass die Platten der Bürgersteige grau zu sein hatten und sie erließen obligatorische Normen für die Häuserfassaden. Es waren nur solche Farben erlaubt, die Baumaterialien imitierten, also im Allgemeinen ziegel- und steinähnlich.«
Dies war also zu den Zeiten britischen Kolonialismus. Auch ein anderer, der Maler Pedro Figari, machte sich über diese koloniale Dummheit lustig, vergisst aber nicht selbstkritisch anzumerken, dass es (wie in den meisten Ländern Südamerikas bei den Führungsschichten) eine unverhohlene Bewunderung für Französisches gab. »Die Mode fordert, dass sogar die Türen, Fenster und Jalousien grau zu streichen seien. Unsere Städte sollen wie Paris sein. Die leuchtende Stadt Montevideo: Sie überschmieren, sie zermalmen und kastrieren sie. Montevideo starb an der Kopierwut.«