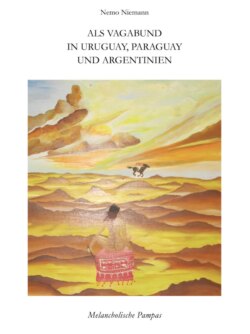Читать книгу Als Vagabund in Uruguay, Paraguay und Argentinien - Nemo Niemann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 3
Vivir en una utopía pérdida –
Wohnen in einer verlorenen Utopie
Wenig Aufmerksamkeit hast du dafür, dich über die Hausnummer 848 zu wundern, auf einem Platz mit etwas mehr als zwanzig Gebäuden. Den Plaza de Independencia, wo der Salvopalast steht, umrundet ihr zwei Mal, bevor ihr sie dann entdeckt: die Nummer 848 und Walter, der euch mediterran freundlich empfängt und sich als Verwalter des Appartements vorstellt, in dem ihr zwei Wochen wohnen werdet. Es gehört einem italienischen Ehepaar, das seine Palastwohnung im Austausch im Internet angeboten hat. Zu gegebener Zeit würden Guilio und Inez in T.‘s Wohnung in Andalusien gastieren.
Mediterran, familiär und spanisch ist auch euer Einzug in den Palast. In der schwach beleuchteten Empfangshalle mit riesigen vergilbten Sepiafotos vom Palast und einem Zeppelin, der an der Kuppel festgemacht zu haben scheint, hockt versteckt wie ein Äffchen der Palastportier. Walter erklärt wer wir sind. Nämlich gut zu behandelnde Mitbewohner auf Zeit, mit denen man nicht Englisch radebrechen muss. »Vienen de Andalucia ¿sabes?« Händeschütteln. Schulterklopfen. Ein ehrliches Lächeln. Und ein verstaubtes, dir nur noch aus Francozeiten erinnerliches »Siempre a sus ordenes« – Immer zu Ihren Diensten. Unentfernbarer Zeitstaub, den ihr nicht das letzte Mal hören werdet.
Vor den drei Fahrstühlen hängen zu dieser Tageszeit lange Menschentrauben herum. Die meisten sind betagt, tragen Baguettes. Damen mit Hündchen. Ein junges Mädchen in Jeans, ein Handwerker mit Werkzeugkasten. Jeder grüsst jeden, chiau chiau, seltener Buenos Días. Aber ¡Hola! Walter. Dem anschließenden Genuschel mit seinen vielen djos, djas, djis, djes, djus, die hier das spanische »«ll« und »y« verhunzen, kannst du nicht ganz folgen und nimmst dir vor, es nicht nachzuäffen wie der Clown in dir es verlangt.
Im Ton eines stolzen Palastpatrioten weist Walter uns auf das besondere Muster im Marmorteppich des quadratischen Flurs im 7. Stock hin. Jede Etage habe ein anderes, wir könnten uns also gar nicht verirren. Dann geht es einmal rechts, dann nochmal rechts einen endlosen, düsteren Flur entlang, an dessen dunklem Ende sich euer Wandervogelnest befinden soll.
Verwundert, ja leicht entsetzt, schaut ihr euch stumm an. Jede Wohnung hat vor der hölzernen Eingangstür noch eine eiserne Gittertür. Es sieht aus wie im Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses. Und diese massive Eisentür, die den langen Flur halbiert, die müsst ihr abends ab neunzehn Uhr abschließen. Ganz wie ein Gefängniswärter fischt Walter nun auch einen Ring mit unzähligen Schlüsseln aus seiner Jackentasche und löst vier davon für euch heraus. Dieser für die Eisentür im Flur, der für die Gittertür, dieser fürs Sicherheitsschloss und der für das Türschloss.
Warum nur überall diese schrecklichen Gefängnisgitter? Woher diese Obzession der Abschließung? Es gibt doch einen Pförtner? Nun ja, die Gittertüren stammen aus den Zeiten der Diktatur, als alles sehr unsicher war, die Leute einfach von Boldeberry‘s Häschern abgeholt wurden. »Ich selbst lebte damals in Australien. Ich bin erst vor zwei Jahren nach Uruguay zurückgekehrt.« Noch während Walter an den Schlössern fummelt, tut sich die Nachbartür auf, durch die sich mühselig ein dicker, aufgeschwemmter Körper zwängt. Eusebius lächelt breit und seine kleinen Rattenaugen mustern euch neugierig. Er ist Architekt, sein Sohn arbeitet in Madrid und seine Tochter ist Notarin und sie teilen sich diese Wohnung als gemeinsames Büro. Weitere Details seines Redeschwalls prallen an euch ab, ihr sagt chiauchiau und steht dann in der Wohnung.
So! Dies hier ist das, das dort ist dies, das dafür, hier der Hahn fürs Gas, der fürs Wasser. Alles ist da! Wenn ihr mich braucht, ich wohne in Zimmer 742 und hier ist meine Telefonnummer. Wir sehen uns später. Und weg ist Walter der weitgereiste Verwalter.
Die Wohneinheit mit etwa dreissig Quadratmetern hat mehr als ein Reisender braucht: Fernseher, DVD-Anlage, Radio, Mobiltelefon. Die abgetrennte Küche und das Bad sind komfortabel modernisiert, nichts lässt auf Althergebrachtes schließen. Ausser der polierte Holzfußboden. Der Wohnraum ist geschickt in zwei türlose Hälften aufgeteilt, es gibt Platz und Tische zum Schlafen, Essen, Lesen und Schreiben. Befreiend ist der Blick über die niedriger liegenden Häuser hinweg auf das trübbraune Delta-Meer des Rio de la Pata und seine Schiffe. Ungewohnt ist der heraufsteigende Verkehrslärm, das Dröhnen der vielen Busse, wenn du das Fenster öffnest. Wortlos nickt ihr euch zu, ja hier lässt es sich zwei Wochen aushalten. Einig seid ihr euch auch darüber, in diesen Tagen möglichst viel zu Fuß zu erkunden.
Aber jetzt ist erst einmal Siestazeit; bei geschlossenen Fenstern.
Obwohl hundemüde macht sich nach kurzem Einnicken die lauernde Unruhe dessen bemerkbar, der sich noch fremd fühlt. Im Ozean der unendlich vielen Zeichen suchst du Orientierung. Denn du gehörst nicht zu den Reisenden, die selbstherrlich davon ausgehen, alles sei für sie hergerichtet. Dein Blick gleitet über das Mobilar, die Zimmerausstattung, und du versuchst dir die Unbekannten vorzustellen, in deren Privatheit du jetzt bist.
Die gestylten, wegen ihres quadratischen Formats und ebenen Bodens unpraktischen Wasserbecken lassen eitle Formverliebtheit erkennen. Ein chromblitzendes Monstrum mit vier Etagen schwarzer Acrylglasplatten für die elektronischen Foltermaschinen steht deplaziert neben einem antiken Sekretär aus Nussbaumholz. Die spanische Trennwand und ein kleines Buffett zieren dick aufgetragene Schlieren chinesischer Ornamente: Drachen, Blumen, Wasserfallnachahmungen. Vögelchen! Die große Bücherwand aus weissem Resopal ist ein praktischer Raumaufteiler und dient zehn Büchern und persönlichem Klimmbimm und Nippes als Abstellplatz. Pragmatisches Funktionsdenken kontrastiert mit modernem Kitsch und zeugt vielleicht nur von dem Zwang, die Bude – irgendwie – eingerichtet haben zu müssen. Was weisst du schon über die Möglichkeiten in Montevideo, eine Wohnung auszustatten? Es ist die Behausung moderner Stadtnomaden, von Zugvögeln, die in globalen Fluglinien denken und auf mittelständische Komfortstandards Wert gelegt haben, die anderswo als unerschwinglicher Luxus gelten. Ihr Stil ist ein Nichtstil, die Wohnung ist ein Nichtort innerhalb eines historischen Ortes. Sie ist eine Investition, die den Salvopalast emotionslos als willkommene Wertsteigerung betrachtet.
Noch an demselben Tag geht ihr auf eine erste Erkundungstour und lernt, dass ihr das große Los gezogen habt. Das Zentrum ist hier wirklich Zentrum. In der pasiva, wie sie hier die Arkadengänge im Erdgeschoss des Salvopalates nennen, befinden sich ein Buchladen, eine Bar, ein Zeitungskiosk, eine Wechselstube und eine kleine Bude mit Mobiltelefonservice. Der Salvopalast nimmt fast einen ganzen Häuserblock – cuadra statt manzana sagen sie hier – ein, in dem sich alles findet, was Urbanität ausmacht: Apotheken, weitere Buchläden, ein Waschsalon, ein Lebensmittelgeschäft. In einem nahegelegenen Supermarkt deckt ihr euch mit allem ein, was ihr zur Selbstversorgung braucht und schlendert dann mit den Plastiktüten wie Hausfrauen, die auf ein Schwätzchen hoffen, einmal um den Unabhängigkeitsplatz.
Wie Mekkapilger, die ihre Gebetsrichtung suchen, diskutiert ihr, wo Osten ist. Die Mittagssonne steht hier im Norden. Von Süden weht der eiskalte Antarktiswind. Der Salvopalast liegt im Osten, unser Blick aus der Wohnung über den Platz geht also nach Westen. Abends, nicht wahr, hätten wir also zwar kostenlose Sonnenuntergänge, aber mittags kein Sonnenlicht. Rechts vom Salvopalast, also nördlich, reckt sich die einfallslose Fassade des Hotel Radisson, ein Chicagobau mit fünf Sternen. Mehrere fünfstöckige Bürgerhäuser schließen die nördliche Flanke, die im Westen auf die American Airlines und ein mehr als zwanzigstöckiges gläsernes Verwaltungsgebäude stoßen, das von Hunderten schnarrender Klimaanlagen benestert ist, die wie Pickel auf der Gesichtshaut eines Pubertierenden sitzen. In diesem Gebäude spiegelt sich die aufgehende Sonne. Das Beste was man von diesem Monster sagen kann. Zwei weitere Bauten aus der Hexenküche LeCoubusiers schließen den Platz im Süden ab. Auch sie jüngeren Datums und aus Glas und grauem Beton. Das eine wird seit fünfzehn Jahren »renoviert« und soll einmal Regierungssitz werden. Das andere nennt sich »Institut für Standardisierung«. Hier grübeln heute die Nachfolger jener, die laut Galeano Montevideo seine graue Zivilisationstünche verordneten.
Der Platz ist keine plaza im üblichen mediterranen Sinn, dazu fehlen ihm die Bars, Restaurants und kleine Läden, die Menschen zusammenbringen. Er lädt nicht zum Verweilen ein, denn in einem nicht endenden Korso umkreisen ihn unablässig Montevideos domestizierte Pampabullen mit ihrem Röhren und Brüllen und ihren Abgasen. Die hohen Gebäude vervielfachen das Echo ihres Getöses als sei das ihr vörderster Zweck. Im geometrischen Mittelpunkt des palmenbestandenen Gevierts ragt, reckt sich, erhebt sich einsam die Reiterstatue des uruguayischen Nationalhelden Artigas. Wie anderswo auch umflattern ihn die grässlichen Stadttauben, scheissen auf ihn und hören nicht auf, unzufrieden über ihn zu gurren. An Sonntagen jedoch, wenn der Platz still ist, kriechen mittags aus den Höhlungen des unterirdischen Mausoleums, auf dem das Denkmal ruht, blaugelbe Raupen in willkürlicher Unordnung hervor, sammeln sich dann in Reihen und entpuppen sich als Gardisten, deren Aufgabe es ist, Uruguays Nationalstolz mit quäkender Blasmusik wachzuhalten. Kaum ein Passant bleibt stehen oder nimmt gar seine Kopfbedeckung ab wie du es von sonntäglichen peruanischen Ritualen gelesen hast. Überhaupt, mit Artigas scheint es seine besondere Bewandtnis zu haben. Galeano: »Die Todesarchitektur ist eine militärische Spezialität. 1977 errichtete die uruguayische Diktatur ein Grabesmonument zur Erinnerung an José Artigas. Dieser riesige Unfug war ein Luxusgefängnis: es gab begründeten Verdacht, dass der Held eineinhalb Jahrhunderte nach seinem Tod entkommen und wiederauferstehen könnte. Um das Mausoleum zu dekorieren und die Absicht zu verschleiern, suchte die Diktatur nach aussagekräftigen Sätzen des Helden. Aber dieser Mann, der die erste Agrarreform Amerikas durchgeführt hatte, der General, der sich »Bürger Artigas« nennen ließ, hatte gesagt, dass die Unglücklichsten die Privilegiertesten sein sollten; er hatte bekräftigt, er würde niemals unsere reichen Besitztümer zu Niedrigpreisen verkaufen und das eine ums andere Mal wiederholte er, dass seine Autorität aus dem Volk hervorgehe und das Volk die Grenzen ziehe.Die Militärs fanden keinen Satz, der ihnen nicht gefährlich geworden wäre. Sie entschieden, dass Artigas stumm gewesen sei.Auf den schwarzen Marmorwänden stehen nur Namen und Daten.«
Artigas war vereinsamt in Paraguay verstorben, wohin er sich nach seinen vielen erfolgreichen Feldzügen zurückgezogen hatte. Seine Statuen findet man auch in anderen Ländern des Cono de Sur, in Pampalandia. Sein geistiges Erbe – Landreform und demokratisch begründete Autorität – hält die Pampaländer nach wie vor in Atem. Sein Standbild und der Salvopalast symbolisieren auf diesem Platz den Kontrast zweier Utopien, die unterschiedlicher nicht sein können und doch unzertrennbar zusammengehören .
Der Salvopalast ist das kurios anmutende Produkt der »verrückten« 20-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ein durchgeknallter, nostalgischer Architekt mit Hang zur Bewunderung Mussolonis und gleichzeitig ein schwärmerischer Danteverehrer – Mario Palantini – und eine emigrierte, dann in Montevideo erfolgreiche Textil- und Weinfabrikantenfamilie aus Ligurien – Maria, Lorenzo, Jóse und Ángel Salvo Debenedetti – haben dieses mit Allegorien überfrachtete Gebäude gemeinsam in die damals prosperierende uruguayische Welt gesetzt.
Es war von Anbeginn ein Bauprojekt, das die Geister in enthusiastische Bewunderer und vehemente Kritiker geschieden hat. Mit allen erdenklichen Spielarten dazwischen. Aber keinen ließ es kalt.
Der Versuch, das Gebäude so unbefangen zu beschreiben, als wüsstest du nichts, wäre geheuchelt: es erinnert auf Anhieb an Gaudis Wohnhäuser in Barcelona, an die Schwere und Wuchtigkeit repräsentativer Bauten und Beeindruckungsarchitektur in Madrid, zum Beispiel am Plaza Cibeles. Es hat auch etwas von der Verspieltheit italienischer Kathedralen. Auf jeden Fall ist es mediterran und katholisch. Mythologisch aufgeladene Begriffe wie grandezza, gloria, eternidad kommen einem in den Sinn: wichtig, groß, größenwahnsinnig, ruhmreich, ewig…
Und es hat etwas Provozierendes inmitten der gläsernen Funktionalität, der hilflosen Sachlichkeit und dem schmucklosen Pragmatismus der anderen Bauten am Platz. Es gehört nun einmal historisch hierher, ganz so wie die vielen europäischen Invasoren, Eroberer, Glücksritter, Verbrecher, Flüchtlinge und Verzweifelten. Es ist eine Spur, in der man lesen kann. Aber jeder liest sie anders, obwohl klar ist und Dokumente es belegen, dass der Salvopalast die Utopien eines vergangenen bourgoisen Strebens spiegelt, den Zeitgeist der belle epoque mit all ihren Widersprüchen.
Der Schriftsteller Cesar Loustans zum Beispiel spricht von Palantinis »ausserirdischen, unkontrollierten Erfindungsgabe.« Sie äusserte sich unter anderem in den unzähligen allegorischen Tier- und Phantasieköpfen, die an der Fassade angebracht waren. Heute sind sie nicht mehr sichtbar, weil sie abbröckelten und den Passanten auf die Köpfe fielen. Man entfernte sie allesamt. Aber Palantinis »Gabe« war so ausserirdisch nicht Auch nicht unkontrolliert. Er war ganz einfach angetan – inspiriert? – von Dantes Komödie mit ihrer Höllen-Himmel-Hierarchie. Und so unterteilte Palantini den Bau in drei symbolische Teile:
Das Untergeschoss in das infierno – die Hölle -, das zweite bis zehnte in das purgatorio – das Fegefeuer, und die restlichen siebzehn in el cielo – den Himmel. Ihr wohnt also im siebten Stock des Fegefeuers. Eine anregende und tröstliche Vorstellung, denn darunter gibt es noch die Hölle.
Palantinis literarische Fantasie erweist sich als durchweg reproduktiv, nostalgisch und an der Antike orientiert, wie es so wohl nur Mittelmeermenschen und Humboldt sein können. Palantini sah das La-Plata-Delta in Analogie zur Straße von Gibraltar. Mit Buenos Aires als einer Säule und Montevideo als der anderen Säule des Herkules. In Buenos Aires hatte er zuvor das fast identische, aber kleinere Gebäude des Barolopalastes an der heute zwölfspurigen Prachtstraße der Avenida de Mayo gebaut. Da lag es auf der mythologischen Hand, sich als herkulischen Säulenbauer zu sehen.
Es ist übrigens der geistige Königsweg aller Eroberer- und Entdeckerfiguren Europas, das Fremde und seine potenzielle Unbeherrschbarkeit mit Namen, Begriffen und Mythen aus seinem Herkunftsland zu bannen. Benennen heisst bannen. Das taten die Afrikaeroberer mit Namen wie Viktoriasee, Edwardsee und englischen Namen für Berge ebenso wie die von ihrer eigenen Kultur völlig geblendeten Spanier: wieviele Rio Negros, Cordobas, Santa Fés, San Josés gibt es nicht in Südamerika! War Palantinis »Erfindungsgabe« nicht vielleicht eher das herrische Überstülpertalent eines mythensüchtigen, erfolgreichen Einwanderers, der seine Migrantenängste zu bannen suchte? Italo Calvino meint in seinem Buch Die unsichtbaren Städte: »Städte sind aus Ängsten und Träumen gemacht.«
Seinen heftigsten Kritiker fand der Salvopalast ironischerweise in LeCobusier. Bei seinem Besuch 1928 in Montevideo fand er diesen »Zwerg mit Hut zerschießwürdig«! Er, der später selbst heute abwrackwürdige Wohnmaschinen erfand – die Nachkriegszeit machten sie objektiv erforderlich – war damals wohl zu sehr von antibürgerlichen Impulsen in einer bürgerlichen Zeit geleitet, um die damals avantgardistischen technologischen Leistungen überhaupt würdigen zu können. Der Palast war damals mit 84m?, 90m? 94 m? (die Angaben schwanken) nicht nur Südamerikas höchstes Gebäude und galt als Hochhaus, sondern wurde auch als erstes mit Stahlbeton errichtet.
Eine zweite Ironie steht dem Salvopalast glasig direkt gegenüber: der Verwaltungspalast mit seinen zahlreichen Klimaanlagen könnte gut von LeCobusier stammen und zeigt den Lauf der Dinge. Er ist darauf reduziert, Sonnenaufgänge und den Salvopalast zu spiegeln.
Aber was sagen die Montevidaner selbst?
Mario Benedetti, Uruguays über die Grenzen des paisito, das Ländchen, hinaus bekannter Schriftsteller und Sohn der Stadt, meint: »Er ist so hässlich, so dermaßen hässlich, dass er fröhlichen Humor freisetzt.« Wie sympathisch, dass hier einer lachen kann! Das Ding steht nun einmal da, schon achtzig Jahre, und wird noch immer bewohnt, belebt und beachtet. Es ist ein Stein gewordener Mythos, Montevideos Mythos. Hamburgs Bismarck-Denkmal am Millerntor ist ebenso hässlich, aber blickt man durch sein Auge auf Hamburg, kann es auch Humor freisetzen. Mythen sind wohl immer beides, nämlich schön hässlich. Aber zerschießen? Galeano meint dies: »Ich konnte nie herauskriegen, ob er ein Traum oder Albtraum ist. Aber in einem bin ich mir sicher wie jeder geborene Montevideaner: der Palast Salvo begleitet mein Leben.« Kein Montevideaner will ihn also abreissen oder zerschießen. Er ist ein Geschichte gewordenes Erinnerungsstück, eine Antiquität, – wie die Möbelstücke eines Verstorbenen – die man möglichst in der Familie behält und nicht an Fremde verhökert.
Doch genau das scheint nun doch zu passieren. Und zwar nicht nur mit einigen wenigen Palastwohnungen, sondern mit ganzen Häusern des alten Montevideo wie ihr später feststellen werdet. Diese Zeit scheint dazu zu zwingen.
Schon bei seiner Eröffnung 1928 – es wurde insgesamt dreimal gefeiert – hatte das Gebäude alles, was seitdem auch modernste Wohnhochhäuser oder Hotels nicht besser haben: Aufzüge, Luft- und Abfallschächte, verschieden große Appartements für Junggesellen oder Familien, Elektrizität, fließendes Wasser – und darüber hinaus eine Bar, ein Tanzcafé, einen Theater-, Ess- und Lesesaal, Werkstätten, einen Wintergarten, einen Friseursalon, eine bodega mit Kühlschränken. Vor allem aber auch erhabene Ausblicke .
Ursprünglich war der Palast als Hotel geplant. Das ging nur wenige Jahre gut. Stattdessen fand das Gebäude Zuspruch bei kleinen Familien, Alleinstehenden, Rentnern und Hinterländlern, die sich vorübergehend in der Stadt aufhielten: Und so ist es im Grunde bis heute geblieben.
In jedem Stockwerk tritt man vom Fahrstuhl aus in eine etwa achtzig Quadratmeter große Halle mit jeweils einem anders gestalteten Marmorboden und den geschwungenen Initialien »PS«. Wie schon zu Beginn des Jahres 1928 wohnt auch heute im Jahre 2008 die sogenannte Mittelschicht im zerschießwürdigen Zwerg mit Hut. Es dominieren Menschen, die kurz vor oder schon von ihrer Rente leben. Beobachtbar ist angeblich ein langsamer Anstieg junger Leute, – Arbeiter und Studenten – die sich hier einmieten oder einkaufen. In den 70-er und 90-er Jahren – dazwischen lagen die bleiernen Jahre der Diktatur – kamen viele Leute aus dem Hinterland, die unliebsame Gepflogenheiten hatten, indem sie untervermieteten. Die Untermieter vermieteten an weitere Untermieter und das Gefühl für eine verantwortliche Hausgemeinschaft ging verloren. Das Gebäude verwahrloste. Dem widersetzten sich die »reinen« Salvopalastbewohner und sorgten wieder für bürgerliche Sauberkeit. Aber, so erzählt Walter, der schlechte Ruf aus jener Zeit hat sein Leben noch nicht ganz ausgehaucht. Damit sich das ändert, sorgt sich heute ein achtköpfiges Hausverwaltungsgremium unter der Leitung von Beatriz Quirogo um das Gebäude. Sie tut das auf sehr eigenwillige Art und Weise: sie schreibt Anekdoten aus dem Palastgeschehen.
Bleibt zu berichten, dass die Bewohner von heute stolz auf all den materiellen Luxus verweisen, mit dem der Salvo damals ausgestattet worden war. Der Marmor stammt aus Carrera, das Eichenholz aus dem Kaukasus, der Granitstein aus Deutschland und die farbigen Bleifenster aus Italien. Wie anderswo im Südamerika der letzten 250 Jahre fieberte man während der Hochzeiten wirtschaftlichen Reichtums im anschwellenden Triumphgesang: Man konnte es Europa gleichtun!
Von schmutziger Wäsche, die auf Schiffen zum Waschen nach Paris gebracht wurde wie es die zu unverschämtem Wohlstand gekommenen verbrecherischen Kautschukbarone von Manaos seinerzeit handhabten, weiss man von Montevideos Oberschicht jedoch nicht zu berichten. Wahrscheinlich war neben dem Kodex bürgerlicher Anstandsnormen die historisch nur kurze Dauer von Wohlstand dafür verantwortlich, dass die Träume der Salvos nicht in den Himmel wuchsen: 1929 kam es zur Weltwirtschaftskrise. Ihre Utopie von Großartigkeit und weltweitem Glanz zerbröselte zwar – aber das Gebäude war zeitig fertig geworden und steht noch heute. Es war nicht mit Hypotheken gebaut und aus solidem Beton.
Auch heute am 16. September 2008, dem zweiten Tag eures Aufenthaltes in Montevideo ist nach 80 Jahren erneut die Utopie eines grenzenlosen Wohlstands zusammengebrochen. Die Zeitungen hier – La República, El País und die spanischsprachige Ausgabe von Le Monde Diplomatique – berichten mit triumphalem Unterton vom Untergang der Wall Street. Aus ihm wird unter der Hand gleich Washington, die ganze USA: El ocaso de Washington, Washingtons Untergang! Das entspricht dem in fast allen Zeitungen gepflegten und mantrahaft wiederholten, alten Ammenmärchen ausschließlich nordamerikanischer (und europäischer) Schuld für Lateinamerikas wirtschaftliche Unterentwicklung. Einige wenige Stimmen mahnen Selbstkritik an und weisen auf den paktierten, aber noch immer nicht verwirklichten Mercosur hin, Südsüdamerikas Zusammenschluss von Argentinien, Uruguay, Paraguay und Brasilien nach europäischem Vorbild.
Aber es gibt kein dèjá-vu-Erlebnis in diesen Tagen der offiziell gewordenen Weltwirtschaftskrise in Montevideo. Die historischen Bilder von Menschenschlangen Arbeitsloser vor Ämtern und Sparern vor Banken bleiben aus. Der Reisende bekommt auch immer noch anständige 2800 uruguayische Pesos für seine 100 €, der Preis für eine café solo springt ebenso wenig in astronomische Höhen wie die Lebensmittelpreise. Ist es nur eine virtuelle Krise? Oder fällt ein ohnehin »armes« Land wie Uruguay einfach nicht so tief wie die USA?
Wahr ist, dass deine Reise mit diesem Ereignis einen surrealen Unterton bekommt, der bis zum Ende der Reise nicht verklingen will. Die in den Zeitungen beschriebenen Ausmaße der Krise wollen nicht zu der Tatsache passen, dass du deine Reise problemlos fortsetzen kannst. Du fühlst dich wie ein Windreiter, der den Realitäten enthoben ist.
Beatriz Quirogos Anekdoten sind Palastmärchen für Kleinbürger, harmlose Vorläufer unserer Zeit der Tyrannei der Intimität. Sie erzählen unter anderem vom »Löcherbohrer, – perforador de agujeros, eine unverhohlen fröhlich-rohe, sexuelle Anspielung – der in den 80er und 90er Jahren sein allgemein goutiertes Unwesen trieb. In mehreren Wohnungen fanden sich in den hölzernen Eingangstüren mehrere säuberlich gebohrte Löcher, – von unten nach oben und in Reihe – die schmutzige Blicke ins intime Innere der Palastzimmer erlaubten. Jeden Morgen fanden sich neue Löcher. Nachdem man die Theorie, es müssten Holzwürmer gewesen sein, als abwegig aufgegeben hatte, einigten sich die Palastbewohner darauf, dass es sich um einen Voyeur handeln müsse, der die Stunden des Tiefschlafs nutzte, um sich zu vergnügen. Der Löcherbohrer wurde nie gefasst. Wollte man ihn überhaupt fassen? Eher scheint es so zu sein, als würde hier der verklemmte Katholizismus sein fröhliches Ventil für schlüpfrige Fantasien gefunden haben. Man konnte sich begehrt fühlen, ohne santiamén sagen zu müssen und hatte etwas zum Tratschen. Die verkitteten Löcher in den Holztüren allerdings lassen sich noch heute nachprüfen.
Ähnlich harmlos, aber für damalige Zeiten offenbar erheiternd, ist die Anekdote von Alfredito, der Fischotter, die ein Bewohner als Maskottchen hielt. Sie war aus einem höheren Stockwerk gefallen und »hatte eine alte Dame« niedergestreckt wie der Neffe der Zeitung mitteilte. Nach längeren Recherchen stellte sich jedoch heraus, dass Alfredito auf das Dach eines japanischen Autos gestürzt war. Der Neffe spekulierte auf Schadensersatz.
Das Ausmaß der Harmlosigkeit für erzählenswert gehaltener Anekdoten kündet von friedfertigen, unaufgeregten Zeiten und einem provinziellen Montevideo, in dem soziale Kontrollnormen noch wie in Jane Jacobs Beschreibungen intakter New Yorker Viertel funktionierten. Dass ein Mann den Palastbewohnern ungefragt täglich Zeitungen vor die Türen legte und dann am Monatsende zur Kasse bittet, trägt ihm den Ruf einer canallita ein, einer kleinen Kanaille. Ein Begriff, der im Spanischen sehr viel verächtlicher gemeint ist, als er im Deutschen klingt.
Von dieser provinziellen Harmlosigkeit ist auch heute noch etwas in Montevideo zu spüren und die Stadt überlässt gern und anscheinend ohne Minderwertigkeitskomplexe Buenos Aires das Etikett der glamourösen Weltmetropole. Wen es nach Hallygalli dürstet…, – bitte sehr – in drei Stunden Seefahrt erreicht er die eitle Schwesterstadt, von der man sich in langen historischen Kämpfen und Scharmützeln emanzipiert hat.
Woher nur nehmen die Uruguayer ihren Gleichmut und ihre Gelassenheit? Das Ländchen liegt zwischen Skylla und Carybdis, – Argentinien und Brasilien – zwei gefrässigen, an Ressourcen reichen Ländern. Politologen nennen Uruguay einen Pufferstaat. Es ist also immer gefährdet? Wie behauptet das paisito sich?