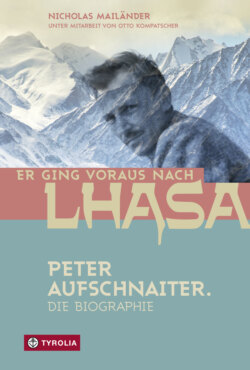Читать книгу Er ging voraus nach Lhasa - Nicholas Mailänder - Страница 10
KAPITEL 3 ZWEIMAL AM KANGCHENJUNGA
ОглавлениеUm die Jahreswende 1928/29 rückte der Himalaya für Paul Bauer „aus der nebligen Ferne, in der er für uns schwebte, in das Zielfeld; der Gedanke einer Reise dorthin verlor das Phantastische; die Erfahrungen der letzten Jahre ließen ihn durchführbar erscheinen. […] Ende Januar 1929 begannen die einleitenden Verhandlungen mit dem britischen Generalkonsulat […]“1
Im Februar 1929 verschickte Bauer ein Rundschreiben an die vorgesehenen zwölf Mitglieder der Expedition.2 Allesamt gehörten sie dem Akademischen Alpenverein München an; Eugen Allwein und Peter Aufschnaiter standen nicht auf dieser Liste. Die beiden im Durchschlagverfahren auf Dünndruckpapier kopierten Seiten des Rundschreibens begannen mit folgenden Worten: „Es ist mir klar geworden, dass wir im Jahre 1929 in den Himalaja müssen.“ Dann folgte ein 14 Zeilen umfassender tabellarischer „Reiseplan“, aus dem hervorging, dass der Achttausender Nanga Parbat im August und September des Jahres 1929 in einem Zeitraum von 42 Tagen „belagert“ werden sollte. Die „im allgemeinen reichlich bemessenen“ Kosten würden sich auf 2975 Reichsmark pro Mann belaufen.3
Die Teilnehmer wurden aufgefordert, für ihre Ausrüstung selbst zu sorgen. Ein Wellness-Urlaub war nicht vorgesehen, aber immerhin würde die Expedition „etwas mehr Komfort bieten als die KK [Kaukasus-Kundfahrt], in den Hochlagern auch mehr als die Pamir. Sie wird aber mit einem möglichst kleinen Tross geführt werden und sich dadurch ganz wesentlich von P [Pamir-Expedition] unterscheiden. […] Das Geheimnis wird darin bestehen, dass wir unbedingt zusammenhalten und dass jeder alles nur Erdenkliche tut, um jeden anderen bei guter Laune zu erhalten, dass eine ganz selbstverständliche Disziplin herrscht, Einer muss anordnen. – dass wir vor keiner Arbeit, vor keinem Wetter, keiner Gefahr zurückschrecken, im Notfall alles selbst machen und uns schlimmsten Falles mit weniger als dem allernötigsten begnügen ohne die gute Laune zu verlieren.
Wissenschaft im Sinne der P wird nicht betrieben, es wäre aber schade, wenn jeder einzelne die Reise nicht zu Beobachtungen auf seinem Berufsgebiet oder einem ihm vertrauten Spezialgebiet benutzen würde […]
Ziel ist einzig und allein die Ersteigung der über 6000 Meter hohen Gipfel der Nanga Parbat Gruppe.“
Abschließend empfahl Paul Bauer den Expeditionsteilnehmern, sich über das Zielgebiet zu informieren: „Das Studium der Literatur ist sehr wichtig und jeder sollte sich über die Verhältnisse ins Bild setzen und zwar so rasch als möglich, [es] ist dabei aber mit einer gewissen Vorsicht vorzugehen, denn der Plan muss unbedingt geheim gehalten werden. Vorsicht beim Ausleihen der Bücher!
W i rm ü s s e nd i eS a c h eu n b e d i n g tg e h e i m h a l t e n.“4
Unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit engagierte sich Paul Bauer für die Umsetzung seiner Expeditionspläne. Am Mittwoch, den 6. März 1929 trafen sich der Zweite Vorsitzende des DuÖAV, Prof. Raimund von Klebelsberg, und der Münchner Geheimrat Dr. Gustav Müller in Innsbruck. Müller war ein enger Vertrauter Paul Bauers und gehörte wie dieser sowohl der Alpenvereinssektion Hochland als auch dem AAVM an. Anhand eines laut Klebelsberg von Bauer gefertigten „einigermaßen ausführlichen“ Elaborats stellte Müller den Plan einer Expedition in das Gebiet des Kangchenjunga in Sikkim vor, die im Juli und im August desselben Jahres am Berg tätig sein würde. In einem handschriftlichen Vermerk notierte der Geograf Klebelsberg seine erheblichen Bedenken bezüglich eines solchen Unternehmens mitten in der Monsunzeit.5
Ein Rundschreiben, das Klebelsberg am 8. März 1929 an sechs internationale Fachleute für das Expeditionswesen verschicken ließ, informiert über Bauers Vorhaben:
„[…] Eine erstklassige Münchner Bergsteigergruppe plant für Juli und August 1929 den Versuch einer Ersteigung des Kangchenjunga und benachbarter Gipfel in Sikkim. An der Spitze der Gruppe steht Notar Dr. Bauer aus München, der sich mit seiner Mannschaft im vorigen Jahr im Kaukasus sehr bewährt hat und einer der Teilnehmer wäre cand. Phil. Karl Wien aus München, der bei der Besteigung des Pic Kaufmann [früherer Name des Pik Lenin] mit war. Die Unternehmung ist grössten Teils auf eigene Kosten und auf Rechnung anderer Geldgeber vorgesehen, der Deutsche und Oesterreichische Alpenverein hätte die Möglichkeit, mit einem verhältnismäßig geringen Zuschuss (15000 RM) die Unternehmung zu der seinigen zu machen. Diesfalls würde rasche Beratung und Beschlussfassung erforderlich.“6
Wie waren Paul Bauer und seine Gefährten wohl auf den Gedanken gekommen, statt des damals als relativ einfach eingeschätzten 8125 Meter hohen Nanga Parbat den 8586 Meter hohen und viel schwierigeren Kangchenjunga zum Ziel ihrer Himalaya-Wünsche zu machen?
Es fällt auf, dass der aus Breslau stammende und alpin hochversierte Günter Oskar Dyhrenfurth, Professor für Geologie in Breslau, im November 1928 den zum Ersten Vorsitzenden des DuÖAV gewählten Münchner Baudirektor Richard Rehlen, den Altvorsitzenden des DuÖAV Reinhold von Sydow und den dem Leser bereits bekannten Bremer Ministerialrat, ab 1929 Dritter Vorsitzender des DuÖAV Philipp Borchers von seinem Plan unterrichtet hatte, in der Vormonsunzeit des Jahres 1930 eine internationale Expedition ins Kangchenjunga-Gebiet zu unternehmen. Am 16. Januar hatte Dyhrenfurth einen entsprechenden Förderungsantrag beim Hauptausschuss des Verbandes eingereicht.7 Die vom Hauptausschuss behandelten Themen unterlagen im Normalfall keiner Geheimhaltung; so ist es durchaus möglich, dass Paul Bauer von den Absichten Dyhrenfurths erfahren hatte. Der hätte sich wohl nie träumen lassen, dass plötzlich ein Konkurrent auf den Plan treten würde, der alles daransetzte, der internationalen Expedition mit einem Unternehmen zuvorzukommen, dessen Mitglieder bereit waren, alles zu geben, um durch die Besteigung des ersten Achttausenders das Ansehen Deutschlands in der Welt zu fördern.
Der Grund für die Entscheidung, nicht mehr den Nanga Parbat, sondern den höheren und schwierigeren Kangchenjunga anzugehen, könnte einfach im sportlichen Ehrgeiz gelegen haben. Aber für Paul Bauer hatte das Unternehmen „[…] eine weit über das Bergsteigerische hinausgehende allgemein menschliche und politische Bedeutung, letztere nicht nur für das Ansehen der Deutschen im Osten: Der Kampf um die Gipfel des Himalaja fügt sich ein in die Reihe der Taten, die das Recht und die Fähigkeiten der weißen Rasse, die fernen Erdteile zu beherrschen, dem Nachdenklichen beweisen und den naiven Völkern ad oculos demonstrieren.“8
Dazu kam, dass es unter Münchner Bergsteigern schon lange üblich war, sich gegenseitig die Projekte abzuluchsen. So hatte der AAVMler Leonhard Heis seinen Vereinskameraden Adolf Schulze und Ludwig Distel 1904 die 1400 Meter hohe Nordwand des Hochwanners vor der Nase weggeschnappt, und Schulze hatte wenige Monate später Distel, Leuchs und Pfann den Uschba im Kaukasus stibitzt. Was diesen Aspekt des alpinen Spiels anging, waren die Männer vom AAVM wahre Meister. Und die Konkurrenz trug dazu bei, dass sie zur Hochform auflaufen konnten.
Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt, erwartete Paul Bauer von den Mitgliedern einer von ihm geleiteten Expedition die fast vollkommene Unterordnung unter seinen Willen: „[…] Die Expedition ist in erster Linie auf dem Prinzip des unbedingten, fast militärischen Gehorsams aufgebaut, dem sich jeder Teilnehmer aus freien Stücken, ohne jeden stillen Vorbehalt, und freudig unterwirft. […]“9 Heinz Tillmann, im Rundschreiben Nr. 1 noch auf der Mitgliederliste10, hatte sich aus diesem Grund gegen die Teilnahme an der Expedition entschieden.11
In dem auf den 19. März 1929 datierten zehnseitigen Antrag an den Hauptausschuss des DuÖAV um Unterstützung der von ihm geplanten Expedition trug Paul Bauer sein Anliegen ohne Umschweife vor: „Für das Jahr 1929 plane ich eine bergsteigerische Expedition nach Sikkim und suche, um diese Expedition in einem erfolgversprechenden Umfange zu ermöglichen, um einen Zuschuss seitens des Deutsch- und Oesterreichischen Alpenvereins nach.“12
Es folgen Ausführungen über die Zeiteinteilung und die Reisekosten. In einem vierseitigen Abschnitt über die Reisezeit begründet Bauer seine Entscheidung, vor allem im August und September in der Hochregion aktiv werden zu wollen, mit ausführlichen Hinweisen auf von englischen Alpinisten in dieser Jahreszeit durchgeführten Unternehmungen. Bauers Zielsetzung ist klar und er ist von den Erfolgschancen überzeugt:
„Von den Achttausendern des Himalaja ist noch keiner bestiegen, auch die Siebentausender sind meines Wissens noch jungfräulich. […] Wir verfügen z. Zt. über eine hervorragende Jungmannschaft, die im besten Alter, im besten Training, mit Angriffsgeist geladen und reich an Erfahrungen ist. In der allernächsten Zeit werden wir, wenn wir nicht einen Schritt zurück machen wollen, an die Probleme des Himalaja herangehen müssen. […] Unsere jungen brauchbaren Leute können in 2–3 Jahren schon in alle Winde zerstreut und beruflich unabkömmlich sein. […] Wir sind auf Grund unserer Entwicklung geradezu dazu verpflichtet, diesen Versuch zu wagen. Das Ziel wird natürlich nicht der Versuch, sondern einzig und allein der Gipfel sein.“13
Paul Bauer schloss seinen Antrag mit der Bitte um eine Bezuschussung der Expedition mit 18.000 bis 20.000 Reichsmark.14
Doch seine Antragstellung stand unter keinem günstigen Stern. Am 25. März erging von der Innsbrucker Alpenvereinskanzlei ein Schreiben an den Münchner Geheimrat Gustav Müller, das die Ablehnung von Bauers Gesuch in Aussicht stellte. Begründet wurde dies mit der einhelligen Auffassung der zur Beratung eingeschalteten Fachleute, die von dem renommierten britischen Alpinisten George Ingle Finch auf den Punkt gebracht wurde: „Wirklich ernsthafte Unternehmungen in der Kangchenjungagruppe sind ca. April, Mai und anfangs Juni möglich. Während dem Monsun (zwischen 10. Juni bis gegen Ende September) ist das Wetter viel zu unsicher und die Lawinengefahr außerordentlich groß.“15
Ein Brief des höchst angesehenen Alpenvereins-Altvorsitzenden von Sydow vom 4. April 1929, der an alle Hauptausschuss-Mitglieder verschickt wurde, trug dazu bei, die Position Bauers noch weiter zu schwächen. Darin heißt es: „Für 1929 ist die Sache abgetan. Gott sei Dank, denn sie ist überhaupt noch nicht genügend geklärt, weder bergsteigerisch, noch vereinspolitisch. In ersterer Hinsicht steht nur fest, dass man es im Herbst nicht wagen darf. Die Bauersche Eingabe ist auch in finanzieller Hinsicht etwas stark draufgängerisch. Er glaubt es mit 8 Mann für 27000 RM schaffen zu können; die Zahl ist abgesehen von den Reisekosten lediglich gegriffen. Dyhrenfurth, der sich auf die Kosten anderer Expeditionen in jener Gegend beruft, veranschlagt […] 90 – 100000 RM, darunter nicht, erkläret mir Graf Oerindur!“16
Bei so viel Gegenwind von solch prominenter Seite ist es erstaunlich, dass sich der Hauptausschuss des DuÖAV am 10. Mai zur Unterstützung der Münchner Kangchenjunga-Expedition mit 3500 Reichsmark durchringen konnte. Zwar war diese Subvention entscheidend, damit die Expedition gegenüber den englischen Behörden als offizielles Unternehmen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins auftreten konnte. Den kümmerlichen Betrag muss Paul Bauer jedoch als blanken Hohn empfunden haben. Entmutigen ließen sich er und seine Freunde dadurch aber nicht.
Jeder Expeditionsteilnehmer hatte je nach Vermögen zwischen 1000 und 4000 Reichsmark in die Expeditionskasse einbezahlt. Die Alten Herren des AAVM hatten über 4000 Reichsmark gestiftet, die Sektion Hochland mehr als 8000 Reichsmark und die Sektion Oberland 3000 Reichsmark. Dazu kamen Sachspenden von Freunden und Bekannten.17
Inzwischen zählte auch Peter Aufschnaiter zur Expeditionsmannschaft. Erstmals erwähnt wird er in dem wahrscheinlich in der zweiten Februarhälfte 1929 verschickten sechsten Rundschreiben an die Teilnehmer. Darin heißt es: „Als Reserveleute sind neu hinzugekommen: Julius Brenner, Sepp Dreher und voraussichtlich Peter Aufschnaiter.“18
Peter Aufschnaiter mag sein Vorhaben, in die USA auszuwandern, verschoben oder aufgegeben haben. Nach dieser Entscheidung beteiligte er sich offenbar mit Feuereifer an den Expeditionsvorbereitungen. Sein Freund Ernst Reisch holte bei einem ihm bekannten Colonel Palmers, der in Indien gedient hatte, Informationen über das Zielgebiet der Expedition ein. Die Ratschläge des erfahrenen Kolonialoffiziers sollten sich später als höchst wertvoll erweisen:
„Ich glaube, dass Stürme die größten Schwierigkeiten bereiten. Die Träger sind im Allgemeinen sehr abergläubisch und scheuen sich davor, in die höheren Gebiete hinaufzusteigen, weil sie sagen, dass die hohen Berge von bösen Geistern bewohnt sind. In der großen Hauptsache natürlich hängt die Expedition von den Trägern ab, und es müssen unbedingt Vorkehrungen getroffen werden, dieselben auf das Beste zu schützen. In Bezug auf Kleidung und Essen darf nichts fehlen. […] Tragtiere tragen 2 Pakete, jedes wiegt 80, also zusammen 160 Pfund, und ein Träger trägt ungefähr 80 Pfund, in den höheren Regionen wahrscheinlich weniger.“19
In gemeinsamer Arbeit wogen die Expeditionsmitglieder das gesamte Expeditionsmaterial gemäß Colonel Palmers Empfehlung ab und verstauten es in Säcken und Blechtonnen. Am 27. Mai schickten sie die Trägerlasten nach Hamburg zur Einschiffung. Einen Monat später, am Samstag, den 22. Juni, verabschiedete sich die Expeditionsmannschaft – ausschließlich Mitglieder des AAVM – auf dem Münchner Hauptbahnhof: Eugen Allwein, Peter Aufschnaiter, Ernst Beigel, Julius Brenner, Wilhelm Fendt, Karl von Kraus, Joachim Leupold, Alexander Thoenes und last but not least Paul Bauer. Um 23 Uhr 10 setzte sich der Zug nach Genua fauchend in Bewegung.20
Von Genua aus brachte der Passagierdampfer „Saarbrücken“ die Mannschaft ohne Zwischenfälle durchs Mittelmeer, das Rote Meer und den Indischen Ozean nach Colombo auf Ceylon. Dort empfing sie der deutsche Konsul von Pochhammer mit der freudigen Nachricht, dass für das gesamte Gepäck der Expedition zollfreie Einfuhr bewilligt worden sei und dass der Einreise nach Sikkim nichts im Wege stünde. Nach fünftägigem Aufenthalt ging es mit dem Frachtschiff „Rothenfels“ weiter nach Kalkutta, das am Morgen des 27. Juli erreicht wurde.21 Hier verlor das Himalaya-Expeditionsteam keine Zeit. Um 20 Uhr desselben Tages saßen die neun Bergsteiger im Zug nach Siliguri am Fuß des Himalayas.
Als Peter Aufschnaiter morgens aus dem Fenster seines Abteils blickte, verschlug es ihm schier den Atem: Früh um 6 Uhr sieht man bei schönstem Wetter einige Schneeriesen (PANDIM?). Unten liegen die Hills mit üppigen, massigen Wäldern bedeckt, blau und mit Wolkenschwaden, die gegen den Himalaja hinaufdrücken. In Siliguri war für die Weiterreise bereits vorgesorgt: Acht Autos warten auf uns. Die Unternehmer, Tibeter, sehen sehr energisch aus. Man fährt zunächst noch in der Ebene dahin. Unser Chauffeur ist ein kleiner flinker Mongole. Bald steigt die Straße in den Jungle hinauf. Die Steigung ist sehr schwach. Die Vegetation ist wunderbar, aber fremd und unbekannt. Affen. Scharen von Weibern in schönen und bunten Gewändern. Alle tragen Schmuck. […] Ghom liegt auf der Passhöhe. Von hier einige Meilen abwärts liegt Darjeeling. Eine Menge Kulis ist schon da und rauft sich um unser Gepäck. […]
Am Abend des übernächsten Tages, es war der 30. Juli, trafen die Expeditionsmitglieder im Darjeeling Club die Spitzen der Behörden und andere Honoratioren. Peter Aufschnaiter vermerkte darüber in seinem Tagebuch: Ich sitze neben dem Polizeipräsidenten Laden-La, einem Tibeter mit einem netten siebenhaarigen Schnurrbärtchen. Ein Gentleman, der sich unser aller Sympathie im Nu erringt. Er ist einer der Haupthelden in Bells Tibetbuch („Rückzug der Chinesen über Indien im Jahre 1922 habe ich gemanagt, it was a very interesting job“). Er war auch in Deutschland. Gebildet, intelligent, witzig und – naiv. Heute Nachmittag kam er auch nach Charlemont, wo er unter den Kulis gleich eine Mordsbewegung hineinbrachte. Er ist befreundet mit Professor Scherman vom Völkerkundemuseum München. Im Club ist außerdem noch da: Colonel Tobin, Shebbeare, Preice, der Sekretär des Darjeeling Club, Graf Basswitz u. a. Die Engländer singen einen Trinkspruch auf „Jolly Good Fellow“ (Freimaurerlied). Es liegt ein Tagebuch von Shebbeare von der 24er Everestexpedition auf mit guten Bildern. In der Nacht Packen.
Am folgenden Morgen beteiligte sich Aufschnaiter an der Musterung der Kulis: Welch nette, fröhliche und einfache Leute sind das! Das Gepäck ist bis Mittag fertig. Bei strömendem Regen packen die Leute ihre Sachen und nehmen ihre Lasten auf. Und so wie sie alle zusammen sind, juchzen sie. Bei der Vorschusszahlung warten draußen die Weiber, um ihren Männern das Geld abzunehmen. Sie helfen ihnen, um die Gepäckstücke bequem zu machen.22
Paul Bauer (Mitte) forderte von seiner Expeditionsmannschaft einen fast militärischen Gehorsam, bei den Trägern war er seiner Fürsorglichkeit wegen beliebt.
Unter der Führung des Sirdar Nursang brach der erste Trägertrupp auf und machte sich auf den langen Weg durch die feuchtheißen Vorberge hinein in die Hochregion des Kangchenjunga-Gebiets. In der Ortschaft Pedong stieß der englische Begleitoffizier Oberstleutnant Tobin zu der Truppe. Er war bei allen Expeditionsmitgliedern beliebt; bald sahen sie in ihm nicht nur einen angenehmen Begleiter, sondern einen Kameraden und Freund. Nach der Überschreitung des 1770 Meter hohen Gangtok-Passes folgte die Marschkolonne dem steil ins Tal des Tista hinabführenden Weg und dem reißenden Bergfluss hinauf bis zur 2700 Meter hoch gelegenen Siedlung Latscheng. Wenige Kilometer oberhalb zweigte linker Hand das zum Teil weglose Zemu-Tal ab. Aufschnaiter, Kraus, Leupold und zwei Träger gingen voraus, um den besten Weg zu suchen, ihn zu markieren und die Lager vorzubereiten. Der Tross folgte reibungslos auf der wohlpräparierten Strecke, sodass bereits am 16. August in einem oberhalb der Waldgrenze gelegenen grasbewachsenen Moränental auf 4370 Meter Meereshöhe der für das Hauptlager vorgesehene Ort erreicht war.
Um sich vor dem kalten, vom Zemu-Gletscher herabwehenden Talwind zu schützen, begannen die Sahibs mit dem Bau einer Mauer aus Steinen, Rasenstücken und Holzverstrebungen. Bald waren auch die Kulis mit bei der Sache; und selbst Lieutenant Colonel Tobin krempelte seine Ärmel hoch, um Rasenpolster auszureißen und Steinbrocken zu schleppen, was für ihn eine gänzlich neue Erfahrung gewesen sein dürfte. Am Abend stand in dem Hochtal eine kleine Stadt mit einer Küche und zwei Schlafhäusern, dazwischen Zelte, die bereits den Kaukasus, das Pamirgebirge und den Mount Everest gesehen hatten. Darüber wehten die deutsche und die englische Flagge.
Am 18. August begannen die Erkundungsvorstöße am Berg. Der Aufstieg auf den Kangchenjunga über den auch von Dyhrenfurth projektierten Nordostsporn war nun endgültig zum Ziel erklärt worden. Auch Bauer erschien er als die sicherste Aufstiegsmöglichkeit. Allerdings bildete der Sporn zwischen 5500 und 6500 Metern einen langen, schmalen Grat, dessen Besteigbarkeit mehr als fraglich war: „Der Anblick war niederschmetternd […] Die steile Fels- und Eiswand hinauf zum Grat konnte ja noch gehen. […] Aber der Grat sah furchtbar aus. Ein senkrechter Eisabbruch nach dem anderen türmte sich auf, jeder für sich eine Scercen-Eisnase.“23
Doch der Expeditionsleiter ließ sich nicht die Schneid abkaufen. Am 13. September, nach einem rund sechswöchigen Anmarsch, hatte sich die Expeditionsmannschaft unter dem Steilabbruch des Nordostsporns in etwa 5200 Meter Höhe im Lager 6 in Stellung gebracht. Als es am folgenden Morgen zur Sache geht, ist Peter Aufschnaiter ganz vorn dabei: 5 Uhr aufstehen. 6 Uhr 30 Abmarsch. Bauer, Fendt, Karli und ich. Kuli: Lewa, Ketar, Pasang, Gami. Wir gehen mit Überschuhen und Steigeisen auf dem hartgefrorenen Schnee. Am Eisbruch kehrt Fendt wegen Unwohlsein um. Auf dem Gletscher ist es ungewöhnlich heiß. 12 Uhr Rotlager. Das Klepperzelt ist vollkommen eingeschüttet. Wir richten uns ein schönes Lager her. Der Witterungscharakter hat sich jetzt vollkommen geändert. Es ist den ganzen Tag schön. Kein Nebel. Heute sah man zum ersten Mal die Sonne etwas nördlich vom Kanchen untergehen. Abends ganz eigenartige Farbstimmung des Himmels und der Wolken über dem Zemugap. Die Windfahnen auf dem Kanchen deuten auf Wind von NW. Sollte die Monsunzeit vorerst vorbei sein? 7 Uhr im Schlafsack.24
Am 16. September erreichten Beigel, Kraus und Bauer die Gratschneide des Sporns und hackten sich dann zwei Tage lang einen Weg um und über die Eistürme des horizontalen Gratstücks. Bauer und Beigel kämpften sich den darüber liegenden Steilaufschwung hinauf. Weiter oben sah sich selbst der hartgesottene Eugen Allwein – damals einer der weltbesten Eiskletterer – einem unlösbar scheinenden Problem gegenüber:
Die Ostwand des Kangchenjunga. Der Nordostsporn zieht schräg rechts hoch zum Nordgrat.
„Als wir am 23. September am 4. Turm standen, waren wir zunächst eine Weile vollkommen ratlos, senkrecht oder überhängend war die Kante, ebenfalls überhängend war die rechte Flanke und auch die linke; in ihr führte aber ein schmales Band überdacht von mächtigen Überhängen in die Wand hinaus und in eine tief ins Eis eingelassene Gufel hinein. Bald danach endet das Band unter ungangbaren Eisüberhängen. Es blieb nichts anderes übrig, als von der Gufel aus einen Schacht senkrecht nach oben zu treiben. Kraus machte sich an die Arbeit, er schlüpfte in die Gufel und begann, sich mit dem Pickel in das Dach hineinzuarbeiten. […] Den ganzen Tag nahm diese Arbeit in Anspruch, und als wir uns um 16 Uhr wieder zum Lager zurückzogen, war der Tunnel noch nicht vollendet.“25
Beigel gelang dies dann am folgenden Tag in einstündiger Arbeit, er erreichte ein schmales Band unter Firnüberhängen. Von hier aus hackte Thoenes nach rechts gegen die Schlusswechte hinauf, die Eugen Allwein schließlich überwinden konnte.26 Solche Schwierigkeiten waren im Eis in jener Zeit selbst in den Alpen nur selten geklettert worden.
Die Expeditionsmannschaft (v. l. n. r.): Peter Aufschnaiter, Wilhelm Fendt, Paul Bauer, Joachim Leupold, Alexander Thoenes, vorne: Eugen Allwein, Col. Tobin, Karl von Kraus.
In diesem Abschnitt der Besteigung war die Mannschaft gezwungen, einige Übernachtungsplätze „höchst luftig“27 anzulegen: „Wir mussten den Platz erst aus einem Wächtenkopf herausgraben. Durch den Boden unseres Zeltplatzes konnte man an einer Stelle hinunter auf den Twinsgletscher fast senkrecht unter uns sehen. Aber die Schnee- und Eisgebilde hatten sich bis jetzt stets als so fest erwiesen, dass die unbehaglichen Gefühle nicht die Oberhand bekommen konnten.“28
Derartige Kühnheit war im Höhenbergsteigen ein Novum: Paul Bauer und seine Freunde lösten die Probleme im Himalaya mit derselben Unverfrorenheit, mit der sie daheim in den Alpen die abweisendsten Eiswände angingen. Dazu kam, dass jeder Meter des Aufstiegs für die Träger begehbar gemacht werden musste. Das bedeutete mühsamen Wegebau auf einer Meereshöhe von 5500 und 6500 Metern! Fixseile wurden keine eingesetzt. Deshalb wurden die Träger durch ihre „Sahibs“ sowohl im Auf- als auch im Abstieg sorgsam gesichert.
Am 26. September hatten Paul Bauer und seine Freunde den letzten, 60 Meter hohen Steilaufschwung gangbar gemacht und tags darauf auf 6600 Meter das Lager 9 eingerichtet.29 Am 2. Oktober konnten Allwein, Aufschnaiter, Kraus und Thoenes das Lager 10 in 7000 Meter Höhe auf dem breiten Rücken des Spornes beziehen.
Damit waren die großen technischen Schwierigkeiten des Aufstiegs überwunden. Peter Aufschnaiter notierte, wie es dann weiterging:
Mittwoch, 2. Oktober
Wir gehen alle mit Ketar und Pasang ohne Bauer nach Eislager III. Der Lawinenhang ist tief verschneit. Alisi [Allwein] geht voraus. Ich gehe sehr langsam. Im EL III starker Wind. Zelt aufschlagen. Gleich in die Schlafsäcke.
Donnerstag, 3. Oktober
Kraus und Alisi gehen nach oben, kehren bei 7400 m um und kommen ganz kaputt zurück. Eishöhlenbau. Nachmittag kommt Bauer, Beigel mit Lewa und Cheten. Wir ziehen in die Eishöhle um. Sie mussten ganz neu spuren.
Zwei Tage harren Aufschnaiter und seine Freunde in der Eishöhle aus.
Sonntag, 6. Oktober
Windig. Unten dichte Wolkendecken, oben Schleier. Beigel und ich gehen nach unten. Beigel soll nach Nepal. Ich soll Proviant nachschieben. Es ist ziemlich windig und neblig. Tiefes Spuren. Besonders am Horizontalstück vor dem Steilhang. Der Steilhang bricht ab, als Beigel mit den Überschuhen hineinsteigt. […] Im EL II ist kein Proviant außer etwas Tee und Schokolade. In der Nacht schneit es die Höhle zu.
Montag, 7. Oktober
Es hat schrecklich viel Schnee gemacht. Am Twinsturm springt Beigel 10 m ab. Ich halte ihn und folge in der Flanke nach. Bei der Karwendeltreppe stürzt Beigel. Ich halte ihn, aber sein Rucksack fällt ihm von den Schultern gegen die Kanchenseite. Mein Rucksack wird abgeseilt. Das EL I ist von einer Lawine eingedeckt. Nach längerem Suchen und Graben dringen wir ein. Kein Proviant. […] Beigel und ich beschließen, nach Adlerhorst abzusteigen. Obwohl es schon ein Uhr ist. (Heute 2. Tag ohne Essen). Der Grat ist tief verschneit. Wir tragen abwechselnd Rucksack. Vor dem Felsquergang nimmt Beigel den Rucksack. Ich gehe voran und räume den Fels vom Schnee. Beigel folgt nach und stürzt. Es reißt den Pickel um. Ich stürze mich auf die andere Seite [des Grates] hinab. Mit größter Mühe arbeite ich mich wieder auf die Schneekante empor (circa 15 Meter) und helfe Beigel wieder herauf. Es wird dunkel, und ich mache noch einen Versuch in der Abstiegsrichtung, sehe aber nichts mehr. […] Beigel stürzt wieder. Ich halte ihn aber ziemlich rasch. Beigel hat keinen Rock [Jacke]. Wir sitzen meist gegen Rücken, singen Lieder, erzählen. Die Schneewand, die vor der Steilseite liegt, wächst zusehends, denn es schneit unentwegt weiter. […] Am Morgen sind wir noch ganz gut beisammen. Der Schnee reicht dem Spurenden bis an den Hals. Nachmittag kommen wir auf den Adlerhorst, wo wir von Kraus und Thoenes gepflegt werden. Beigel hat Krämpfe und die Füße stark erfroren. Trotzdem herrscht fröhliche Stimmung im Zelt.30
Dass der Rückzug der Expedition nach diesem furchtbaren Wettersturz geordnet vollzogen wurde und ohne Unfall über die Bühne ging, ist eine der größten Leistungen im Himalaya-Bergsteigen.
Die Engländer hatten sehr gut erkannt, was Paul Bauer und seine Leute am Kangchenjunga vollbracht hatten, und feierten die deutsche Mannschaft, als hätte sie den Gipfel erreicht. Bedeutende britische Blätter wie die London Times und der Manchester Guardian hatten ausführlich und an prominenter Stelle über das Unternehmen berichtet.
Die Engländer waren nicht nur vom technisch versierten, strategisch klugen und hartnäckigen Umgang der Deutschen mit den außerordentlichen Schwierigkeiten am Berg beeindruckt, sondern auch von ihrer Fürsorglichkeit gegenüber der einheimischen Bevölkerung und den Hochträgern. Das renommierte Alpine Journal veröffentlichte im November 1930 einen ausführlichen Bericht Paul Bauers von dem Unternehmen. Der Schlusskommentar des Schriftleiters, Oberstleutnant Edward Lisle Strutt, spricht für sich: „Wir möchten uns ein weiteres Mal bei Dr. Bauer dafür bedanken, dass wir den Bericht von einer Unternehmung veröffentlichen durften, zu der es in der Geschichte des Bergsteigens vielleicht keinen Vergleich gibt.“31
Der international anerkannte Achtungserfolg der Bauertruppe beruhte vor allem auf der homogenen Leistungsfähigkeit ihrer Mitglieder sowie auf den Führungsqualitäten des Expeditionsleiters. Ausrüstung, Proviant und Transportmittel waren bis ins Detail durchdacht und wurden vor Ort mit militärischer Präzision zum Einsatz gebracht. Vor allem hatte es Paul Bauer aber geschafft, die Mitglieder seiner Expedition zu einer Einheit zusammenzuschweißen, die bereit war, für den Erfolg am Berg und für ihren „Hauptmann“ alles aus sich herauszuholen.
Paul Bauer und seine Mannen dachten nicht daran, sich geschlagen zu geben. Unterstützt vom Akademischen Alpenverein München, von der Sektion Hochland, der Sektion Oberland und vielen Einzelpersonen bereiteten sie eine zweite Expedition vor. Das Auswärtige Amt tat alles, um den Münchner Bergsteigern den Weg in den Himalaya wieder zu ebnen. Der Münchner Verlag Knorr & Hirth und sogar die London Times leisteten finanzielle Unterstützung. Auch der Deutsche und Österreichische Alpenverein steuerte einen namhaften Betrag bei.32
Allwein, Aufschnaiter, Brenner, Fendt und Leupold waren mit von der Partie, als Bauer 1931 wieder zum Sturm auf den Kantsch antrat. Dazu kamen vier weitere hervorragende junge Bergsteiger, die Bauer schon seit Jahren kannte: Hans Hartmann aus Berlin, Hans Pircher aus Innsbruck, Hermann Schaller aus München und Karl Wien aus Berlin.
Als die Deutsche Himalaya-Expedition 1931 sich Anfang Juli am Fuß des Kangchenjunga einfand, war das Wetter viel wärmer als zwei Jahre zuvor. Der Aufstieg zum Grat war extrem von Lawinen und Steinschlag bedroht. Die Schneeauflage war wesentlich geringer als 1929, was den Aufstieg zum Teil erschwerte. An dem von filigranen Hartschneetürmen bestandenen horizontalen Gratstück des Sporns erlitt Eugen Allwein einen ernsten Ischias-Anfall. Einer nach dem anderen erkrankten die Expeditionsmitglieder an einem schweren Husten. Die besten Träger bekamen Mumps.
Am 9. August stürzte Hermann Schaller am ersten Steilaufschwung des Grates auf rund 6000 Meter Höhe zusammen mit dem Träger Pasang tödlich ab. Paul Bauer hatte die Gefahr gewittert: „[…] Eine eindringlichste Warnung, wie sie aus tieferer Erfahrung instinktmäßig geboren wurde, ohne dass ich zunächst noch wusste wieso, war in mir. […] Ich hob die Trillerpfeife mehrmals an die Lippen, um alles zurückzurufen; der Weg sollte neu, anders geführt, der Umzug aufgeschoben werden. Aber ich setzte die Pfeife immer wieder ab. Schaller und die beiden Träger waren schon am Fuß der Rinne drüben, Hartmann und Wien stapften schon über die Vorterrasse. Sie hätten die schwere Stelle wieder im Abstieg machen müssen, wenn ich sie zurückgerufen hätte. […] Auf einmal glitt lautlos ein schwarzer Körper – Pasang?! – heraus, Schallers Figur mit dem weitabstehenden Rucksack folgte unmittelbar ebenso lautlos, flog kopfüber, schneller als Pasang, über diesen hinweg, beide schlugen am Fuß der Eisrinne auf und schnellten in die Luft hinaus.“33
Die Schwierigkeiten zwischen 5500 und 6300 Meter am Nordostsporn des Kangchenjunga konnten es mit schwersten Alpenrouten der Zeit aufnehmen.
Auch der neben Bauer stehende Pircher war entsetzt. Heimfahren wollte er jedoch auf keinen Fall: „Aber unser großes Ziel, Hauptmann, geben wir doch nicht auf?!“34
Darauf konnte er sich verlassen! Paul Bauer ließ die Leichen bergen, die Expeditionsmitglieder errichteten ihrem Freund Hermann Schaller auf einer Felsinsel inmitten des Zemu-Gletschers ein Grabmal und setzten ihn und den Träger bei. Auch diesen schweren Unfall hatte letztlich die warme Witterung verursacht. Die Temperaturen waren nachts nur knapp unter den Gefrierpunkt gesunken. Der Träger Pasang hatte wohl im weichen Schnee den Halt verloren und Hermann Schaller mit in den Tod gerissen.35
Trotz der anhaltend schlechten Bedingungen am Berg und obwohl krankheitsbedingt nur noch die Hälfte der Expeditionsmitglieder einsatzfähig war – unter ihnen Peter Aufschnaiter –, bewältigte die Mannschaft den schwierigen Abschnitt des Sporns. Am 16. September traf Aufschnaiter zusammen mit Pircher im 7360 Meter hoch gelegenen Lager 1136 auf Wien und Hartmann, der sich beim Spuren auf den Sporngipfel schwere Erfrierungen an den Füßen zugezogen hatte. Der Expeditionsleiter hatte zurückbleiben müssen: Ein Herzanfall aus Überanstrengung hatte Paul Bauer zum Aufgeben gezwungen. Auch Peter Aufschnaiter war am Ende seiner Kräfte. Hans Hartmann notierte am 18. September in sein Tagebuch: „An der Eishöhle wurde aber nicht gebaut. Der Peter lag ganz apathisch im Zelt und schob die Arbeit immer hinaus. Er hat sich auch bei dem langen, schweren Dienst hier oben kaputt gemacht – bis endlich, es ist drei Uhr –Schritte hörbar werden und kurz darauf Alisi, Karlo und Peperl ins Zelt kriechen.“37 Allwein schildert, wie es den drei Bergsteigern ergangen ist beim Versuch, am 18. September droben am Nordgrat des Kangchenjunga das Lager 12 zu etablieren:
„Vom Lager weg (7650 Meter38) schwingt sich der breite Grat mäßig steil zu einer Schulter auf, von der weg er dann fast horizontal etwa einen Kilometer lang gegen den Gipfelaufschwung des Sporngipfels hinführt. Der Gang über diesen Grat war wohl das Schönste, was ich in den Bergen erlebt habe, ja vielleicht das Schönste, was man erleben kann. Wir waren glänzend in Form, das Marschieren über den ebenen Grat machte nicht viel mehr Anstrengung als ein steiler Aufstieg bei uns und dazu ein Ausblick, wie man ihn sicher nicht oft bekommen wird. […] Ein steiler Aufstieg noch und wir stehen am Sporngipfel; 8000 m zeigt der Aneroid, 60 Meter mehr als gestern. Nur 2 Stunden 10 Min. habe ich zur Überwindung dieser letzten 350 Höhenmeter benötigt; die Gefährten wenig mehr, ein Zeichen dafür, wie gut wir uns an die Höhe gewöhnt haben.“39
Tatsächlich hatte das Dreierteam eine Höhe von etwa 7700 Metern erreicht. 880 Höhenmeter über ihnen der höchste Punkt des Kangchenjunga. Doch ein steiler, extrem lawinengefährlicher Schneehang von rund 150 Metern Höhe versperrte den Zugang zur Schulter des Nordgrats. Allwein und Wien spurten hinüber zum Fuß des Aufschwungs, auf dem 50 Zentimeter Neuschnee abrutschbereit auf einer Harschschicht aufliegen. Eine Lawine ist schon abgegangen, zwei Einrisse im Hang unterstreichen die Gefahr weiterer Schneebretter. Auch bei genauer Inspektion entdeckten die beiden keine Möglichkeit, das Hindernis zu überlisten. Es war zum Verzweifeln: Die Form passte, das Wetter war stabil, aber der zum Greifen nah erscheinende Gipfel blieb unerreichbar. Die zwei erfahrenen Alpinisten brauchten keinen Rückzugsbefehl ihres „Hauptmanns“, um sich für den Abstieg zu entscheiden.
Wieder gelang es der Expeditionsmannschaft, den Rückzug vom Berg geordnet und unfallfrei abzuwickeln. Und wieder wurden Bauer und sein Team bei ihrer Rückkehr von den englischen Kolonialbeamten wie Sieger gefeiert. Die Münchner Akademiker hatten bewiesen, dass es möglich war, ohne Sauerstoffgerät weit in die Todeszone vorzudringen. Der bekannte Geograf und Himalaya-Kenner Kenneth Mason brachte die Bewunderung der britischen Fachwelt im Alpine Journal auf den Punkt: „Ein ausführlicher Kommentar zu dem Kampf von 1931 wäre die reine Anmaßung. Es reicht aus festzustellen, dass die Expedition, was die bergsteigerische Leistungsfähigkeit, die Ausdauer und vor allem das Urteilsvermögen angeht, für alle Zeit das klassische Vorbild sein wird.“40
Auch zu Hause in München war der Empfang triumphal. Tausende drängten in das Auditorium Maximum der Universität, um den Vortrag des Expeditionsleiters zu erleben. Paul Bauers umfangreiches und heute noch höchst lesenswertes Werk Im Kampf um den Himalaja, das 1931 erschien, war im Nu vergriffen. Seinem Autor wurde beim Literaturwettbewerb der Olympiade in Los Angeles 1932 die Goldmedaille für die hochwertigste Sportpublikation verliehen.
Peter Aufschnaiter war nach dem Rückzug vom Kantsch nicht sofort heimgefahren. Er hatte den lebhaften Wunsch verspürt, jene Gegend kennenzulernen, auf die er Tag für Tag von den Hochlagern herabgesehen hatte, denn ihre „sanften, rötlichbraun gefärbten Formen bildeten einen wunderbaren Gegensatz zu der eis- und schneestarrenden Wildnis, in der wir uns herumschlugen“.41
Am 30. September 1931 stieg Aufschnaiter mit Joachim Leupold und drei Trägern vom Basislager aus nach Norden an und gelangte über einen rund 6000 Meter hohen, spaltenreichen Pass auf den weitläufigen Hidden Glacier. Am andern Tag spurte das kleine Team drei Stunden lang hoch zum 5800 Meter hohen Hidden Col. „Dort war nun zum ersten Mal das Lhonak vor uns ausgebreitet: ein sanft geformtes Bergland, eigentlich eine weite Mulde, die zwischen höheren Bergketten – im Süden das Kangchenzöngamassiv, im Norden die Dodang Nyima Kette – eingebettet ist und fast nur über Hochpässe erreicht werden kann.“42
Eine gute Woche lang durchstreifte der kleine Erkundungstrupp noch das nördliche Bergland von Sikkim, vorerst in nordöstlicher Richtung. Nach dem Aufstieg zum 5600 Meter hohen Übergang Dongkia La erreichten Peter Aufschnaiter und seine Freunde die tibetische Grenze. „[…] Quer über den Sattel verläuft bis zu den nachbarlichen Höhen eine breite Mauer aus lose aufeinander geschichteten Steinen. […] Noch einmal blickten wir zurück in das verbotene Land des Dalai Lama: zu unseren Füßen die tiefblaue Fläche des Tso Lhamo inmitten einer orangeroten Wüste, dahinter weite Hochflächen, auf denen sich in blauer Ferne schneebedeckte Gebirgszüge aufbauten.“43 Dieser Anblick mag auf Peter Aufschnaiter viel tiefer gewirkt haben, als er das damals am 7. Oktober 1931 ahnte.