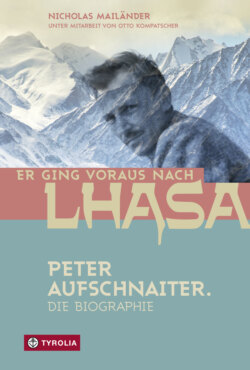Читать книгу Er ging voraus nach Lhasa - Nicholas Mailänder - Страница 12
KAPITEL 4 IN DER ALPINEN MACHTZENTRALE
ОглавлениеVom 30. Juli bis zum 14. August 1932 fanden in Los Angeles die 10. Olympischen Sommerspiele statt. Auch deutsche Bergsteiger wurden geehrt: Die Erstbesteiger der Matterhorn-Nordwand, Franz und Toni Schmid aus München, erhielten olympisches Gold, den Prix olympique d’alpinisme; Franz nahm auch die für seinen Bruder vorgesehene Medaille in Empfang – Toni war im Frühsommer des Jahres in der Wiesbachhorn-Nordwestwand tödlich abgestürzt. Paul Bauer wurde in Los Angeles zum Olympiasieger im „Wettbewerb der freien Künste“ in der Rubrik „Literatur“ für sein Kangchenjunga-Werk Kampf um den Himalaja gekürt. Der prominente Expeditionsleiter dürfte die Reise von München an die ferne Westküste der USA mit einer gewissen Unruhe angetreten haben. Denn er wusste, dass zeitgleich eine starke deutsch-österreichisch-amerikanische Expedition am 8125 Meter hohen Nanga Parbat zugange war.
Es war erstaunlich, dass die Expedition überhaupt stattfinden konnte. Aber der hochmotivierten Mannschaft gelang es doch irgendwie, für das geplante Low-Budget-Projekt die notwendigen Geldmittel lockerzumachen. Teilnehmer: Der „Hochländer“ Herbert Kunigk aus München, der aus dem bayerischen Trostberg stammende „Bayerländer“ Fritz Bechtold und sein amerikanischer Sektionskamerad Elbridge Rand Herron, der Kufsteiner Peter Aschenbrenner, der Leipziger Felix Simon sowie das 1929 in die USA ausgewanderte Kletterass Fritz Wiessner. Leiter des Unternehmens war der Traunsteiner Willy Merkl, welcher unter den sieben Spitzenalpinisten als „primus inter pares“ fungierte. Die Hierarchie in der Truppe war also denkbar flach, und der „nationale Gedanke“ spielte überhaupt keine Rolle. Ziel der Expedition war einzig und allein die Besteigung des ersten Achttausenders. Die gängige Einschätzung, der Nanga Parbat sei eine leicht zu knackende Nuss, erwies sich bald als grundfalsch. Trotzdem erreichten Kunigk und Aschenbrenner am 16. Juli den 7070 Meter hohen Rakhiot Peak. Dann zwang ein Wettersturz die Mannschaft zum Rückzug. So konnte das Team zwar keinen Gipfelerfolg verbuchen, aber es hatte einen machbaren Aufstieg zum höchsten Punkt des Nanga Parbat ausfindig gemacht.
Als die deutschen Mitglieder der Expedition im Spätsommer 1932 in ihre Heimat zurückkehrten, war die NSDAP hier zur stärksten politischen Kraft avanciert. Allerdings hatten die Nationalsozialisten reichsweit mit 37,3 Prozent die absolute Mehrheit verfehlt. Doch Hitler ließ nicht locker: Gemeinsam mit den Kommunisten setzte er eine weitere Neuwahl durch. Obwohl die NSDAP in der Novemberwahl 34 Mandate einbüßte, ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler am 30. Januar 1933 ganz legal zum Reichskanzler. Am Abend des 27. Februar ging der Reichstag in Berlin in Flammen auf. Hitler erklärte, er sei von Kommunisten angezündet worden – als Signal für einen Volksaufstand. Schon am nächsten Tag unterzeichnete Hindenburg die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“, in der wichtige Grundrechte „bis auf weiteres“ aufgehoben, die rechtsstaatlichen Kontrollmechanismen beseitigt und die KPD verboten wurden. Am 5. März errangen die Nationalsozialisten bei den Reichstagswahlen 43,9 Prozent der Stimmen und die mit ihnen verbündete Deutschnationale Volkspartei DNVP 8 Prozent, womit die Koalition verfassungsgemäß regieren konnte.
Am 21. März wurde in der Potsdamer Garnisonskirche feierlich der neue Reichstag eröffnet. Die Kommunisten waren ausgeschlossen, die Sozialdemokraten ferngeblieben. Am 24. März stand das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ – bekannt geworden unter dem Begriff „Ermächtigungsgesetz“ – auf dem „parlamentarischen“ Programm. Es ermächtigte die Reichsregierung, für vier Jahre unter Ausschluss des Reichstags auf dem Verordnungsweg Gesetze zu beschließen. Damit war die Machtergreifung der Nationalsozialisten eine unumkehrbare Tatsache.
Eine der ersten Maßnahmen der Regierung war die „Gleichschaltung“, die Vereinheitlichung des gesamten politischen und gesellschaftlichen Lebens. Nachdem Hans von Tschammer und Osten am 28. April 1933 zum Reichskommissar für Turnen und Sport ernannt worden war, erließ er Richtlinien zur Gleichschaltung des Sports. Der entsprechenden Aufforderung eines ranghohen NSDAP-Funktionärs entgegnete das AV-Hauptausschussmitglied Georg Leuchs in einem Schreiben, „dass eine Gleichschaltung unnötig erscheine, nachdem der Alpenverein von vaterländisch gesinnten Männern geleitet werde“.1 Im selben Sinne verhandelte der als Vorsitzender des DuÖ-AV-Verwaltungsausschusses vorgesehene Stuttgarter Unternehmer Dinkelacker mit der Reichsregierung. Dessen ungeachtet war von Tschammer und Osten entschlossen, die „reichsdeutschen“ Sektionen des DuÖAV in einem „Deutschen Bergsteiger- und Wanderverband“ zusammenzufassen.
Der Reichssportkommissar machte sich auf die Suche nach einem geeigneten „Führer“ für die Fachsäule XI „Deutscher Bergsteiger- und Wanderverband“ (DBWV) des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen. Bei einem Lehrgang der Reichsärztekammer auf dem Gut Neurössen in Sachsen-Anhalt bat er den Leiter dieser Schulung – es war Dr. Eugen Allwein! –, die Führung des nationalen Bergsteigerverbandes zu übernehmen. Eugen Allwein junior, Sohn des damaligen NS-Ärztefunktionärs, berichtet: „Da sagte mein Vater: ‚Das kann ich nicht, will ich nicht! Da kenne ich einen, der besser dafür geeignet ist, den Paul Bauer.‘ Abends hat mein Vater den Paul Bauer angerufen: ‚Steig in den Nachtzug, morgen früh zum Frühstück musst du in Berlin sein!‘ So ging das alles los. Das war alles mehr oder weniger Zufall. Der Paul Bauer war ein bekannter Mensch – er hatte 1932 in Los Angeles für sein Buch über den Kantsch eine Goldmedaille bekommen – und er war auch ein guter Selbstdarsteller. In dieser Nazigrößenordnung musste man das sein.“2
Paul Bauer hatte nach eigener Aussage bereits früh mit Adolf Hitler sympathisiert, war aber – wahrscheinlich aus Rücksicht auf seine englischen Expeditionskontakte – erst nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten Mitglied der NSDAP geworden. Er selbst stellte das folgendermaßen dar:
„[…] Ich habe meine politische Meinung seit der Rückkehr aus Krieg [Erster Weltkrieg] und Gefangenschaft nie geändert. Ich stand als ehemaliger Freikorpskämpfer 1923 mit dem Gewehr bereit, um mit Hitler zu marschieren. Ich habe mich schon damals in der nationalsozialistischen Presse betätigt. Als ich der Partei beitrat, war das nur die Erfüllung einer Formalität und unser Kreisleiter kam in Erkenntnis dieser Tatsache persönlich zu mir in mein Büro, um mir das Aufnahmeformular zur Unterschrift vorzulegen. […]3
Paul Bauer trat am 1. Mai 1933 in München der NSDAP bei und erhielt die Mitgliedsnummer 2302048.4
In einer Reihe von Rundschreiben brachte der frischgebackene „Führer“ des Deutschen Bergsteiger- und Wanderverbandes den Alpenvereinssektionen die neuen Organisationsstrukturen zur Kenntnis:
„An die reichsdeutschen Sektionen!
[…] Die reichsdeutschen Sektionen des D.u.Oe.A.V. und die reichsdeutschen Ortsgruppen ausländischer Alpenvereinssektionen […] unterstehen uneingeschränkt den für das deutsche Sportleben massgebenden Grundsätzen, und gehören demnach in die Gruppe Bergsteigen des DBWV. Ihre Zugehörigkeit und Bindung an den D.Oe.A.V. besteht daneben unverändert weiter. […]
Der Aufbau der Fachschaft muss bis Ende November des Jahres abgeschlossen werden, die Sektion wird deshalb ersucht, den beiliegenden Fragebogen bis spätestens 25. November 1933 ausgefüllt an die Geschäftsstelle des DBWV München, Sendlingerstrasse 42, einzusenden.
| Mit Berg-Heil! | und Heil Hitler! |
| Paul Dinkelacker | Paul Bauer |
| Vorsitzender des Verwal- | Führer des Deutschen Berg- |
| tungsausschusses des | steiger- und Wanderver- |
| D.u.Oe.A.V. | bandes.“5 |
Immerhin: Auf Grund der Zwischenstaatlichkeit des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins und um den Hüttenbesitz in Österreich nicht zu gefährden – war dem Alpenverein als einzigem deutschen Sportverband die Eigengesetzlichkeit zugestanden worden; Eingriffe in das Gesamtgefüge unterblieben vorerst – bis 1938.
Allerdings wurden wichtige Positionen im Alpenverein nach und nach durch linientreue Nationalsozialisten besetzt. Dafür dürfte nicht zuletzt auch Paul Bauer gesorgt haben. So war es bestimmt kein Zufall, dass der Münchner Eugen Allwein im September 1933 in den DAV-Hauptausschuss gewählt wurde. Turnusgemäß übersiedelte in diesem Jahr die Verwaltung des Alpenvereins von Innsbruck nach Stuttgart.6 Paul Bauer stand in keinem guten Verhältnis zu dem schwäbischen Verwaltungsausschuss, zu dessen Mitgliedern auch ausgewiesene Demokraten wie Hermann Hoerlin zählten. Allwein konnte darüber wachen, dass sich die Schwaben nicht allzu weit von der Linie des DBWV entfernten. Zusammen mit Allwein gehörten auch die Bauer-Vertrauten Lutz Pistor und Karl Wien zur Zeit der NS-Herrschaft dem Hauptausschuss des DuÖAV an und vertraten die Interessen ihres „Hauptmanns“ im zweithöchsten Entscheidungsgremium des Alpenvereins.
Auch andere Mitglieder des Freundeskreises von Paul Bauer wirkten bei der Gleichschaltung des deutschen Bergsteigens mit. So veröffentlichte Wilhelm Fendt in den Mitteilungen der Gruppe Bergsteigen7 des DBWV den umfangreichen Beitrag „Dietarbeit8 in den Bergsteigervereinen“, in dem sich der ehemalige Freikorpskämpfer dafür starkmachte, „das völkische Erziehungswesen in der deutschen Bergsteigerbewegung planvoll zur Durchführung zu bringen“.9 Zur Erfüllung dieser Aufgabe sei in jeder bergsteigerischen Gruppierung ein sogenannter Dietwart – eine Art nationalsozialistischer Politkommissar – zu bestellen.
Paul Bauer war bis 1938 der ranghöchste nationalsozialistische Sportfunktionär.
Die leitenden Prinzipien der weltanschaulichen Schulung seien – so Fendt – „Rassenreinheit“, „Volkseinheit“ und „Geistesfreiheit“. Der Autor sah es als die „erste und heiligste Pflicht“ der Bergsteigervereine an, „[…] alle und jedes Mittel zu suchen und anzuwenden, um der Vermischung des deutschen Volkes mit fremdstämmigem Blut Einhalt zu gebieten“. Besonders eindringlich glaubte Fendt hier vor den Juden warnen zu müssen: „Wir ließen uns von der Gleichheit der Hautfarbe über die Fremdstämmigkeit hinwegtäuschen und viele Volksgenossen haben sich mit unserem Gastvolk vermischt und haben einen zersetzenden Zeitgeist in das deutsche Volk hineingetragen. […]“10 Zur Herstellung von „Volkseinheit“ hätten die Dietwarte „[…] die zur Zeit besonders dringliche große Aufgabe, die Verbundenheit mit den deutschen Bergsteigern und Bergfreunden in Oesterreich zu pflegen und Verständnis für ihren Kampf und ihr Schicksal zu verbreiten“.11 Die „Geistesfreiheit“ der Deutschen sah Fendt einer besonders heimtückischen Gefahr ausgesetzt: „Hier müssen wir uns darüber klar werden, dass die Beeinflussung der Presse und Publizistik, von Theater und Film durch Judentum und Freimaurerei zu einer planvollen Aushöhlung und Irreführung arteigenen Wesens und einem weltbürgerlichen Phantom geführt hat. […]“12 Es dürfte nicht am mangelnden Glauben des Nationalsozialisten Wilhelm Fendt13 an die Bedeutung seiner Mission gelegen haben, dass das Dietwesen im Alpenverein kaum Fuß fassen und sich schon gar nicht durchsetzen konnte.
Ein weiterer überzeugter Nationalsozialist aus den Reihen des AAVM war der Kantsch-Veteran Karl „Kai“ von Kraus. Heinz Tillmann berichtete, dass ihn politische Unbotmäßigkeiten in seinem Umfeld zur Drohung veranlassten, „Ich bring“ Sie (oder dich) nach Dachau!“14 Kraus war Generalarzt des Roten Kreuzes. Als er in dieser Eigenschaft einmal mit einem schweren Wagen à la Maybach beim AAVM vorfuhr, soll er von seinen Kameraden schallend ausgelacht worden sein.15 Eine der berühmten Kneipzeitungen des AAVM enthält folgenden auf „Kai“ von Kraus gemünzten Spottvers:
„Politik ist jetzt sei Leibspeis,
Rabiat wird er ganz geschwind,
Und er droht dir gleich mit Dachau,
Wenn er was nicht schicklich find.“16
Auch der zu verbandspolitischen und anderweitigen Ehren gelangte Eugen Allwein bekam sein Fett ab: „Leidgeprüft und als ein Wissender meistert er jetzt die Welt: Unser Alisi, V. in der S.H. des DÖAV, Mitglied im VWA und M. des AAVM, zugleich J.J.A. und D. in der Gem. Haidh., H.V.B. des RBL.“17 Es ist bemerkenswert, dass Paul Bauer, einst regelmäßig beißendem Spott ausgesetzt, nach 1933 geschont wurde.
Hinweise auf Peter Aufschnaiter sucht man in den AAVM-Kneipzeitungen zwischen 1933 und 1935 vergeblich. Laut dem 1933 veröffentlichten Jahresbericht des AAVM lebte Aufschnaiter im Herbst des Jahres in München.18 Am 22. April 1933 war der Diplomlandwirt in St. Johann in Tirol der NSDAP beigetreten und wurde unter der Mitgliedsnummer 1605636 geführt.19 Ein Foto aus dieser Zeit zeigt ihn, einer damals in Süddeutschland und Österreich weit verbreiteten Mode entsprechend, mit kleinem Schnauzbart und Rechtsscheitel. Während seine besten Freunde in wichtigen Positionen am Aufbau des „Dritten Reiches“ mitwirkten, zog sich Peter Aufschnaiter in den Jahren 1933 bis 1935 aus unbekannten Gründen in die Heimatgemeinde seiner Mutter, St. Johann in Tirol, zurück.
Vor allem dem politisch zuverlässigen und hocheffizienten Paul Bauer wurden von den neuen Machthabern anspruchsvolle Aufgaben anvertraut. Nachdem alle deutschen Alpenvereinssektionen dem Deutschen Bergsteiger- und Wanderverband bis Ende 1933 beigetreten waren, machte sich Verbandsführer Bauer an die Eingliederung der Mitglieder des traditionell sozialdemokratischen Touristenvereins „Die Naturfreunde“ in das neu entstandene Zwangssystem des deutschen Sports. Zwar hatte die TVDN-Reichsleitung unter Xaver Steinberger versucht, den Arbeiterverein als gleichgeschalteten Verband zu erhalten, obwohl seine Tätigkeit kurz nach der Machtübernahme verboten und das Vereinsvermögen eingezogen worden war. Als eine gründliche Ausforschung der TVDN-Ortsgruppen durch die Gestapo ergeben hatte, dass sich die Basis der Naturfreunde wesentlich weniger anpassungsfähig zeigte als die Vorstandsetage, wurde der Verband am 28. Februar 1934 offiziell aufgelöst. Seine Mitglieder kamen zum Teil in Alpenvereinssektionen unter, meist aber in lokalen Wandervereinen, die den Genossen eher die Freiheit ließen, ihr Naturerleben gemäß den althergebrachten Naturfreunde-Traditionen zu gestalten.20
Um die „Abwicklung“ ihres Verbandsvermögens zu bewerkstelligen, wurde Notar Bauer am 28. April 1934 zum Reichstreuhänder für den Touristenverein „Die Naturfreunde“ ernannt. Der DuÖAV-Hauptverein hatte deutlich gemacht, dass er mit dieser Angelegenheit nichts zu tun haben wollte, und beschränkte sich auf die Empfehlung an seine Sektionen, den Eintritt ehemaliger Naturfreunde so weit wie möglich zu erleichtern.21 Unter den Münchner Alpenvereinssektionen zeigte nur die Sektion Hochland für den Immobilienbestand der Naturfreunde Interesse: Im Sommer 1934 übernahm sie „pachtweise“ die Wimbachgrieshütte. Die meisten Naturfreundehäuser wurden dem Jugendherbergswerk übertragen, andere als Schulungsstätten der NS-Organisationen genutzt, einige von Privatpersonen gekauft.22 Der Sektion München hatte Paul Bauer – um eine „streng vertrauliche Behandlung der Angelegenheit“ bittend23 – ebenfalls den Erwerb zweier Naturfreundehäuser angeboten. Sowohl aus „rechtlichen als auch aus wirtschaftlichen Erwägungen“ lehnte der Beirat der Sektion das amtliche Ersuchen jedoch „vorerst“ ab.24
Aufgrund ihres Engagements beim Aufbau der nationalsozialistischen Herrschaftsstrukturen konnten weder Paul Bauer noch seine Getreuen die Zeit für einen weiteren Versuch an einem Achttausender erübrigen. Dagegen wussten ihre Konkurrenten um Willy Merkl und Willo Welzenbach den neuen Wind im Land geschickt für ihre bergsteigerischen Zwecke zu nutzen.
Abschied von Alfred Drexel auf dem Münchner Hauptbahnhof – für immer.
Im Gegensatz zur ersten deutschen Nanga-Parbat-Expedition im Jahr 1932 schöpfte das für 1934 geplante Unternehmen finanziell aus dem Vollen. Für die nationalsozialistische Propaganda war die Besteigung dieses Achttausenders ein hochwillkommener Anlass, der Welt gegenüber die Leistungsfähigkeit des Hitlerregimes unter Beweis zu stellen. Obwohl die meisten der Bergsteiger der Expedition das nationalsozialistische Gedankengut ablehnten, nahmen sie die politische Instrumentalisierung der Expedition hin, um ihre alpinistischen Zielsetzungen zu verwirklichen. Schweren Herzens fügte sich Welzenbach der Tatsache, dass der von ihm als organisatorisch unfähig eingeschätzte Willy Merkl die Leitung der Expedition übernehmen würde. Bei der Auswahl seiner Mannschaft bewies Merkl allerdings eine glückliche Hand. Mit Erwin Schneider, Peter Aschenbrenner, Alfred Drexel, Fritz Bechtold und Uli Wieland waren einige der besten Bergsteiger in Deutschland und Österreich vertreten. Dass die Machthaber in Berlin den Erfolg am Nanga Parbat nicht als eine Privatsache der Alpinisten betrachteten, machte Reichssportführer von Tschammer und Osten überdeutlich: „Die Eroberung des Gipfels wird zum Ruhme Deutschlands erwartet.“25
Wegen der Führungsschwäche des Expeditionsleiters wurde kostbare Zeit vergeudet. Erst am 4. Juli drangen Merkl, Wieland, Bechtold und Welzenbach auf die bereits 1932 erreichte Höhe von 7000 Metern vor. Welzenbach war mit der Vorgehensweise immer noch äußerst unzufrieden. Das durch Merkl – gemäß den Wünschen der nazistischen Machthaber – angestrebte Ziel, möglichst die gesamte Expeditionsmannschaft gemeinsam auf den Gipfel zu bringen, führte zu unlösbaren logistischen Problemen. Als analytischer Kopf machte sich Welzenbach keine Illusionen: „Man kann nicht einen Verein von zehn bis zwölf Leuten auf einen Achttausender bringen wollen. Dann kommt eben keiner hinauf. Aber alles Predigen ist hier vergeblich. Willy weiß alles besser. […] Ich setze große Hoffnung auf Schneider und Aschenbrenner, die mit ihrer Büffelnatur uns vielleicht doch noch den Erfolg erringen helfen.“26
Bereits am 6. Juli drangen Schneider und Aschenbrenner bis knapp unter die 8000-Meter-Grenze vor und warteten dort vier Stunden lang auf ihre Kameraden. In der festen Überzeugung, am folgenden Tag den Gipfel erreichen zu können, verbrachten die beiden dann zusammen mit Welzenbach, Merkl und Wieland sowie fast allen Hochträgern die Nacht im Lager 8 auf rund 7500 Meter knapp über dem Silbersattel. Noch waren alle bester Dinge. Erwin Schneider berichtete: „Abends singen wir in den Zelten, kaum können wir den Morgen erwarten. Früh um 5 Uhr sehe ich aus dem Zelt, es ist noch klar. Um 7 Uhr, als wir aufbrechen wollen, tobt ein furchtbares Schneetreiben um unsere Zelte. Das Schicksal hat sich gegen uns entschieden.“27
Von den sieben Sherpas und fünf „Sahibs“, die sich am 6. Juli 1934 im Lager 8 in die Startlöcher für den Gipfelsturm begeben hatten, überlebten nur Aschenbrenner, Schneider und der Sherpa Ang Tshering den fürchterlichen Wettersturz. Der Sherpa Gay-Lay hätte sich vielleicht retten können, zog es aber vor, bei seinem Bara-Sahib Willy Merkl auszuharren. Dem Expeditionsmitglied Fritz Bechtold blieb nichts anderes übrig, als die Überlebenden der gescheiterten Expedition in die Heimat zurückzuführen. Die drei am Nordgrat des Nanga Parbat verstorbenen Bergsteiger – Opfer einer Kombination von fehlerhafter Expeditionsplanung und Wetterpech – wurden von der Presse in Deutschland zu Nationalhelden hochstilisiert, die zur Ehre des Vaterlands gefallen seien.
Es kann als Politikum gewertet werden, dass Paul Bauer als leitender Funktionär des für den Bergsport zuständigen Fachamtes gegenüber seinem obersten Dienstherrn heftige Kritik an der desaströsen Nanga-Parbat-Expedition übte. Die Vorwürfe richteten sich allerdings nicht gegen die unglückselige Strategie des unfähigen Expeditionsleiters Willy Merkl, sondern gegen Mitglieder der Expedition, die nicht verantwortlich waren für die Katastrophe:
„Es ist nun hier noch hinzuzufügen, daß ich gegen die NPE [Nanga Parbat-Expedition] von vorne herein schwerwiegende sachliche Bedenken hatte. Zwischen Welzenbach und mir haben seit langem im AAVM sachliche Meinungsverschiedenheiten bestanden. Welzenbach war der Mann, dem in erster Linie der alpine Erfolg etwas galt, während mir der Weg und die Art und Weise des Bergsteigens mehr zu sein dünken. Welzenbach war der Mann, der Rekorde anstrebte, der Mann, der sich als Bergsteigerkanone fühlte und diese Position systematisch angestrebt und ausgebaut hat. Demgegenüber vertrat ich eine ganz andere Anschauung und diese Anschauung ist im AAVM, dem wir beide angehörten, der Welzenbach’schen Art des Bergsteigens gegenüber siegreich geblieben. Dazu kommt noch, dass ich von jeher als alter Soldat mich fühlte, im AAVM konsequent einen nationalen und nationalsozialistischen Kurs verfolgte. Für uns war Adolf Hitler bereits 1923 der Mann, den wir nicht antasten ließen. Welzenbach hingegen gehörte der Bayer. Volkspartei an und stand mit einigen wenigen seiner Art in Opposition dagegen, die zwar mit ihren eigentlichen Gründen nie herausrückte, da sie im AAVM keinen Boden gefunden hätte, die aber auch zielsicher und verbissen war, wie unsere Einstellung. […]
Mit Welzenbach habe ich früher manche große Bergfahrt und Erstbegehung gemacht. Aber es fühlte doch jeder den geistigen Abstand vom Andern, und die gemeinsamen Bergfahrten hörten schließlich auf […]“28
Auch Willy Merkl, Erwin Schneider und der mit ihm befreundete württembergische Spitzenbergsteiger Hermann Hoerlin bleiben in Paul Bauers Schreiben an den mächtigsten Mann im deutschen Sport nicht unerwähnt:
„Welzenbach und Merkl und die ihnen nahestehenden Hörlin und Schneider hatten auch dafür, daß es sich hier um eine nationale Angelegenheit handele, kein Verständnis, sie bauten ihren Plan 1930, 31 und 32 auf die Teilnahme begüterter ausländischer Bergsteiger auf – Schneider und Hörlin gingen 1930 mit dem Judenstämmling Dyhrenfurth in den Himalaja, sie hatten dabei nicht einmal den Mut die deutsche Flagge zu hissen, sondern hissten die ‚schwäbische‘ und ‚tiroler‘ Flagge!!“29
Nachdem der ranghöchste Funktionsträger des deutschen Bergsteigens das Ansehen von Welzenbach und dessen Umfeld bei den nationalsozialistischen Machthabern auf diese Weise nachhaltig beschädigt hatte, machte er Erwin Schneider endgültig zu einer „Persona non grata“, als Paul Bauer am 17. Dezember 1934 dem Büro des Reichssportführers in einem persönlichen Gespräch mitteilte, dass der Tiroler Alpinist in einem 1932 im Magazin Der Bergsteiger erschienenen Artikel den „Führer“ Adolf Hitler persönlich beleidigt haben sollte.30
Bei der Schilderung eines „Verhauers“ während der Erstbesteigung des Andengipfels Huascarán hatte sich der Tiroler erlaubt zu spotten: „Weinend treten wir den Rückzug an und versuchen nun, zur Einsicht gekommen und den Forderungen der heutigen Zeit folgend, rechts unser Heil. (Heil Adolf! Deutschland erwache!)“31
Willi Bernard, Erwin Schneider und Peter Aschenbrenner am Nanga Parbat (v. l. n. r.).
Wenige Tage später setzte eine Kampagne gegen Erwin Schneider ein: Zugesagte Gelder für die Finanzierung einer für 1935 geplanten Expedition zum Nanga Parbat wurden zurückgezogen. Der Alpenverein, den der Tiroler bereits für seine Pläne gewonnen hatte, erhielt die Aufforderung, gegen Schneider und Aschenbrenner ein Ehrengerichtsverfahren einzuleiten. Bauer unterstellte den beiden, sie hätten ihre Expeditionskameraden im Stich gelassen. Die vom Ersten Vorsitzenden Raimund von Klebelsberg durchgeführte Untersuchung entkräftete alle gegen die beiden erhobenen Vorwürfe. Aber Paul Bauers Einschreiten hatte Schneiders Vorbereitungen so weit behindert, dass ihre Expedition nicht stattfinden konnte.
Der Fachamtsleiter hatte genau gewusst, dass Schneider und Aschenbrenner hervorragende Chancen gehabt hätten, den Gipfel des Nanga Parbat zu erreichen und damit als erste Menschen auf einem Achttausender zu stehen. Paul Bauer plante für das Jahr 1935 einen weiteren Versuch am Kangchenjunga mit dem Ziel, das Rennen um den ersten Achttausender für sich zu entscheiden.32 Dies lässt den Schluss zu, dass Bauers folgenschwere Denunziation darauf abzielte, seine aussichtsreichsten Konkurrenten schachmatt zu setzen.
Vor diesem Hintergrund ist es wenig erstaunlich, dass die Mitteilungen des Fachamtes Bergsteigen im März des folgenden Jahres in Fraktur titelten: „Keine deutsche Himalajaexpedition im Jahre 1935“. Paul Bauer verheimlichte nicht, wer die Notbremse gezogen hatte: „Der Herr Reichssportführer hat […] die Entscheidung getroffen, dass im Jahre 1935 von den deutschen Bergsteigern kein Angriff auf den Nanga Parbat unternommen werden soll, weil es zeitlich unmöglich wäre, ein neues Unternehmen entsprechend vorzubereiten, ohne die noch unvollendete Abwicklung des letzten zu vernachlässigen. Auch gebietet die Majestät des Todes Zurückhaltung.“33
Allerdings beharrte der DuÖAV auf seinem Vorhaben, eine weitere Expedition zum Nanga Parbat zu entsenden. Die Mehrheit im Hauptausschuss favorisierte in der Sitzung am 1. Juni 1935 explizit die Teilnahme von Erwin Schneider und Peter Aschenbrenner. Der neu in den Ausschuss gewählte Bauer-Vertraute Karl Wien äußerte mit Hinweis auf die ablehnende Haltung des Reichssportführers Bedenken gegen Schneider als Expeditionsleiter. Auf Antrag des Vereinsvorsitzenden Raimund von Klebelsberg billigte der Hauptausschuss schließlich einstimmig den Plan einer DuÖAV-Expedition zum Nanga Parbat im Jahr 1936 mit deutschen und österreichischen Teilnehmern. Philipp Borchers wurde mit den Vorbereitungen beauftragt. Diesem Beschluss stimmten alle Mitglieder des Hauptausschusses zu – auch die dem Fachamtsleiter nahestehenden Eugen Allwein, Lutz Pistor und Karl Wien.34
Parallel zum Alpenverein bereitete auch Paul Bauer in Abstimmung mit dem Reichssportführer und gemeinsam mit Fritz Bechtold eine Expedition zum Nanga Parbat vor und veröffentlichte diese Absicht in der Augustausgabe der Mitteilungen des Fachamtes. Als Leiter der Expedition, die im Jahr 1937 stattfinden sollte, war derselbe Karl Wien vorgesehen, der als Hauptausschuss-Mitglied für eine Alpenvereinsexpedition zum selben Ziel gestimmt hatte.
Bereits auf verlorenem Posten, diskutierte der Hauptausschuss des DuÖAV am 30. und 31. August 1936 in Bregenz noch einmal ausführlich die zu entsendende Nanga-Parbat-Expedition und beharrte auf Philipp Borchers als Expeditionsleiter – gegen die drei Stimmen der Bauer-Fraktion.35 Es war das letzte Mal, dass das zuständige Entscheidungsgremium des größten Bergsteigerverbandes der Welt sich mit dem Thema beschäftigte.
Nach Ausschaltung des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins als Veranstalter von Expeditionen zu den Achttausendern machte sich Paul Bauer stringent daran, die unter seiner Ägide vollzogene weitgehende Gleichschaltung des deutschen Auslandsbergsteigens institutionell abzusichern. Und zwar durch die Einrichtung der sogenannten Deutschen Himalaja-Stiftung im Jahre 1936. Mit der Geschäftsführung bedachte Paul Bauer seinen bewährten Kameraden Peter Aufschnaiter. Einen besseren Chefadministrator hätte er sich kaum wünschen können. Denn Aufschnaiter war umfassend gebildet, beherrschte eine Vielzahl von Sprachen schriftlich und mündlich fast wie ein Muttersprachler, verfügte über hervorragende Kontakte im In- und Ausland, war bienenfleißig, sehr gut organisiert, wegen seiner bescheidenen, freundlichen Art allgemein beliebt – und seinem Freund und Vorgesetzten Paul Bauer bedingungslos ergeben. Diese Loyalität kennzeichnet auch die von Peter Aufschnaiter im Jahr 1939 verfasste Darstellung des Gründungsprozesses der Himalaja-Stiftung:
Als Fritz Bechtold die Nanga-Parbat-Kundfahrt 1934 nach ihrem tragischen Ende in die Heimat zurückgebracht hatte, tat er sich mit Paul Bauer zusammen, und beide setzten einen Gedanken in die Tat um, der bei den Teilnehmern der beiden Kantschfahrten schon lange im Keim vorhanden gewesen war: Sie schufen einen Mittelpunkt für die deutschen Himalaja-Unternehmungen, der in den Wechselfällen des Schicksals mehr Beständigkeit hat als das Leben eines einzelnen. Bechtold und Bauer gründeten im Verein mit dem Reichssportführer die Deutsche Himalaja-Stiftung. Der Reichssportführer stattete sie mit RM 5000.– aus, Fritz Bechtold stiftete RM 5000.– aus den Erträgnissen des ersten Nanga-Parbat-Films, Paul Bauer stiftete gleichfalls RM 5000. – aus den Honoraren für Bücher, Veröffentlichungen und Vorträgen über die beiden Kantschfahrten, die er verwaltete. […]
Im Mai 1936 wurde die Stiftung von der Regierung genehmigt mit dem Zweck, bergsteigerische Kundfahrten in den Himalaja und andere entlegene Gebirge durchzuführen und zu fördern und Mittel für diesen Zweck zu werben. […]
Noch im Jahre ihrer Gründung, 1936, rüstete die Stiftung eine Rundfahrt in den Sikkim-Himalaja aus, die bergsteigerisch sehr interessante Ergebnisse brachte und der vor allem zur Überraschung der gesamten Bergsteigerwelt die Ersteigung des bis dahin für unmöglich angesehenen Siniolchu gelang. […]36
Abgesehen davon, dass diese Schilderung ein Musterbeispiel ist für die Umdeutung einer feindlichen Übernahme in eine der Förderung des Bergsteigens verpflichtete Mission, enthält sie auch eine aufschlussreiche sachliche Ungenauigkeit. Denn tatsächlich begannen die Vorbereitungen für die Kundfahrt zum Siniolchu nicht erst 1936, sondern sie waren bereits Ende November 1935 in vollem Gang. Dies geht aus einem in englischer Sprache verfassten Brief an den Privatsekretär Seiner Hoheit des nepalesischen Maharaja in Kathmandu hervor, den Paul Bauer am 27. November 1935 unterzeichnete:
„[…] eine kleine Gruppe von drei oder vier deutschen Bergsteigern unter meinem Kommando beabsichtigt zwischen den Monaten August und Oktober nächsten Jahres, 1936, die Besteigung einer Reihe von hohen Bergen durchzuführen, die an der Grenze zwischen Sikkim und Nepal, liegen – nicht jedoch des Gipfels des Kangchenjunga selbst. […] Wir […] bitten demütig darum, sollte dies notwendig sein um Leben zu retten, mit Erlaubnis Seiner Hoheit nepalesischen Boden betreten zu dürfen, wobei wir versprechen, das Territorium Nepals so schnell wie möglich zu verlassen und nach Sikkim zurückzukehren über die Pässe Lhonak La, Jonsong La oder Kambachen, Tseram, Talung La oder Kann La. […] Ich vertraue darauf, dass Ihre Hoheit geneigt sein dürfte, unsere Anfrage zustimmend zu beantworten.
Ich habe die Ehre, sehr geehrter Herr, als Euer allergehorsamster Diener zu verbleiben.
Paul Bauer
Führer der Deutschen Himalaja
Expeditionen 1929 und 1931“37
Höchstwahrscheinlich dürfte der Unterzeichnende diese ehrerbietigen Zeilen nicht selbst verfasst haben, sondern sein Freund Peter Aufschnaiter.
Da im AAVM-Jahresbericht 1934/35 als Wohnort von Peter Aufschnaiter zum Stichtag 1. November 1935 noch St. Johann in Tirol genannt wird38, ist es anzunehmen, dass er im Laufe des Monats wieder nach München übersiedelte, um die für den Sommer 1936 geplante Siniolchu-Kundfahrt seines Förderers vorzubereiten. Vorerst dürfte Aufschnaiter jedoch hauptsächlich als Geschäftsführer des AAVM tätig gewesen sein, betraut mit der ehrenvollen Aufgabe, den notorisch auf seine Eigenständigkeit versessenen Akademikerklub als Sektion in den DuÖAV und damit in den Deutschen Bergsteigerverband einzugliedern.39
Die Rakhiotflanke des Nanga Parbat, von der Gegend um die Märchenwiese aus gesehen.
Die Deutsche Himalaja-Stiftung wurde am 28. Mai 1936 vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus in München genehmigt und in das Verzeichnis der von der Regierung von Oberbayern zu beaufsichtigenden Stiftungen aufgenommen.40 Reichssportführer von Tschammer und Osten bestellte Fritz Bechtold zum Vorstand der Stiftung.41 Diese war zwar de jure eine selbständige Institution. Die Entscheidungsgewalt über die Aktivitäten der Stiftung lag jedoch beim Reichssportführer, der die Weisungsbefugnis an Paul Bauer als Chef des Fachamtes Bergsteigen übertrug. De facto war die Deutsche Himalaja-Stiftung im Dritten Reich damit nichts anderes als die für Auslandsbergfahrten zuständige Abteilung des nationalsozialistischen Fachamtes für Bergsteigen – geleitet von Peter Aufschnaiter.
Im März 1936 hatte Paul Bauer den jungen Münchner Spitzenbergsteiger Adolf Göttner zur Teilnahme an einer Himalaya-Kundfahrt in das Gebiet des Kangchenjunga eingeladen, die auf die Erstbesteigung des markanten Sechstausenders Siniolchu abzielte. Die Bauer-Vertrauten Günther Hepp und Karl Wien vervollständigten das kleine Expeditionsteam, das sich vorgenommen hatte, zwei eindrucksvolle Gipfel im Sikkim-Himalaya zu besteigen: den Tent Peak sowie den als „schönsten Berg der Welt“ bezeichneten Siniolchu. Bauer verfolgte damit weitergehende Ziele: „Wir wollten dort erproben, welche Möglichkeiten sich einer kleinen, leicht beweglichen Mannschaft bieten würden, zugleich wollten wir den Führer und die Kernmannschaft für den beabsichtigten dritten Angriff auf den Nanga Parbat schulen und Ausrüstung, Lebensmittel und Angriffsmethoden hierfür nochmals eingehend prüfen und verbessern.“42 Instabiles Wetter drohte dem schlagkräftigen Quartett die hochgesteckten Pläne zu vereiteln. Ihren Versuch am Tent Peak mussten Göttner und Wien wegen erheblicher Lawinengefahr abbrechen.
Nach sechs Schlechtwettertagen im Basislager starteten die vier am 21. September 1936 den entscheidenden Versuch am Siniolchu. Bauer, Wien, Hepp und Göttner gingen den schwierigen Sechstausender im Alpinstil an. Abends hackten sie in rund 6400 Metern Meereshöhe auf dem steilen, stark überwechteten Westgrat Sitze in den Firn und harrten auf den Morgen. Um acht Uhr in der Früh erreichte das Team die Scharte zwischen Vor- und Hauptgipfel. Hier blieben Bauer und Hepp zurück, um der Gipfelmannschaft „den Rückzug zu sichern“. Sechs Stunden später durchschlug Göttner die Gipfelwechte und betrat den höchsten Punkt: 6887 Meter. Die Bergsteiger befestigten einen „Hakenkreuzwimpel am Eispickel und schwenkten ihn laut jubelnd“, um ihren Kameraden in der Scharte den Erfolg zu melden.43
Paul Bauer hatte wieder einmal bewiesen, dass er nicht nur ein gewiefter alpinpolitischer Strippenzieher war, sondern auch ein hervorragender Bergsteiger und umsichtiger Expeditionsleiter!
Der gelernte Schildermaler Adolf Göttner hatte zusammen mit anderen Jungmannschaftsmitgliedern der DuÖAV-Sektion München – hier sind vor allem Ludwig Schmaderer, Martin Meier, Herbert Paidar, Josef Thürstein, Otto Eidenschink, Gottlieb Rosenschon, Alfred Seidl, Rudolf Unterberger sowie die Brüder Ludwig und August Vörg zu nennen – durch hervorragende Leistungen in den Alpen auf sich aufmerksam gemacht. Finanziert vor allem durch die Sektion München, fuhren Göttner, Rosenschon, Schmaderer und Vörg im Juni 1935 mit der Eisenbahn in den Kaukasus. Hier gelangen mehrere Erstbesteigungen. Elbrus und Kasbek wurden erstiegen. Krönung war die Überschreitung der beiden Uschbagipfel erstmals von Süden nach Norden.44 Im Sommer 1936 hatte Adolf Göttner eigentlich an einer weiteren Kundfahrt der Münchner Jungmannschaft teilnehmen wollen, hatte aber kurzfristig die Chance ergriffen, mit Paul Bauer zum Siniolchu zu fahren.45
So reisten seine Kameraden Schmaderer, Vörg, Thürstein und Herbert Paidar ohne ihn in den Kaukasus. Mit den ersten Durchsteigungen der Nordwand des Schchelditau durch Schmaderer und Paidar sowie der 2000 Meter hohen extrem schwierigen Westwand des Uschba durch Schmaderer und Vörg eröffneten die jungen Münchner eine neue Ära in der Geschichte des Kaukasusbergsteigens.46
Zusammen mit den leistungsfähigen Jungmannschaftsmitgliedern der Sektion München brannten auch die anderen deutschen Spitzenalpinisten darauf, sich im Himalaya zu bewähren. Leistungsträger wie Otto Eidenschink, Hans Ertl, Anderl Heckmair, Hermann Hoerlin, Martin Meier und Rudolf Peters gehörten damals zu den besten Bergsteigern der Welt. Für den Leiter des Fachamtes für Bergsteigen zählten sie aber – wie der verstorbene Willo Welzenbach – zu jenen Elementen, denen es in erster Linie um den bergsteigerischen Erfolg ging und die keinen Sinn dafür hatten, dass die erste Besteigung eines Achttausenders vor allem eine „nationale Angelegenheit“ zu sein hatte. Zwar förderte das Fachamt einzelne Kundfahrten junger Nachwuchsbergsteiger in den Kaukasus oder in die Anden.47 Die international bedeutenden Ziele blieben jedoch den Vertrauten von Fachamtsleiter Bauer vorbehalten, mit wenigen handverlesenen Ausnahmen. Diese weitgehende Monopolisierung des Himalaya-Bergsteigens kam bei der jungen Garde überhaupt nicht gut an. So beschwerten sich Herbert Paidar und Ludwig Schmaderer in einem Schreiben an ihren Freund Fritz Schmitt, den bekannten Alpinliteraten und späteren Schriftleiter des Deutschen Alpenvereins, über den Egoismus von Paul Bauer. Sie gestanden dem Fachamtsleiter aber auch zu, „aus einem harten, wenn auch nicht wohlriechenden Holz geschnitzt“ zu sein.48 Peter Aufschnaiter schnitt im Urteil der jungen Spitzenbergsteiger wesentlich günstiger ab: „Er ist ein gewissenhafter Mensch, der viel weiß, doch manchmal unter der gelesenen Büchermasse zu leiden scheint. Im Übrigen kann Bauer froh sein, dass er einen so ergebenen Mitarbeiter hat, der so zur Stange hält; denn sie sind selten!“49