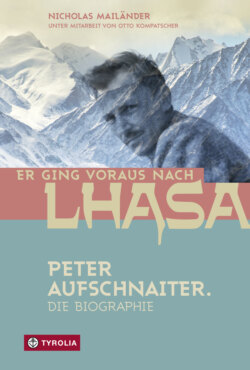Читать книгу Er ging voraus nach Lhasa - Nicholas Mailänder - Страница 8
KAPITEL 2 FREUNDE FÜRS LEBEN
ОглавлениеWir wissen nicht, warum Peter Aufschnaiter sein Studium an der Universität Innsbruck nach rund einem Jahr abbrach. Wir wissen aber, dass er sich während des Sommersemesters 1921 und in den anschließenden Ferien ausgiebig dem Bergsteigen widmete: Zwischen dem 15. Mai und dem 22. August finden wir allein im Hüttenbuch der südlich des Ellmauer Tors im Wilden Kaiser gelegenen Gaudeamushütte nicht weniger als zwölf Eintragungen des bergfleißigen Philologie-Studenten.
Wir wissen natürlich auch, mit wem Peterl im Kaiser unterwegs war. Meistens war das der aus Innsbruck stammende und seit 1920 in Kitzbühel ansässige Rechtsanwalt Dr. Otto Zimmeter. Bis zur Abschaffung des Adels in der Republik Österreich im Jahr 1919 hatte seine Familie von Zimmeter-Treuherz geheißen. Weitere Bergkameraden waren der Saalfelder AV-Sektionsvorsitzende und Notar Dr. Fritz Rigele sowie der spätere langjährige Rektor der Kitzbüheler Volksschule Michael („Much“) Wieser. Die Bergfreunde waren nicht nur allesamt verdiente Weltkriegsveteranen, die an der Alpenfront gekämpft hatten, sondern sie teilten auch die großdeutsche Gesinnung.
Die ausgeführten Bergfahrten lassen auf eine steil ansteigende Leistungskurve des alpin ambitionierten Studenten schließen, die am 21. August ihren Höhepunkt fand in einer Begehung der renommierten Dülfer-Führe durch die Fleischbank-Ostwand, gemeinsam mit dem Kufsteiner Ausnahmekletterer Franz Weinberger.
Ermutigt durch den Erfolg, versuchte sich Peter Aufschnaiter wenige Wochen später zusammen mit seinem Freund Otto Zimmeter nochmal an diesem Markstein der klettersportlichen Entwicklung. In einem Artikel schilderte der Rechtsanwalt anschaulich, wie es ihnen dabei ergangen ist:
„An einem strahlenden Septembermorgen gingen mein lieber Freund Peter Aufschnaiter und ich die Fleischbank-Ostwand an. Frohgemut kletterten wir darauf los, benützten aber gewissenhaft die vorhandenen Sicherungshaken, die in genügender Anzahl im Fels staken; denn gottlob hatte schon seit geraumer Zeit kein Hakenmarder mehr in der Wand gehaust. Leichtfüßig übertanzten wir die beiden Quergänge, die anstrengende Kaminreihe überlisteten wir in feiner Kletterei an der rechtseitigen Wand, dann kam der hübsche Gang um den Pfeiler und nun standen wir am unteren Ende der bekanntanstrengenden Schlussrisse. […]
Sie beginnen mit einer plattigen Steilrampe; knapp rechts von ihr ist eine mannshohe schwarze Höhle in die Wand geschnitten. Peterl stieg die Rampe hinan; die musste aber ekelhaft schwer sein; denn es schien, als ob er überhaupt nicht vom Fleck käme. Endlich hatte er sie hinter sich und befand sich nun genau oberhalb der Höhle; ich stieg nach; bei Gott, diese Stelle hatte sich gewaschen; die war wirklich bluthart und fürchterlich kraftraubend! Da setzte nun ein schwefelgelber Riss an, der wenig vertrauenserweckend aussah und weiter oben in der Wand versickerte. Ich stand auf einem handtellergroßen Plätzchen; zu meinen Füßen stak ein alter verrosteter Dülferhaken, wohl ein getreuer Zeuge jener berühmten Neufahrt durch Dülfer und Schaarschmidt. Durch einen Schnappring verband ich Haken und Seil und Peterl hing sich an den Riss wie ein Hetzhund an seine Beute. Er verklemmte seinen rechten Fuß ganz verzweifelt in dem Riss, schob sich mühsam und vorsichtig empor und keuchte dabei vor Anstrengung wie eine schadhafte Dampfmaschine. Bald kam er zu einem Felsnagel, der wie ein fauler Zahn wackelte; Peterl gab ihm zwar ein paar wuchtige Hammerschläge auf den Schädel; das nutzte aber auch nicht besonders viel; er kettete das Seil durch einen Federring an den Haken und kletterte wieder weiter. Peter war am oberen Rissende angelangt und musste nun mit weit ausgestrecktem Arm nach links hinüberlangen, um dort einen Griff zu erreichen und sich mit seiner Hilfe aus dem Riss nach links auf kletterbaren Fels hinüberzuschwingen. Ehedem schlug er aber zur Sicherung noch einen Felsnagel und hakte ein. Ich folgte seinem Tun mit gespanntester Aufmerksamkeit. Er befand sich jetzt ungefähr 20 Meter fast senkrecht über meinem Standplatz und langte nun hinüber nach links zu jenem Felszacken, der den Schlüssel zum Weiterweg bedeutet.
Plötzlich stieß sich Peterl mit einem sehr unstandesgemäßen Fluch von der senkrechten Wand weg und sauste auch schon vollkommen lautlos mit unglaublicher Geschwindigkeit knapp neben mir vorbei in die Tiefe. Mein erster Gedanke war: Wenn nur das Seil und die drei Haken halten, sonst liegen wir alle beide in wenigen Sekunden drunten in der Steinernen Rinne! Ich riss das Seil ein wie ein Verrückter. Die beiden oberen Haken wurden durch die fürchterliche Wucht des Sturzes aus der Wand gerissen, als wenn sie in Butter gesteckt hätten. Doch, Gott sei’s gedankt, der ehrwürdige Dülferhaken hielt. Er war eisenhart mit dem Berg verwachsen und hielt treu und fest wie dieser.
Als ich glaubte, dass der Sturz bald beendet war, hielt ich das Seil mit der übermenschlichen Kraft des Verzweifelten; blutige Hautfetzen flogen aus den Handflächen, doch mich beherrschte nur der einzige Gedanke: Nur das Seil nicht auslassen! Endlich hatte ich die Gewalt des Sturzes gebrochen, ich war Herr des Seiles geworden und fühlte, dass mein Freund frei schwebte; durch eine Kette unerhörter Glücksfälle war Peter gerade in die Höhle rechts der Rampe hineingependelt; er hatte sich dabei allerdings den Fuß schwer verletzt und seinen Schädel tüchtig angehaut, dass ein Teil der Rampe wie die richtige Fleischbank eines Metzgers aussah; er redete auch, als ich mich voll Angst um sein Schicksal zu ihm hinuntergeseilt hatte, allerhand irrsinniges Zeug daher, doch ich war heilfroh und dankte dem Himmel, dass ich ihn lebend antraf. […]
Wie ich dann um Hilfe schrie und gehört wurde, wie uns noch in später Abendstunde der Oberländer Dr. Hamm von der Steinernen Rinne aus Rettung für morgen früh versprach und uns dadurch das Warten zu einem aufregenden Erlebnis machte, wie wir mitten in der Fleischbank-Ostwand eine zwar bitterkalte, aber hochromantische, mondscheinumglänzte Beiwacht hielten und dabei wie die Murmeltiere schliefen, wie uns dann die wackere Kufsteiner Rettungsmannschaft mit ihrem Obmann Klammer an der Spitze aus den Felsen holte und dabei alles wie am Schnürchen ging, wie ich noch einen Morgenbummel über die Karlspitze machte, wie mir dann am Ellmauertor durch den Stripsenjochwirt mit einer Flasche Schnaps, die ich vor Freude und Durst unsinnigerweise über den Kopf austrank, der bisher größte Rausch meines Lebens angehängt wurde, sodass ich auf Grutten den Fernsprecher nicht mehr bedienen konnte – das soll alles nur nebenbei gesagt sein!“1
Wir können also davon ausgehen, dass Peter Aufschnaiter im Herbst 1921 mit einigen Kopfblessuren sein Studium der Landwirtschaft an der Technischen Hochschule München antrat. Den im Programm der Technischen Hochschule des Jahres 1921/22 enthaltenen dringenden Rat, „vor Beginn des Hochschulstudiums sich längere Zeit in der Landwirtschaft praktisch auszubilden“, hatte der lädierte Studienanfänger in den Wind geschlagen.2 Dies dürfte eine entschuldbare Unterlassung gewesen sein; denn am Beginn des agrarwissenschaftlichen Studiums an der Technischen Hochschule München stand damals die Aneignung der theoretischen Grundlagen im Vordergrund: „Da bei einem großen Teil der Fächer des Landwirtschaftsstudiums und seiner Grund- und Hilfswissenschaften im Winterhalbjahre mit den grundlegenden Vorlesungen begonnen wird und das Sommerhalbjahr auf das im Winter gewonnene Wissen aufbaut, so ist das Studium im Winterhalbjahr zu beginnen.“3 Den Weg von seiner Studentenbude in der Adelgundenstraße 10 im Stadtteil Lehel zur rund zweieinhalb Kilometer entfernten Hochschule legte Peter Aufschnaiter wohl auf dem Fahrrad zurück, um dann von der Luisenstraße einige Treppenstufen zu ersteigen und weiter in den Hörsaal zu humpeln.
Ziemlich sicher ist auch, dass der Studienanfänger nach dem erlittenen Schaden nicht für den gutmütigen Spott sorgen musste, als er eines Abends das Nebenzimmer des Restaurants „Domhof“ betrat, wo seit neuestem die Versammlungen des Akademischen Alpenvereins München (AAVM) stattfanden. Die Quellen weisen darauf hin, dass der frischgebackene Studiosus agrarius in diesem sowohl gesellschaftlich als auch alpinsportlich elitären Zirkel von Beginn an willkommen war.4 Damals schon hatte dieser zwar kleine, aber feine Verein bereits international einen sehr guten Namen.
Die Gründung des AAVM war im Jahr 1892 von jungen Münchner Spitzenbergsteigern wie Albrecht von Krafft und Rudolf Reschreiter sowie den Brüdern Josef und Ernst Enzensperger ausgegangen, die durch anspruchsvolle Erstbegehungen in den Nördlichen Kalkalpen von sich reden gemacht hatten. Der Akademische Alpenverein München war keine Sektion des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, sondern eine verbandsunabhängige alpinistisch orientierte Studentenverbindung. Viele ihrer Mitglieder gehörten auch der DuÖAV-Sektion Bayerland an, einer Sektion, deren „Ideal der bergsteigerischen Tat“ dem AAVM sehr nahestand.5
International in Erscheinung trat der AAVM, als sein Mitglied Adolf Schulze am 26. Juli 1903 als erster Mensch den Gipfel der extrem schwierigen Uschba im Kaukasus erreichte. Im August desselben Jahres setzten seine AAVM-Kameraden Ludwig Distel, Georg Leuchs und Hans Pfann noch eins drauf und überschritten den Süd- wie den Hauptgipfel des Bergriesen in einer fünftägigen Gewalttour. Neun Jahre später markierten die „Akademiker“ Hans Dülfer und Werner Schaarschmidt den Beginn der „klassischen Moderne“ im Klettersport durch ihre Erstbegehung der Peter Aufschnaiter inzwischen gut bekannten Fleischbank-Ostwand im Kaisergebirge. Im darauffolgenden Jahr legten Hans Dülfer und Wilhelm von Redwitz mit der Erstbegehung der Direktführe durch die Westwand des Totenkirchls die Latte noch etwas höher.
Nach dem Ersten Weltkrieg hatten Mitglieder des AAVM sofort an diese stolze alpine Tradition angeknüpft. Der 1893 in München geborene Jurastudent Emil Gretschmann war in der Vorkriegszeit als Mitglied der Alpenvereinssektion Bayerland mit dem ebenfalls zu dieser Sektion gehörenden Klettergenie Paul Preuß in Kontakt gekommen und hatte sich unter dessen Einfluss dem lupenreinen Freiklettern verschrieben. Gretschmann gab diese Haltung an seinen AAVM-Kletterlehrling und alpinen Senkrechtstarter Herbert Kadner weiter, der sich wenige Monate zuvor, am 1. Mai 1919, im Zuge der Niederschlagung der Münchner Räterepublik beim Sturm auf den von der „Roten Armee“ besetzten Hauptbahnhof eine schwere Schussverletzung zugezogen hatte.6
Kadner war nicht der einzige AAVMler gewesen, der sich damals als Freikorps-Milizionär oder als Angehöriger der rechtslastigen Einwohnerwehr an der „Befreiung“ der bayerischen Landeshauptstadt beteiligt hatte. Im Verlauf des Weltkriegs hatte sich der kleine Verein von einem Zusammenschluss eher unpolitischer Bergbegeisterter zu einer nationalkonservativen Gesinnungsgemeinschaft gewandelt. Dazu mag auch beigetragen haben, dass 27 von rund 260 Mitgliedern auf den Schlachtfeldern geblieben oder an im Kriegsdienst zugezogenen Leiden verstorben waren.7 Der Jahresbericht des AAVM über die Kriegsjahre schließt mit einer programmatischen Aussage:
„Der Krieg ist anders ausgegangen, als wir hofften. Von innen heraus zermürbt, brach unser Vaterland zusammen, unbesiegt von den Heeren seiner äußeren Feinde. Machtlos stehen wir jetzt da, wehrlos hasserfüllten Feinden preisgegeben, durch innere Unruhen fast an den Rand des Verderbens gebracht. Kein Hoffnungsfünkchen scheint die düstere Zukunft zu erhellen. […] Aber sollen wir nun tatenlos zusehen, wie der Zusammenbruch unseres Vaterlandes weiter und weiter schreitet? Nein und tausendmal nein! So gewiss wie der AAVM im Kriege seine Pflicht tat, so gewiss werden wieder Zeiten kommen, in denen man mit Achtung und Ehrfurcht den deutschen Namen in der Welt nennen wird, Zeiten, in denen kein Welscher mehr wagen wird, deutsches Alpenland zu vergewaltigen.
Mitzuhelfen, dass diese Zeit bald kommen möge, das ist eine Aufgabe, würdig des AAVM […] Lasst uns darangehen, Männer zu erziehen, die die Traditionen unserer Väter hochhalten, Männer, die noch Freude haben an Kampf und Sieg, wie ihn die Bergwelt hundertfach verheißt! Ein körperlich gesundes Geschlecht wird auch gegen geistige Fäulnis gefeit sein.
Da mitzuarbeiten sei unsere vornehmste Aufgabe!“8
Obwohl das Bergsteigen für die tonangebenden Mitglieder des AAVM nach dem Vertrag von Versailles gewissermaßen zu einer Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln geworden war, dürfen wir uns Herbert Kadner und seine Freunde vom AAVM aber nicht als verbissene, allein aufs Politische fixierte Haudegen vorstellen. In einem als „Erlebnis Fels“ titulierten Essay machte der neue Stern am alpinen Himmel deutlich, was ihm am extremen Klettern vor allem wichtig war: „Darum möchte ich mich auch gegen eine allzu scharfe Betonung eines Gegensatzes zwischen Gefühls- und Leistungsalpinismus wenden. Es gibt nur eine Form des Bergsteigens, die Berechtigung hat: Jene, die das Streben nach Erhebung aus den Niederungen des Alltags verkörpert.“9
Als der Artikel von Herbert Kadner im Mai 1921 in der Zeitschrift Der Alpenfreund erschien, hatte ein Spaltensturz in den Ötztaler Alpen dem Leben des Verfassers bereits ein jähes Ende gesetzt. Der Tod Herbert Kadners überschattete noch das Vereinsleben, als Peter Aufschnaiter im Herbst 1921 begann, an den wöchentlichen Versammlungen des AAVM teilzunehmen. Die Trauer um Kadner hielt aber weder die „Aktiven“ noch die „Alten Herren“ davon ab, am 17. Dezember 1921 das 29. Stiftungsfest der alpinen Studentenverbindung im Restaurant „Deutsches Haus“ gebührend zu feiern. Die Bergsteigermaler Rudolf Reschreiter und Ernst Platz sorgten durch ihre pikanten Beiträge zur Kneipzeitung für Erheiterung während des offiziellen Teils der Veranstaltung, nach dessen Beendigung „noch an einem anderen Ort bis Morgengrauen weitergezecht wurde“.10
Im Verlauf des Wintersemesters konnte Aufschnaiter seinen alpinen Lehrmeister Franz Nieberl begrüßen, der bei den Münchner „Akademikern“ einen Vortrag über seine Erfahrungen an der Kleinen Halt im Kaisergebirge hielt, wo ihm noch kurz vor Kriegsausbruch zusammen mit Hans Dülfer die Erstbegehung der abweisenden 700 Meter hohen Nordwestwand gelungen war. Aufschnaiter scheint schnell heimisch geworden zu sein im Kreis der Münchner Studenten-Bergsteiger. In der letzten geschäftlichen Sitzung vor dem Osterfest des Jahres 1922 wählten sie ihn zum Ersten Schriftführer des Vereins.11
Im Winter 1921/22 dürfte Aufschnaiter wiederholt daheim in Kitzbühel gewesen sein, von wo aus er auf die verschneite Goinger Halt im Kaiser gestapft ist und mit Skiern den Kamm Ehrenbachhöhe – Großer Rettenstein – Falsenhöhe überschritten sowie das Kitzbüheler Horn und das Kitzsteinhorn erklommen hat. Im Sommer 1922 suchte „Petrus“ Aufschnaiter – wie er im AAVM-Tourenbericht genannt wird – nicht nur die Hörsäle und Übungsräume der TH München auf, sondern fand auch noch reichlich Zeit, sich in den unterschiedlichsten Gebirgsgruppen herumzutreiben. Die in den Publikationen des AAVM veröffentlichten Fahrtenberichte belegen, dass die bisweilen geäußerte Vermutung falsch ist, Peter Aufschnaiter habe nach seinem schweren Sturz in der Fleischbank-Ostwand das extreme Klettern aufgegeben. Es dürfte kein Zufall gewesen sein, dass es ausgerechnet diese Fleischbank-Ostwand war, die als eine der ersten Touren in seinem Fahrtenbericht für das Jahr 1922 aufgeführt wird: Sich mit einer Niederlage abzufinden – darauf hatte Peter offenbar keine Lust. Zu den zahlreichen durchgeführten Touren zählten auch der schwierige Campanile Basso – die „Guglia“ – in der Brenta und mit der Westverschneidung des Predigtstuhls seines Vereinskameraden Emil Gretschmann auch eine der damals schwierigsten Kletterfahrten im Wilden Kaiser.
Auf derselben Doppelseite, auf der Aufschnaiters Fahrtenbericht abgedruckt ist, finden sich auch die Tourenlisten zweier ebenfalls neu aufgenommener Mitglieder des AAVM, denen namhafte Besteigungen in den Schweizer Hochalpen geglückt waren: Paul Bauer und Julius „Jules“ Brenner. Beide sollten in Peter Aufschnaiters Leben noch eine wichtige Rolle spielen. Ihnen war im Sommer 1922 die Besteigung von nicht weniger als zwölf Viertausendern im Wallis gelungen, darunter sehr anspruchsvolle Berge wie das Matterhorn und die Dufourspitze des Monte Rosa! Diese Leistung ist noch beachtlicher, wenn man die Umstände bedenkt, unter denen diese Unternehmungen stattfanden. Die Bedingungen schildert Paul Bauer in eindrucksvoller Eindringlichkeit:
„Der Geburtsort unserer Auslandsbergfahrten ist das Isartal vor München. Freund Brenner und ich hatten uns einmal mittellos – 1922 in der Inflationszeit – dorthin zurückgezogen. […] Das Feuer lohte des Nachts, die Stadt, das ganze Deutschland, für das wir fünf Jahre lang jede Stunde zum Sturm anzutreten bereit waren und das uns nun so schrecklich fremd geworden war, das alles lag in unserem Rücken meilenfern […] Nahe war uns nur die Natur, unsere stets getreue Freundin, die uns so manchesmal mit einem goldenen Abendhimmel die schwersten Schlachttage, die bittersten Verluste hatte vergessen lassen […] Unsere Gedanken wanderten von einem Ende der Welt zum anderen und verweilten überall, wo Menschen im Kampf stehen mit der unberührten Natur; schließlich hefteten sie sich an den silbern schillernden Fluss vor uns, sie folgten seinem Lauf zu den Bergen, sie flogen von Gipfel zu Gipfel bis zu Fernen, die uns, den von einem Wall der Verleumdung, der Feindschaft, der Armut eingeengten Deutschen, damals unerreichbar waren. […] Die Worte flossen langsam über das Feuer hinüber und herüber, sie wurden bestimmter, zielgerichtet. Als der Morgen graute, da erhoben wir uns von unseren Felsen, der Plan war in allen Einzelheiten fertig: Proviant für sechs Wochen aus Deutschland mitnehmen, Entfernungen mit dem Rad zurücklegen, im Zelte wohnen. – Es wäre zum Lachen, wenn es uns nicht gelingen würde, allen Schwierigkeiten zum Trotz die hohen Berge dort drunten zwischen Italien und der Schweiz aufzusuchen; es musste gelingen, denn es war höchste Zeit für uns, aus der drückenden Enge, in die der Krieg Deutschland geschlagen hatte, herauszukommen.“12
Für Paul Bauer und Julius Brenner hatte dieser Befreiungsschlag auch eine politische Dimension: Sie waren entschlossen, „den Wall, den wirtschaftliche Knechtung und die feindliche Hasspropaganda um Deutschland aufgerichtet hatten, niederzureißen, um deutschem Bergsteigertum in der Welt wieder Anerkennung zu verschaffen. Der erste Vorstoß erfolgte im Jahre 1922 in die Schweiz …“13
Ihre alpinen Leistungen schützten Bauer und seine Freunde jedoch nicht vor dem Spott ihrer Vereinskameraden. Eine Karikatur in der AAVM-Kneipzeitung des Jahres 1922 zeigt sie in total abgerissener Montur vor einem Schweizer Hotel. Bildunterschrift: „Würdige Vertreter des Deutschtums im Ausland“. Die Kneipzeitung des Jahres 1925 enthält eine Zeichnung, auf der Paul Bauer gerade verspätet einen Sitzungsraum betritt. Sprechblase: „Ich weiß zwar nicht, was mein Vorredner gesagt hat, aber ich bin dagegen!“ In Münchner Bergsteigerkreisen dürfte sich niemand darüber gewundert haben, dass Adolf Hitler für diesen streitbaren Geist und seine Freunde „bereits 1923 der Mann [war], den wir nicht antasten ließen.“14 Aber das war nur eine Seite der Medaille. Paul Bauer war auch ein treuer Kamerad, dem das Wohl eines ihm nahestehenden Bergfreundes weit wichtiger war als weltanschauliche Unterschiede. So setzte sich Paul Bauer nach dem Sturz der Münchner Räterepublik im Mai 1919 erfolgreich für die Freilassung des inhaftierten Rotarmisten Otto Herzog ein.15 Obwohl politisch konträr gesinnt, waren beide Mitglieder der wertkonservativen, renitenten und leistungsorientierten Alpenvereinssektion Bayerland.
Paul Bauer war einer von Aufschnaiters besten Bergfreunden.
In Paul Bauers Umfeld gab es da noch einen akademischen Bergfreund namens Wilhelm Fendt, der gemäß einer beim AAVM kursierenden Anekdote am 9. November 1923 bei Hitlers Umsturzversuch mitgemischt haben soll! Am Marsch auf die Feldherrnhalle wäre er nur deshalb nicht dabei gewesen, weil er die Oberföhringer Brücke gegen die anrückende Reichswehr hätte sichern müssen – schwer bewaffnet mit einer sechsschüssigen Pistole. Es hieß, Fendt hätte seinen Aufnahmeantrag in den AAVM mit einem einzigen Satz begründet, nämlich „Ich war beim Freikorps.“16
Ein weiteres ehemaliges Freikorpsmitglied in den Reihen des AAVM war der Medizinstudent Eugen Allwein. Im Jahr 1917 hatte er sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet. Nach Kriegsende wechselte der junge Soldat ins Freikorps Oberland. Ende April 1919 nahm er an einer Feldschlacht gegen die „Rote Armee“ bei Dachau teil und mischte anschließend mit bei der „Befreiung“ Münchens. Wegen seiner Mitwirkung an dem militärisch zwar erfolgreichen, politisch jedoch wirkungslosen Sturm auf den Annaberg in Schlesien am 21. Mai 1921 verpasste Allwein das Notabitur für Kriegsteilnehmer daheim in München. Aufgrund „seiner Verdienste um Reich und Vaterland“ ermöglichte der Rektor des Wilhelms-Gymnasiums dem Freikorpskämpfer jedoch den Zugang zum Studium durch eine handschriftlich ausgestellte „ordre du mufti“.
Zu dem Freundeskreis um Paul Bauer im AAVM zählte damals auch der am 10. November 1900 in München geborene Wilhelm „Willo“ Welzenbach. Er hatte sich im Wintersemester 1920 an der Technischen Hochschule München eingeschrieben und war im Februar 1921 dem AAVM beigetreten. Es dauerte nicht lange, bis der zielstrebige Maschinenbau-Student die meisten seiner Vereinskameraden alpinistisch überflügelt und die damals schwierigsten Felstouren in den Nördlichen Kalkalpen gemeistert hatte. Im März 1923, mitten in der ärgsten Inflation, zog er fast ohne Barschaft, dafür aber mit zwei von Lebensmitteln schier platzenden Rucksäcken in die Schweiz. Per Ski bestieg er zwei Mal den Monte Rosa und eilte weiter in die Berner Alpen, um den Gipfeln von Mönch, Jungfrau, Finsteraarhorn und der Grindelwalder Fiescherhörner einen Besuch abzustatten. Im Sommer des Jahres wurde Welzenbach von dem versierten Westalpenmann Hanns Pfann im Wallis in die Kunst des Eisgehens eingeführt. Nach einer zweitägigen kombinierten Überschreitung von Matterhorn und Dent d’Hérens trafen die beiden in Zermatt zufällig den österreichischen Spitzenalpinisten Fritz Rigele, welcher dem Leser bereits bekannt ist als Freund von Peter Aufschnaiters Seilpartner Otto Zimmeter.
Rigele berichtete dem jungen Münchner von einem brandheißen alpinsportlichen Problem in der Glocknergruppe, an dem bislang alle Versuche gescheitert waren: die 600 Meter hohe Wiesbachhorn-Nordwestwand.
Fritz Rigele war dann über den Winter 1923/24 mit dringlicheren Angelegenheiten beschäftigt als dem Bergsteigen. Der beruflich stark eingespannte Notar war an den Machenschaften beteiligt, die darauf abzielten, die vorwiegend aus jüdischen Mitgliedern bestehende AV-Sektion Donauland aus dem Dachverband des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins hinauszudrängen. Als einer der Hauptdrahtzieher des Deutschvölkischen Bundes im DÖAV bereitete Rigele den für die Hauptversammlung 1924 in Rosenheim angestrebten Ausschluss der Sektion Donauland mit vor.
Bergsteigen war für Fritz Rigele nach dem „Schandfrieden von Versailles“ längst keine reine Privatsache mehr, sondern vor allem ein Mittel zur „Wiederaufrichtung des deutschen Volkstums“:
„Und heute, da unsere Volkskraft einen schweren Schlag zu verwinden hat – körperlich und seelisch –, […] da unser Volk aller jener Betätigungen, die seinen Edelsinn und seine Kraft wieder zu erwecken imstande sind, ärger denn je bedarf, da sollten wir plötzlich sagen: ‚Nun ist’s genug mit der Erschließung der Alpen, mit der Förderung des Bergsteigerwesens.‘ Nein! Heute gehört alles in den Dienst des Volkstums, also auch der Alpinismus. Gerade dieser! Denn seine innere und äußere Macht ist groß. […] Deshalb werbt für das Wandern in den Bergen, schreibt, erzählt hierüber, erschließt die Berge immer mehr, soviel ihr könnt – mag auch ein Stoß gegen euer altes Bergsteigerherz notwendig sein –, träumt nicht nur einsam über die Nordwand hinab ins stille Waldtal, dann wird es das deutsche Volk einst auch euch und euren alpinen Vereinen danken, daß ihr mitgeholfen habt an seinem Aufstieg.“17
Es erstaunt kaum, dass Rigele sowie sein enger Freund und antijüdischer Kampfgefährte Eduard Pichl alles in ihrer Kraft Stehende unternahmen, um die mit dem Bergsport befassten Verbände für ihre nationalrevolutionären Zielsetzungen zu instrumentalisieren: „Verbände aller Art, in unserem Falle vor allem Bergsteiger- und Sportverbände, scheinen vom praktischen Gesichtspunkt aus betrachtet, eine wertvolle Keimzelle für die Ideen des nationalen Wiederaufstiegs zu sein.“18
Rigeles strategische Gedanken sollten nicht als Phantasien eines einflusslosen Stammtischbruders abgetan werden. Der Göring-Schwager Rigele benennt damit einen wesentlichen Bestandteil jener Strategie, die den nationalrevolutionären Kräften in Österreich und Deutschland die Übernahme der Macht ermöglichen sollte. In solchen konsequent „deutschvölkisch“ ausgerichteten Vereinigungen war für Juden kein Platz. Während Fritz Rigeles Gesinnungsgenosse Eduard Pichl als Hauptdrahtzieher der als „Donaulandaffäre“ bekannten Vorgänge das dunkelste Kapitel der Geschichte des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins maßgeblich mitgestaltete, konzentrierte sich Rigele auf die „Arisierung“ des Österreichischen und des Deutschen Skiverbands.19
Mit solchen politischen Zielsetzungen hatte Fritz Rigeles Zermatter Bekanntschaft nichts im Sinn. Umso mehr Interesse zeigte Welzenbach aber für die Erstbegehung einer Eiswand, an der bisher alle abgeblitzt waren!
Am Morgen des 15. Juli 1924 stehen Rigele und Welzenbach gemeinsam 350 Meter über dem Einstieg unter jenem fast senkrecht aufragenden Eiswulst der Wiesbachhorn-Nordwestwand, an dem bisher alle Versuche gescheitert waren. Hier übernimmt der Ältere die Führung. Rigele hatte 1922 mit der Verwendung von ins Eis getriebenen Haken experimentiert und ausgezeichnete Erfahrungen gemacht. Durch den Druck beim Eintreiben schmolz das Eis, um dann sofort wieder zu gefrieren und den Haken fest in der Wand zu verankern. Rund eine Stunde hielt der Eiswulst das ungleiche Paar in Atem. Als die beiden um elf Uhr auf den sonnenbeschienenen Gipfel ausstiegen, war eine neue Ära des Eisgehens angebrochen, in der senkrechte und gar überhängende Passagen die Aura des Unmöglichen verloren hatten.
In jenem Sommer 1924 war Peter Aufschnaiter wohl studienbedingt gezwungen, wesentlich kleinere bergsteigerische Brötchen zu backen: Er bestieg den Dachstein, kletterte über den Kopftörlgrat auf die Ellmauer Halt und erstieg das Totenkirchl über die Südwand. Im vorhergehenden Winter hatte er gerade ein paar Skitouren in den Kitzbüheler Alpen gemacht und war immerhin auf die Regalpspitze und den benachbarten Regalpturm im Wilden Kaiser gestiegen. Sein Studium scheint ihn derartig in Anspruch genommen zu haben, dass er vom AAVM inzwischen unter den „Inaktiven“ geführt wurde.20 Das wundert kaum, denn den Landwirtschaftsstudenten wurde an der Technischen Hochschule München einiges abverlangt.
Wie bereits erwähnt, wurde Aufschnaiter und seinen Kommilitonen in den Wintersemestern auferlegt, sich die theoretischen Grundlagen der Landwirtschaft anzueignen. Durch die Berufung international renommierter Fachleute hatte die Technische Hochschule für ein erstklassiges Niveau gesorgt.
Die Lehrveranstaltungen des aus Schwarzenbach an der Saale stammenden Pflanzenbauwissenschaftlers Ludwig Kießling bestimmten über weite Strecken das Grundstudium. Seit 1910 leitete Kießling die Landessaatzuchtanstalt des Königreiches und späteren Freistaats Bayern in Weihenstephan.21 Die Ertragssteigerung und Qualitätsverbesserung der Getreidearten war sein vordringlichstes Anliegen. In Kießlings Vorlesungen zur „Allgemeinen Ackerbaulehre“, zum „Allgemeinen Pflanzenbau“ und zur „Pflanzenzüchtung“ sowie durch die sommerlichen Praktika in Weihenstephan dürfte sich Aufschnaiter wertvolle Kenntnisse angeeignet haben, die ihm später als Entwicklungshelfer in Tibet und Nepal ausgezeichnete Dienste leisten sollten. Aufschnaiters Pflanzenkunde-Professor Karl Giesenhagen war Verfasser des Klassikers Lehrbuch der Botanik und Herausgeber des Grundlagenwerks Alpenflora. Auch dass er Java und Sumatra bereist und darüber ein lesenswertes Buch veröffentlicht hatte, dürfte Aufschnaiter für diesen Hochschullehrer eingenommen haben.22 Der renommierte Phytopathologe Gustav Korff hatte an der TH München von 1920 an die Dozentur „Krankheiten der landwirtschaftlichen Kulturgewächse und praktischer Pflanzenschutz“ inne. Sein bis heute fortwirkendes Hauptverdienst war der Aufbau eines modernen pflanzenschutzlichen Beratungsservice für die Landwirte und Gärtner in Bayern. Korffs wichtigste Forschungsstätte, die Bayerische Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, diente der Erprobung neuer Methoden und der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses.23
Ein ähnlich umfangreiches Pensum wie im Fachbereich Ackerbau war im Studienschwerpunkt Viehzucht zu bewältigen; dazu kamen Fächer wie Bodenkunde, Landwirtschaftliche Rechnungsführung, Landwirtschaftliche Geräte- und Maschinenkunde sowie Vorlesungen über das Landwirtschaftliche Bauwesen, einem besonderen Interessengebiet Aufschnaiters.24 Aufgrund seiner späteren Tätigkeit in Lhasa können wir davon ausgehen, dass sich Peter Aufschnaiter während seines Studiums auch fundierte Kenntnisse im Vermessungswesen aneignen konnte. Bis heute erhalten gebliebene DIN A6-Vokabelhefte belegen, dass er während seiner Studienzeit auch Hindi, Nepali und Tibetisch gelernt hat. Und zwar aus englischsprachigen Grammatiken und Wörterbüchern. Darüber hinaus beherrschte das Sprachtalent Aufschnaiter auch weitgehend die persische Sprache Farsi, sodass er später als Internierter in Nordindien einige Klassiker der persischen Literatur im Original als Lesestoff anforderte.25 Mit dem Erlernen der persischen Sprache dürfte Aufschnaiter während seiner Studienzeit begonnen haben.
Die vielfältigen Interessen des Agronomie-Kandidaten dürften der Grund dafür gewesen sein, dass er die vorgeschriebene Mindeststudienzeit von drei Jahren deutlich überzog. Erst am 17. März 1927 erteilte die Technische Hochschule München „dem Studierenden des landwirtschaftlichen Faches Peter Aufschnaiter, geboren am 2. November 1899 zu Kitzbühel, den Grad eines Diplom-Landwirtes, nachdem er den Besitz eines vorschriftsmäßigen Reifezeugnisses sowie die vorgeschriebenen Hochschulstudien nachgewiesen und die ordnungsmäßige Diplom-Prüfung für das landwirtschaftliche Fach und zwar die Vorprüfung an der Technischen Hochschule im Jahre 1926 mit dem Gesamturteil ‚Gut‘ bestanden und die Hauptprüfung im Jahre 1927 mit dem Gesamturteil ‚Bestanden‘ abgelegt hat.“26
Peter Aufschnaiters Freunde vom AAVM Paul Bauer und Eugen Allwein hatten ihre jeweilige Hochschulausbildung stringenter durchgezogen als ihr österreichischer Freund. Allwein promovierte 1925 nach nur dreijährigem Studium zum Dr. med. und trat dann eine Stelle als Assistenzarzt an. Paul Bauer wird in der auf 15. November 1925 datierten Mitgliederliste des AAVM als Assessor und Syndikus geführt. Ihre berufliche Tätigkeit scheint den bergsteigerischen Tatendrang nicht beeinträchtigt zu haben. Denn beide lieferten für die Jahre 1926 und 1927 opulente Tourenberichte ab mit namhaften Touren in den Ost- und Westalpen, darunter zahlreiche Erstbegehungen. Und sie waren keine Einzelfälle im AAVM! Kein Wunder, dass der kleine Eliteverein in alpinen Kreisen als ausgezeichnete Adresse galt. Nicht ohne Stolz berichtete der Erste Vorstand des Vereins, Karl Wien, in seinem Überblick über die Jahre 1926 und 1927: „Als äußeren Ausdruck dafür, dass der AAVM nach wie vor eine angemessene Stellung im alpinen Leben einnimmt, dürfen wir es wohl betrachten, wenn der Hauptausschuss des DuÖAV unserm A. H. Hans Pfann die Leitung seiner Bolivien-Expedition im Jahre 1928 übertragen hat und zwei der jüngeren AAVMler, Dr. Eugen Allwein und Karl Wien, zur Beteiligung an der Pamir-Expedition 1928 ausersehen hat.“27
Pik-Lenin-Erstbesteiger Allwein 1927 auf der Alai-Pamir-Expedition.
Bei dem von Karl Wien angesprochenen Unternehmen handelte es sich um die von der Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaft, dem Deutschen und Österreichischen Alpenverein und der Akademie der Wissenschaften der Sowjetunion gemeinsam organisierten Alai-Pamir-Expedition. Dazu wurden nicht weniger als 66 Teilnehmer, zwei Flugzeuge, 60 Kamele, eine große Anzahl wechselnder Träger sowie militärische Begleitmannschaft aufgeboten. Leiter des Unternehmens war der aus Bremen stammende Reeder und Forschungsreisende Willy Rickmer Rickmers. Chef der vier beteiligten Bergsteiger war der ebenfalls bremische Regierungsrat Dr. Philipp Borchers; zusammen mit Allwein und Wien gehörte noch der aus Hall in Tirol stammende Bergbaustudent Erwin Schneider zu der kleinen Gruppe.28
Dem ungemein tatkräftigen Team gelang es, neben zahlreichen Fünftausendern auch acht schöne Sechstausender zum ersten Mal zu besteigen. Nach mehr als drei Monaten in der dünnen Luft des Hochlandes gingen Schneider, Wien und Allwein den in der Hauptkette des Transalai liegenden Pik Lenin an. In nur vier Tagen erreichten sie vom Standlager im Sauk-Sai-Tal den 7134 Meter hohen Gipfel, den damals höchsten bestiegenen Berg der Welt. Vom Hochlager auf 5700 Meter hatten die drei gerade sieben Stunden gebraucht. Lange Zeit stellten sowjetische Alpinisten die Erstbesteigung in Frage. Die letzten Zweifel zerstreute erst Jahrzehnte später der Österreicher Erich Vanis, als er das von Eugen Allwein auf dem Gipfel hinterlassene Brillenetui zurück ins Tal brachte.
Währenddessen hatten weitere Mitglieder des AAVM in den Bergen der Welt ihre Spuren hinterlassen. Im Sommer 1928 war ein kleiner Stoßtrupp der Münchner Akademiker unter der Führung von Bauer, der sich am Berg gern per „Hauptmann“ ansprechen ließ, in den Kaukasus vorgedrungen. Heinz Tillmann, dem bergsteigerisch Leistungsfähigsten der Mannschaft, widerstrebte die militärische Art Bauers, der sich laut Tillmann zu Aussagen hinreißen ließ wie: „Ein Kapitän auf hoher See hat das Recht, einen Matrosen, der einen Befehl verweigert, zu erschießen. Das gleiche Recht müsste ein Expeditionsleiter haben.“ Ob diese Verlautbarung auch einen gepfefferten Schuss augenzwinkernder Provokation enthielt, können wir heute nicht mehr feststellen. Unstrittig dürfte aber sein, dass Bauer die bedingungslose Unterordnung der Expeditionsmitglieder unter seinen Willen einforderte.29 Trotz der Dissonanzen im Team gelang den AAVMlern die Besteigung einer Reihe von Vier- und Fünftausendern. Höhepunkt war ein Versuch an der Südkante des 5198 Meter hohen Dychtau durch Paul Bauer, Ernst Beigel, Hans Niesner und Heinz Tillmann vom 21. bis 25. Juli 1928, der 80 Meter unter dem Gipfel im Schneesturm scheiterte.
Nach diesen sensationellen Erfolgen fühlten sich die Münchner Akademiker bereit, es auch mit den höchsten Bergen der Welt aufzunehmen, und beschlossen, einen „Vorstoß“ in den Himalaya zu unternehmen. Dass auch Peter Aufschnaiter zur Mannschaft gehörte, war nicht ganz selbstverständlich. Erstens war er bergsteigerisch nie durch Leistungen aufgefallen, die jenen der anderen Expeditionsanwärter nur annähernd ebenbürtig waren; und an Eiserfahrung fehlte es ihm gänzlich. Zweitens hatte Peter Aufschnaiter noch am 26. März 1929 beim amerikanischen Generalkonsulat in München einen Registrierungsantrag für amerikanische Einwanderungs-Visumserteilung gestellt. Der Antragsteller gibt an, dass seine Eltern die Überfahrt bezahlen würden, und beantwortet die Frage „Ist in den Vereinigten Staaten bereits Arbeit gesichert?“ mit Nein. Außerdem gibt Aufschnaiter an, in den letzten fünf Jahren mit dem Studium der Landwirtschaft an der Technischen Hochschule beschäftigt gewesen zu sein, was seine Tätigkeit während der zwei Jahre zwischen dem Abschluss des Studiums im März 1927 bis zur Antragsstellung für das Einwanderungsvisum eher unzureichend beschreibt.30
Wir wissen nicht, ob der Antrag abgelehnt wurde und Peter Aufschnaiter mangels besserer Alternativen in den Himalaya mitgefahren ist oder ob ihn Paul Bauer wegen Aufschnaiters hervorragenden Kenntnissen des Englischen und seiner Kommunikationsfähigkeit in einigen orientalischen Sprachen zur Teilnahme an der Expedition überredet hatte. Wir wissen aber mit Sicherheit, dass die von Paul Bauer initiierte Reise nach Indien und Sikkim im Leben Peter Aufschnaiters eine entscheidende Wende einleitete.