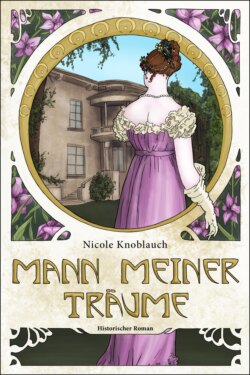Читать книгу Mann meiner Träume - Nicole Knoblauch - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление11. November (29. / 30. Mai 1793)
Flucht
Wieder ein Strand. Aber hinter mir erstreckte sich keine Stadt, sondern ein gedrungener Turm und Gestrüpp. Vor mir lag das Meer. Diesmal war es nicht ruhig, sondern aufgewühlt. In der Ferne erkannte ich eine Inselgruppe, die eigentümlich rot schimmerte. Die Blutinseln, fuhr es mir durch den Kopf. Die hatte Napoleone mir zeigen wollen. In der untergehenden Sonne sahen sie tatsächlich aus, wie mit Blut getränkt. Und obwohl der Anblick mich bezauberte, lief mir ein Schauer über den Rücken.
Meine Nackenhaare stellten sich auf und ich fröstelte. Irgendetwas stimmte hier nicht. Mit zusammengekniffenen Augen blickte ich aufs Meer hinaus. Die Wellen brachen einige Meter vor dem Ufer und spritzten Gischt in alle Richtungen.
Und dann sah ich es. Arme ragten aus dem Wasser, ein Gesicht, das sofort wieder in den Wellen verschwand, ein leises Wimmern. Ohne nachzudenken, rannte ich auf die Gestalt im Wasser zu. Das Meer umspielte meine Knöchel, meine Waden und ich kam immer langsamer voran. Diese vermaledeiten Röcke saugten sich mit Wasser voll und hingen wie Blei von meinen Hüften. Inzwischen erkannte ich, dass ein Mädchen mit den Wellen rang. In dieser Kleidung ein aussichtsloser Kampf.
Die Augen immer auf das Kind gerichtet, öffnete ich zwei, der insgesamt drei Röcke, die ich trug. Mühsam streifte ich sie ab. Sobald sie mit den Wellen davon schwammen, gelang es mir endlich, mich schneller zu bewegen. Das Mädchen hatte mich bemerkt und versuchte, auf mich zuzuwaten.
Noch ein paar Schritte, sie streckte mir ihre Arme entgegen und ich griff danach. Mit einem Ruck zog ich sie zu mir heran. Am ganzen Leib zitternd, drückte sie sich an mich. Ihr Kopf lag an meiner Schulter. Sie musste älter sein, als ich zunächst angenommen hatte. Ich schätzte sie auf vierzehn. Entsprechend schnell erholte sie sich und das Beben ihres Körpers ließ nach. Sie war voll bekleidet und die Wellen zerrten mit aller Kraft an ihr. Selbst zu zweit gerieten wir mehr als einmal ins Straucheln.
„Kannst du mich verstehen?“
Sie blickte mich mit großen Augen an und nickte.
„Wir müssen ans Ufer zurück! Halte dich an mir fest und stemme dich gegen die Wellen. Kannst du das?“
Wieder ein Nicken. Mit vereinten Kräften gelang es uns, den Strand zu erreichen und wir sanken erschöpft in den Sand.
Nach Atem ringend, lag ich mit geschlossenen Augen da und hörte auf meinen ruhiger werdenden Herzschlag. Sie brach das Schweigen: „Madame Seurat? Seid Ihr das?“
„Das bin ich.“ Sie kannte mich? „Und du?“
„Ich bin Paola Buonaparte. Erinnert Ihr Euch nicht?“
Das sollte die kleine Paoletta sein?
„Wo ist Napoleone? Ist er bei Euch?“ Sie blickte mich aus erwartungsvollen Augen an. Als ich den Kopf schüttelte, verfinsterte sich ihre Miene und sie ließ die Schultern hängen.
„Ist er nicht hier? Ich dachte ...“ Den Satz brachte ich besser nicht zu Ende. Ich hatte sagen wollen: 'Ich dachte, deshalb sei ich hier.'
„Warum bist du so weit weg von zu Hause, Paoletta?“
Sie legte den Kopf schief und blickte mich misstrauisch an. „Mama sagt, wir haben kein zu Hause mehr.“
„Aber wie ...?“
„Mama sagt, Napoleone käme uns holen. Mit dem Schiff. Ich bin ins Meer hinausgewatet, um besser sehen zu können, ob er kommt.“ Ihr Blick senkte sich. „Danke für meine Rettung. Aber er ist nicht da.“
„Wo ist er?“
„Er beschießt die Festung. Und wenn das nicht funktioniert, gehen wir nach Frankreich.“ Sie biss sich auf die Lippen. „Ich denke, Mama wird das besser erklären können. Kommt!“ Sie nahm meine Hand und lief auf den Turm zu. „Ich glaube nicht, dass sie sich freuen wird, Euch zu sehen. Sie und Napoleone haben wegen Euch gestritten.“
„Wegen mir?“
„Oh ja, sie streiten jedes Mal wegen Euch, wenn er wieder auf Korsika ist.“
Jedes Mal? Wenn ich die bruchstückhaften Informationen, die ich hatte, zusammensetze, ergab sich ein relativ schlüssiges Bild, wo und wann ich mich befand – und es gefiel mir überhaupt nicht.
„Äh, Paoletta?“ Ich räusperte mich verlegen. „Wie lange ist es her, dass ich Napoleone auf Korsika besucht habe?“
Sie kniff die Augen zusammen und ähnelte ihrer Mutter und ihrem Bruder auf erschreckende Weise. „Beinahe drei Jahre. Warum ...“
Drei Jahre! Ich schlug die Hand vor den Mund. Verdammt! Aber eigentlich bestätigte das nur, was ich eh schon gewusst hatte. Der Turm war der Genueserturm Capitellu. Dort hatte Napoleones Familie auf ihn gewartet, als man sie aus Korsika vertrieb. Sie hatten sich einige Tage dort versteckt, bis er sie mit einem Schiff der französischen Kriegsflotte abholen kam.
Drei Jahre! Ja, da würde Signora Buonaparte nicht gut auf mich zu sprechen sein. Und Napoleone erst! Ich heiratete ihn und verschwand für drei Jahre.
„Alles in Ordnung, Mademoiselle?“
„Ja, natürlich. Ihr seid vertrieben worden?“
„Ja! Wir sind nachts aus dem Haus geflohen und nach Milelli gegangen. Aber dort haben sie uns gefunden. Also haben Matteo und Costa uns hierher gebracht. Napoleone hat sie geholt, um uns den Weg zu zeigen. Jetzt sind wir hier und müssen leise sein und dürfen nicht raus und langweilen uns ganz entsetzlich.“
Wir waren am Turm angekommen und Paoletta führte mich in einen feuchten, modrigen Raum. Durch die schmalen Schlitze der Schießschächte fiel wenig Licht und mir blieb verborgen, wieviele Menschen sich hier befanden.
„Paoletta“, hörte ich die scharfe Stimme ihrer Mutter. Den Rest verstand ich nicht. Paoletta antwortete und deutete auf mich. Meine Augen hatten sich an das Dämmerlicht gewöhnt und Letitia Buonaparte kam mit ausdruckslosem Gesicht auf mich zu. „Gebt mir einen einzigen Grund, warum ich Euch nicht auf schnellstem Wege aus diesem Turm befördern sollte!“
Ich schluckte und fuhr mir mit der Zunge über die Lippen. Ihre Worte kamen mir in den Sinn: Wenn ich Napoleone verletze, würde ich mir wünschen, nie geboren worden zu sein. Nun, dank ihres Blicks war es fast so weit.
Aber es musste einen Grund geben, warum ich hier war! Was sollte es für einen Sinn haben, wenn sie mich jetzt hinauswarf?
Paoletta kam mir zur Hilfe: „Sie hat mir das Leben gerettet, Mama! Ich wollte sehen, ob Napoleone kommt und ...“ In lebhaften Worten, erzählte sie, was passiert war. Selbst in dem dämmrigen Licht sah ich, wie Signora Buonaparte erbleichte.
„Dann stehe ich in Eurer Schuld“, sagte sie in einem Tonfall, der die Hölle hätte gefrieren lassen. „Ihr dürft bleiben.“ Sie wandte sich ab und begann, auf ihre Tochter einzureden.
Dankbar, dass sie ihre Aufmerksamkeit anderen Dingen zuwandte, ließ ich mich auf dem Boden sinken. Die Rettungsaktion im Wasser hatte mich mehr angestrengt, als ich mir eingestehen wollte. Ich war immer noch klitschnass und das feuchte Klima im Raum ließ mich zittern.
„Bitte, Madame, nehmt die Decke, bevor Ihr Euch den Tod holt.“ Die Stimme hatte ich schon einmal gehört. Sanfte Hände legten etwas Warmes um meine Schultern und ein Mann trat in mein Blickfeld: Es war Napoleones Onkel, Joséph Fesch.
„Ich möchte mich auch im Namen meiner Schwester bei Euch bedanken. Paoletta war schon immer sehr ungestüm und nie eine gute Schwimmerin. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Ihr nicht zur rechten Zeit vor Ort gewesen wäret.“
Mit einem wohligen Seufzer zog ich die Decke enger um meine Schultern. „Das war doch selbstverständlich. Ich bin froh, dass ich helfen konnte.“
„Meine Schwester hat schwere Zeiten hinter sich. Sie hat alles verloren und jetzt bangt sie um ihren Sohn. Ihr wisst nichts über Napoleones verbleib?“
„Nein. Ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, ihn hier zu treffen.“
„Er ist nicht hier. Noch nicht.“ Letitzia Buonaparte. Sie trat zu uns heran und reichte mir etwas Brot, Käse und einen Weinschlauch. „Er hat gesagt, er würde uns holen.“ Da gab es keinen Widerspruch. Sie glaubte an ihren Sohn und duldete nicht, dass man etwas anderes dachte.
Konnte ich es wagen zu fragen, was zu dem Aufenthalt hier geführt hatte? Meine Erinnerungen waren etwas lückenhaft.
„Was ist passiert? Paoletta sagt, man habe Euch aus Ajaccio vertrieben.“
Die Mienen der Geschwister versteinerten. „Das ist richtig“, antwortete Letitia. „Napoleone und Luciano haben sich mit Paoli überworfen. Paoli handelte gegen die Interessen Frankreichs und das konnten meine Söhne nicht akzeptieren.“
Fesch nickte mit traurigen Augen. „Dann hat sich alles verselbständigt. Paoli wurde inhaftiert und Luciano hat in einem öffentlichen Brief die Familie Buonaparte dafür verantwortlich gemacht. Das führte zu Unruhen und schließlich ...“ Er brach ab und blickte sich im Turm um. „Die Familie Buonaparte wird Korsika so schnell nicht wiedersehen.“
Signora Buonaparte seufzte schwer. Aus einem Impuls heraus griff ich nach ihrer Hand und drückte sie. Ich konnte mir nicht auch nur annähernd vorstellen, wie es in ihr aussah. Aber ich wusste, dass sie recht hatte. Sie würde nie wieder in ihre Heimat zurückkehren.
Kanonendonner lösten uns aus unserer Erstarrung. „Hoffentlich ist das endlich Napoleone!“ Wir erhoben uns und rannten nach draußen. Am Horizont erkannte ich tatsächlich die Umrisse eines Schiffs. Ein Beiboot ruderte bereits aufs Ufer zu.
„Ich wusste, dass er kommt!“ Letitia ergriff kurz meine Hand, drückte sie und wandte sich an ihre Kinder. Sie gab Anweisungen und alle rannten in den Turm. Kurz darauf kamen sie mit ihren gepackten Bündeln wieder hinaus und blickten erwartungsvoll dem Boot entgegen.
Das war inzwischen so nah herangekommen, dass ich die Menschen darauf erkannte. Napoleone stand am Bug. Sein Blick streifte jeden Einzelnen und ich meinte, ihn einen Moment länger auf mir verharren zu spüren.
Er sprang ins Wasser und watete auf uns zu. Seine Geschwister rannten ihm entgegen und umarmten ihn. Als er sie alle ausgiebig begrüßt hatte, wandte er sich seiner Mutter zu. Der herzlichen Umarmung folgte eine kurze Diskussion, der ich nicht folgen konnte. Schließlich ließ er sie los und nahm seine Schwester Anunziata auf den Arm. Fesch nahm Giralomo und gemeinsam bahnten sie sich ihren Weg durchs Wasser. Auf gleiche Weise folgten Paoletta und Luigi. Danach trug Napoleone Maria Anna ins Boot und kam zurück. Mich hatte er immer noch keines Blickes gewürdigt, geschweige denn mit mir geredet. Deutlich wurde mir mein unpassender Aufzug bewusst. Ich musste aussehen wie eine nasse Katze und trug nur einen Unterrock.
Napoleone kam uns entgegen, um Letitia hochzuheben, doch sie verschränkte ihre Arme vor der Brust und schüttelte den Kopf. „Sie zuerst“, sagte sie in einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete. Sie hatte Französisch gesprochen.
Napoleones Miene versteinerte. Seine Antwort verstand ich nicht, aber er lehnte offensichtlich ab.
„Dann bleibe ich auch!“ Letitia blickte ihrem Sohn in die Augen und er starrte zurück.
Mein Magen zog sich zusammen und ich begann leicht zu zittern. Letitia hatte sich für mich eingesetzt, das erfüllte mich mit Überraschung und einem gewissen Stolz. Der wurde schnell von einem stärkeren Gefühl überlagert: Napoleone wollte mich nicht mehr. Das hatte er mehr als deutlich gemacht. Eine kalte Hand griff nach meinem Herzen und drückte zu.
Ich riskierte einen Blick auf ihn und wünschte gleich, ich hätte es nicht getan. Das Glitzern seiner Augen im sonst unbewegten Gesicht machte mir Angst.
„Wenn sie es bis zum Boot schafft, während ich dich hinbringe, kann sie mitkommen.“ Ohne ein weiteres Wort nahm er seine Mutter auf die Arme und trat in die Wellen hinaus.
Nun gut, wieder ins Meer. Der Stoff des Unterrocks schlug schwer gegen meine Beine, aber ich hielt mit Napoleone Schritt. Am Boot angekommen, hob Napoleone seine Mutter hinein und kletterte hinterher. Er zog sich nach oben und schwang die Beine über die Reling. Ich versuchte, es ihm nachzumachen. Versuchte trifft es, denn das Gewicht des Rocks zog mich nach unten. Beim dritten Anlauf gelang es mir, und ich ließ mich keuchend auf den Boden sinken.
Napoleone ignorierte mich. Von der Fahrt kann ich nicht viel berichten, da ich die meiste Zeit damit verbrachte, wieder zu Atem zu kommen. Als wir beim Schiff ankamen, stellte sich die nächste Herausforderung. Außer einer Strickleiter gab es keine Möglichkeit, es zu erreichen. Eigentlich sollte das kein Problem darstellen. Wenn mein Rock trocken und nicht drei Zentner schwer gewesen wäre. Wie sollte ich diese Leiter erklimmen? Napoleone schien es egal zu sein und auch keiner der Matrosen kümmerte sich um mich. Letitia verschwand aus meinem Blickfeld und mir blieb nichts andere übrig, als mir selbst zu helfen. Mit einem Seufzer schlang ich den Rock zwischen den Beinen hindurch und stopfte ihn oben in den Bund. So hatte ich zumindest die Beine frei und wurde nicht mehr von dem Gewicht nach unten gezogen. Ich konzentrierte mich immer nur darauf, den nächsten Schritt zu tun und mich nach oben zu ziehen. Endlich griff eine behandschuhte Hand nach meiner und half mir über die letzte Strecke nach oben. Kraftlos sank ich auf den Boden. Ein merkwürdiges Kribbeln hatte meinen Körper ergriffen. Ich schloss die Augen und spürte, wie meine Kräfte zurückkehrten.
„Geht es Euch gut? Kann ich etwas tun?“ Die Stimme drang von weit weg an mein Ohr. Sie kam mir vage bekannt vor und ich öffnete die Augen wieder. Vor mir sah ich das Gesicht Tristan Berières. Seine bernsteinfarbenen Augen ruhten besorgt auf mir.
„Nein.“ Ich versuchte zu lächeln. „Habt Ihr mir geholfen? Danke!“
„Ihr solltet die nehmen.“ Er zog seine Jacke aus und legte sie mir über die Beine. Natürlich. Das geringste bisschen Haut war unschicklich. Wie hatte ich das nur vergessen können? Ziemlich unwirsch schob ich die Jacke beiseite, löste den Stoff aus meinem Rockbund und legte ihn so, wie er gehörte. Die Kälte traf mich wie ein Schlag und ließ mich zittern.
Tristan Berière erhob sich. „Kommt mit. Ihr müsst aus den nassen Sachen heraus.“
Er brachte mich ins Innere des Schiffes und öffnete eine schmale Tür. „Einen Moment, bitte.“
Ich erhaschte einen Blick in die winzige Kabine. An der einen Wand hing eine Hängematte. Darunter stand eine grobe Holzkiste und an der anderen Wand ein Tisch und ein Hocker. Zwischen der Truhe und dem Tisch konnte man gerade so hindurchgehen. Mit wenigen Handgriffen öffnete er die Truhe und zog etwas heraus. Verlegen sagte er: „Ich habe leider nichts anderes, aber es ist trocken.“ In der Hand hielt er eine einfache, helle Leinenhose und ein Hemd. Dankbar lächelte ich ihn an.
„Das ist sehr freundlich.“ Ich nahm die Sachen und er verließ die Kajüte, bevor ich eintrat. Sie passten mehr oder weniger. Glücklicherweise befand sich an der Hose eine Kordel, mit der ich sie auf Taille brachte. Die Beine musste ich mehrmals umschlagen und an den Hüften saß sie stramm. Doch das verdeckte das weite Hemd, das ich lose hinabfallen ließ. So musste es gehen.
Ich streckte den Kopf aus der Kabine, doch der Flur war menschenleer. Kein Berière weit und breit.
Auch gut. Was sollte ich tun? An Deck gehen? Hier warten? Napoleone suchen? Besser nicht. Nach Letitia Ausschau halten? Vielleicht konnte sie Napoleoe beruhigen.
In diesem Moment kam Monsieur Berière um die Ecke. „Ah, Ihr seid fertig.“ Sein Blick glitt über mich und verharrte auf meinen Hüften.
Nach dem kurzen Aufflackern in seinen Augen zu urteilen, verdeckte das Hemd weniger, als ich gedacht hatte.
„Äh“, er räusperte sich verlegen, „Buonaparte möchte Euch sehen.“
„Sicher? Er hat deutlich gemacht, dass er mit mir nichts zu tun haben möchte.“
„Nein, das habt Ihr falsch verstanden.“ Geistesabwesend fuhr er sich mit der Hand durchs Haar. „Ihr müsst zugeben, dass drei Jahre eine lange Zeit sind. Er ist verärgert.“
Ich nickte. Verärgert. Und nach allem, was ich wusste, war das ein Zustand, den man bei Napoléon Bonaparte nicht gerne erleben wollte. Aber ich musste wenigstens mit ihm reden. Ihm erklären, dass ... Was? Egal! Mir würde schon etwas einfallen.
„Bringt mich bitte zu ihm.“ Meine Lippen zitterten, als ich zu lächeln versuchte.
„Dürfte ich etwas sagen?“ Seine Augen ruhten auf mir und musterten mich mit großem Interesse.
„Nur zu!“ Nervös fuhr ich mir mit der Zungenspitze über die Lippen und verschränkte meine leicht zitternden Hände. Ich hatte wohl größere Angst vor Napoleone, als ich zugeben wollte.
„Ihr wart lange weg und ich wollte wissen, ob ihr diesmal bei ihm bleibt. Wenn nicht, will ich vorbereitet sein.“
„Wie meint Ihr das?“
„Er liebt Euch, Madame. Ich weiß nicht wieso und ich finde, dass er viele Gründe hat Euch nie wieder sehen zu wollen. Meiner Meinung nach hätte er Euch am Strand lassen und keinen weiteren Gedanken an Euch verschwenden sollen.“
Aua. Ich brauchte mehrere Atemzüge, um meinen rebellierenden Magen wieder unter Kontrolle zu bringen. „Aber Ihr habt mir geholfen. Er ignoriert mich. Warum?“
„Ginge es nach mir, hättet Ihr dieses Schiff nie betreten. Aber er hat euch mitgebracht, also sollte er sich angemessen um Euch kümmern. Ihr habt meine Frage nicht beantwortet: Werdet Ihr wieder gehen?“
Mit ausdruckslosem Gesicht blickte er mich an.
„Ja“, flüsterte ich. „Ich werde wieder gehen.“
Er nickte. „Dann solltet Ihr ihn nicht warten lassen. Er wird jede Minute genießen wollen.“ Der Tonfall, in dem er das sagte, gefiel mir nicht.
Tristan Berière brachte mich zu einer anderen Tür, die genauso aussah wie die zu seiner Kabine und klopfte. Ohne auf Antwort zu warten, öffnete er sie und schob mich hinein.
Der Raum glich dem, aus dem ich gerade kam. Napoleone stand am anderen Ende und heftete seinen kalten Augen auf mich.
„Was willst du hier?“ Die Frage war nicht mehr, als ein leises, kaltes Zischen.
„Dich sehen“, antwortete ich, ohne das Zittern aus meiner Stimme fernhalten zu können. Ich versuchte zu schlucken, doch mein ausgetrockneter Mund machte es unmöglich. Was würde jetzt passieren?
Ich hörte, wie die Tür schloss - und die Hölle brach los.
„Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dich bei meiner Familie anzubiedern! Hattest du nicht einmal den Mut, mir gegenüber zu treten?“ Die ersten Sätze sprach er beherrscht, doch es dauerte nicht lange, bis er laut schrie. Ich vermag nicht zu wiederholen, was er mir alles an den Kopf warf. Immer wieder fiel er ins Korsische - aber sein Tonfall ließ keinen Zweifel aufkommen.
Die enge Kabine hinderte ihn am Umherlaufen und so fegte er mit ausladenden Bewegungen die wenigen Dinge zu Boden, die nicht festgeschraubt waren. Als nichts mehr zum Hinunterschmeißen da war, schlug er mit der Hand gegen die Wand. Dabei schrie er ohne Unterbrechung.
Das war also einer der berüchtigten Wutausbrüche Napoléon Bonapartes. Ich hatte davon gelesen. Er neigte zu solchen Ausbrüchen und inszenierte sie später sogar absichtlich. Allerdings hätte ich gut durchs Leben kommen können, ohne das gesehen zu haben – besonders ohne das Ziel eines solchen Ausbruchs zu sein. Nach allem, was ich wusste, blieb man am besten ruhig. Einfach warten, bis es vorbei war. So hatten es Joséphine und Talleyrand gemacht. Nicht, dass ich eine Chance gehabt hätte, auch nur ein Wort zu sagen.
Dass ein Mensch so wütend werden konnte! Einige seiner Vorwürfe verstand ich trotz dieses Mischmaschs aus Französisch und Italienisch.
Ich hätte ihn ausgenutzt.
Mit ihm gespielt.
Seine Gefühle missbraucht.
Natürlich dachte er so. Hätte ich auch an seiner Stelle. Wie gerne würde ich ihm sagen, dass ich träumte und keinen Einfluss auf meine Reisen hatte.
„Das verstehe ich nicht.“ Mit den Aufzeichnungen in der Hand betrat Anna Maries Zimmer.
„Was verstehst du nicht?“ Sie blickte von Napoléons Memoiren auf, in denen sie gerade gelesen hatte.
„Warum du ihm nicht sagen kannst, dass du in deinen Träumen zu ihm kommst.“
„Wie würde das denn aussehen? Was würdest du denken, wenn das jemand zu dir sagt?“
„Das ist etwas anderes. Du besuchst ihn wirklich in deinen Träumen. Ich meine, das ist ein Traum. Warum solltest du das nicht erwähnen dürfen?“
Marie runzelte die Stirn. „Weil es sich nicht richtig anfühlt. Wenn ich dort bin, IST das real! Ich kann dort nicht anfangen, von Träumen zu reden!“
Anna schnaubte, zuckte dann aber mit den Schultern. „Verstehen muss ich das nicht!“ Seufzend ließ sie sich neben Marie aufs Bett fallen und las:
Ich verhielt mich ruhig, starrte auf die Wand und versuchte, seine Worte an mir abprallen zu lassen.
'Versuchte' ist der richtige Ausdruck. Einige Male unterdrückte ich die Tränen nur mit größter Anstrengung. Ich verdrängte sie und ertrug stumm, was er mir entgegenschleuderte. Er mochte keine Frauen, die weinten. Also versuchte ich, stark zu bleiben. Irgendwann drehte ich den Kopf in seine Richtung und konnte ein Schluchzen nicht mehr unterdrücken.
„Es tut mir leid, Napoleone!“ Tränen liefen meine Wangen hinunter, doch es war mir egal. Er blieb mir gegenüber stehen und so plötzlich, wie er zu schreien begonnen hatte, verstummte er, kam auf mich zu, nahm mich in den Arm und flüsterte: „Ich liebe dich, Marie.“
Das Gesicht in meinem Haar vergraben, murmelte er: „Dieser Duft hat mir gefehlt.“ Seine Hände wanderten von meiner Taille hinunter und umfassten meine Pobacken.
Langsam hob ich den Kopf und blickte ihm direkt in die Augen. Sie glitzerten so blau, wie das Meer und schienen ebenso tief. Unsere Blicke verbanden sich und ein sinnliches Lächeln erschien auf seinen Lippen. Ganz langsam senkte sich sein Mund, ich öffnete meinen und schloss die Augen.
Hungrig suchte seine Zunge ihren Weg. Sein unmögliches Verhalten, meine Ängste, alles verschwamm und verblasste. Er drängte mich zu der Kiste, riss mit einer schnellen Bewegung die Hängematte aus ihrer Verankerung und warf sie zur Seite. Leise stöhnend, zog er mich auf seinen Schoß. Seine Hände fuhren meine Hüften entlang, meine vergruben sich in seinem Haar. Seufzend lehnte ich mich ihm entgegen und überließ mich dem Gefühl der Liebe, die gerade die erste Hürde umschifft hatte.
„Ich glaube, ich habe mich geirrt“, raunte er später zärtlich in mein Ohr. Die Hängematte hing wieder an ihrem Platz. Mit einiger Mühe war es uns gelungen nebeneinander darin Platz zu finden.
„Worin?“
„In meiner Einschätzung über die Liebe“, murmelte er. „Es ist nicht lange her, da habe ich geschrieben, dass die Welt ohne Liebe besser dran wäre.“
Was man sich alles behält, wenn man es als junger Mensch auswendig gelernt hat. Ich erinnerte mich an den genauen Wortlaut:
'Die Liebe ist nichts für mich. Denn was heißt Liebe? Eine Leidenschaft, die das Universum beiseite schiebt, um nichts zu sehen, als den geliebten Gegenstand.' Was daran allerdings schlecht sein sollte, verstand ich nicht.
Auf St. Helena, am Ende seines Lebens, schrieb er: 'Auch ich war einmal verliebt und weiß genug davon, um Definitionen zu verachten, die die Sache nur verwirren. Ich leugne ihre Berechtigung, ja mehr, ich halte sie für schädlich für die Gesellschaft und für das Glück des Einzelnen. Ein Segen des Himmels wäre es, die Menschen davon zu befreien.' Bittere Worte.
„Und jetzt weißt du, dass das nicht stimmt?“
Ein Lächeln zog über sein Gesicht.
„Teilweise. Ich sehe meine Kameraden, wie sie sich verlieben, sich töricht benehmen und ihre Pflichten vernachlässigen. Das verurteile ich noch immer. Wenn man sich durch die Liebe wie ein Tor verhält, wäre man ohne sie besser dran.“ Er spielte mit meinen Haaren und fuhr sanft die Konturen meines Nackens nach.
„Aber ich habe auch geschrieben, ich könnte darauf verzichten. Das muss ich korrigieren.“ Jetzt küsste er meinen Nacken. „Mit der richtigen Frau an meiner Seite gibt es nichts Erstrebenswerteres.“ Besitzergreifend zog er mich fester an sich. Seine Worte machten mich glücklich und zauberten ein Lächeln auf mein Gesicht, das einfach nicht mehr verschwinden wollte.
Wir schwiegen lange und genossen einfach nur den Augenblick. Das Leben mit all seinen Unzulänglichkeiten würde uns früh genug einholen.
„Hast du Hunger?“ Da hatte es uns wieder.
„Muss ich aufstehen, wenn ich ja sage?“, fragte ich träge.
„Ja.“
„Dann nicht.“
„Und wenn du nicht aufstehen musst?“
„Einen Bärenhunger“, gab ich zu.
„Ich werde etwas besorgen.“ Er wollte sich erheben. Das brachte die Hängematte so heftig ins Schwanken, dass ich herauszufallen drohte. Lachend schloss er mich fest in die Arme. „Jetzt bleibst du für immer bei mir!“
Sein kindlicher Überschwang brachte mich zum Lachen. „Das klingt wunderbar! Aber du weißt, dass das nicht geht.“
„Ich liebe dich, Marie, und ich möchte dich bei mir haben! Wenn du nicht da bist“, er suchte nach Worten, „dann fehlt ein wichtiger Teil von mir. Ich lasse dich nicht gehen.“
Sanft strich ich ihm mit einer Hand über die Wange. „Nein.“
Er ließ mich los, wandte sich ab und begann, sich anzuziehen. Erneut blitzte Zorn in seinen Augen auf.
„Es ist ein anderer Mann, nicht wahr?“, kam die gepresste Frage.
Was sollte das denn? „Es gibt keinen anderen.“
„Ach, Marie, mach mir nichts vor. Du müsstest jetzt ungefähr fünfundzwanzig sein? Du kannst mir nicht erzählen, dass deine Familie dich nicht verheiraten will! Das ist längst überfällig. Hässlich bist du nicht, alt siehst du nicht aus und dumm bist du sicher nicht. An Bewerbern dürfte es nicht mangeln.“
Wenn du wüsstest! Laut sagte ich: „Du schmeichelst mir.“ Meine Stimme wurde eindringlicher: „Ich bin verheiratet!“
„Hab ich es doch geahnt!“ Er sprang auf und, setzte sich gleich wieder, da kein Platz im Raum war.
„Und zwar mit dir, du ...!“ Ich brach ab, da ich nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte. „Seit über drei Jahren! Am Hochzeitstag habe ich gesagt, dass ich nie bleiben kann. Du wolltest mich trotzdem! Ich war ehrlich zu dir! Wenn dir das nicht genügt, werde ich gehen!“ In einer kurzen Pause überlegte ich meine nächsten Worte. „Und nie wiederkommen.“
Ein wenig theatralisch, aber das, was ich fühlte. Wie konnte ein Mann, der eigentlich gar nicht real war, mich so verletzen? Bewusst provozierend blickte ich zu ihm hinüber.
Gefühle zu verbergen, gehörte nicht gerade zu seinen Stärken. Er biss die Zähne aufeinander, um einen erneuten Wutanfall zu unterdrücke. Seine Faust öffnete und schloss sich in schnellem Rhythmus. Endlich entspannte sich sein Gesichtsausdruck.
„Ich bin verrückt, Marie - verrückt nach dir.“ Jetzt grinste er. „Sonst habe ich meine Sinne ganz gut beisammen, denke ich.“ Er war zu mir getreten. Seine Hand auf meinen Schultern fragte er: „Wann musst du gehen?“
Ich schüttelte den Kopf. „Ich weiß es nicht. Wenn es Zeit ist zu gehen, gehe ich.“
Er zog mich zu sich heran und betrachtete mich. „Du verwirrst mich. Ich kenne dich kaum. Ich weiß nicht, ob dein Name Marie ist. Ob es stimmt, dass du aus Mainz kommst. Wie alt du wirklich bist. Was du wirklich machst. Wie du wirklich denkst. Verdammt, ich kenne nicht einmal eine deiner Vorlieben, und dennoch - Ich liebe dich!“
Die Anspannung, die sich zu Beginn seines Monologs in mir aufgebaut hatte, wich.
„Irgendwann werde ich dir alles erzählen - und ich liebe Schwertlilien.“
Er hob seine Brauen. „Ach ja?“
In dem Moment wurde mir klar, dass Schwertlilien das bourbonischen Königshaus symbolisierten. 1793 war nicht gerade der günstigste Zeitpunkt, um diese Blumen als Lieblingsblumen zu haben. Ich lächelte schuldbewusst und hob leicht die Schultern.
Der Argwohn auf Napoleones Gesicht verschwand und er lächelte jetzt. „Mutig, das zu sagen – oder dumm.“
„Es ist wahr.“
Er hob beschwichtigend die Hand. „Du wirst Schwertlilien von mir bekommen.“ Sein Blick fiel auf die Hosen, die ich getragen hatte. „Die kannst du nicht anziehen. Warte hier, ich besorge dir etwas anderes.“
Ich bekam einen kurzen Kuss und er verschwand. Es blieb mir keine Zeit zum Nachdenken, denn augenblicklich trat er wieder ein.
„Hier, der sollte es tun.“ Er reichte mir einen einfachen dunklen Rock. „Der ist von meiner Mutter“, beantwortete er meine nicht gestellte Frage. „Und Essen habe ich auch.“ Mit einer schnellen Handbewegung holte er Brot und getrocknetes Fleisch aus einem Beutel. „Nicht gerade ein Festmahl, aber für Schiffskost nicht schlecht.“
Ich lächelte und streifte ein Hemd über. „Deine Mutter hat erzählt, dass du jetzt Hauptmann bist.“
„Oh ja!“, antwortete er nicht ohne einen gewissen Stolz in der Stimme. „Aber was hat es mir gebracht? Wir haben unser Heim verloren.“ Er sank auf den Hocker. „Du hattest von Anfang an recht. Paoli stand nie hinter mir und meiner Familie. Er hat zu viele Jahre im englischen Exil verbracht und betrachtet uns alle mit Misstrauen, weil wir nicht mit ihm gegangen sind.“ Sein trauriger Blick streifte mich. „Du hast mir vor Jahren gesagt, dass ich Korsika nicht befreien kann.“ Das normalerweise leuchtend helle Blau seiner Augen hatte sich getrübt und wirkte stumpf. „Vielleicht sollte ich langsam damit anfangen, dir auch die abwegigen Teile deiner Prophezeiungen zu glauben.“ Genauso schnell, wie die Trauer in seinen Blick gelangt war, verschwand sie wieder.
„Das ist eine deiner Stärken: Du glaubst niemals irgendjemandem irgendetwas. Du hörst dir an, was es zu sagen gibt, wägst ab und triffst dann deine Entscheidungen.“
„Ich bin mir nur nicht sicher, ob die immer richtig sind. Ich bin zwar Offizier, aber ich hatte noch nie ein richtiges Kommando. Dabei herrscht Krieg und es gibt viel zu tun! Sieh dir zum Beispiel Toulon an: Dort sind nur Stümper am Werk! Man könnte die Stadt in kürzester Zeit zurückerobern. Mit wenigen Kanonen an den richtigen Stellen wären die Engländer vor Ablauf einer Woche vertrieben. Wenn man mir nur eine Chance geben würde!“
Auf diese Chance würde er nicht mehr lange warten müssen. Ob ich ...?
„Schreib etwas, in dem du deine Gedanken zum Ausdruck bringst“, riet ich ihm. „Gegen den Bürgerkrieg, gegen die Aufstände und für den Nationalkonvent. Du hast immer noch Freunde in Paris.“
In einigen Monaten würde er tatsächlich eine Broschüre mit dem Titel 'Le Souper de Beaucaire' (Das Nachtmahl von Beaucaire) drucken lassen, in der er für den Konvent und gegen den Bürgerkrieg sprach. Sein Landsmann Saliceti in Paris, ein Mitglied des Konvents, würde es lesen und ihm seinen größten Wunsch erfüllen: Als Artilleriekommandeur nach Toulon zu gehen, um die Engländer zu vertreiben. Wie sagt man so schön: Der Rest ist Geschichte.
Jetzt erfüllte erst einmal sein Lachen den Raum. „Weißt du, wie schön es ist, ein paar Stunden mit dir zu verbringen? Deine Sicht der Dinge ist immer so erfrischend anders.“ In ernstem Tonfall fuhr er fort: „Erst einmal bin ich froh, nicht mehr in Paris zu sein, es ist ... Du kannst dir nicht vorstellen, wie es dort zugeht. Ich habe erlebt, wie die Bevölkerung letztes Jahr am 10. August die Tuilerien stürmte. Der Mob geriet außer Kontrolle. Das Gemetzel ...“ Kopfschüttelnd hielt er inne und blickte mich liebevoll an. „Gut, dass du nicht da warst. Ich hätte nicht gewollt, dass du das siehst. Allein der Gedanke, du hättest dort in diese Menge geraten können ...“
Endlich hatte ich einen Menschen gefunden, der mich beschützen wollte, dem mein Wohlergehen am Herzen lag.
„Ich habe gehört, was passiert ist und bin auch froh, dass ich nicht dort war. Was ist aus den Idealen der Revolution geworden?“
„An diesem Tag wurden sie mit Füßen getreten.“ Verachtung sprach aus jeder Silbe. „Leider bin ich sicher, dass es schlimmer kommen wird. Robespierres Ziele mögen richtig sein. Die Art, mit der er es angeht ...“ Er schüttelte den Kopf und drückte meine Hand. „Ich persönlich glaube nicht mehr daran, dass es möglich ist, Gleichheit für alle zu erreichen. Das ist idealistisches Geschwätz. Es wird immer eine herrschende und eine dienende Schicht geben. Man muss eben sehen, dass man auf der Seite der herrschenden steht – und der dienenden das Gefühl geben, dass es so das Beste ist.“ Er stand jetzt und verschränkte die Hände auf dem Rücken.
„Weißt du“, begann er von Neuem, „inzwischen bin ich noch mehr davon überzeugt, dass Rousseau mit seinen Theorien recht hatte: Da ist nichts Gutes im Menschen. Seine Triebfedern sind Furcht, Selbstsucht und Ehrgeiz. Ich bilde da keine Ausnahme. Aber ich habe erkannt, dass ich diesen Gedanken als Grundlage meines Handelns nehmen muss.“
Es fängt an, fuhr es mir durch den Kopf. Der Glaube an die Ideale ist verschwunden. Noch vor drei Jahren wollte er einfach Soldat sein. Jetzt änderte sich das. Jetzt wollte er handeln.
Und mit einer Wucht, wie sie nur eine unerwartete Erkenntnis liefert, verstand ich, was ihn antrieb. Es war nicht Machtgier oder Ehrgeiz – zumindest nicht am Anfang. Es war einzig und allein das Gefühl, es besser machen zu können. Man hatte es an seinen kurzen Sätzen über Robespierre und Toulon hören können: Er, Napoleone Buonaparte, würde es besser machen. Er vergaß dabei, dass selbst Robespierre nicht immer ein Vertreter des Terrors gewesen war. Seine Gedanken und Ziele zu Beginn der Revolution waren völlig andere. Der Mann, der jetzt Tausende unter der Guillotine sterben ließ, galt vor wenigen Jahren als einer der glühendsten Gegner der Todesstrafe. Macht und Verantwortung verändern einen Menschen und seine Ziele. Mein Blick fiel auf Napoleone. In diesem Moment wünschte ich mir nur eins: Die Geschichte sollte gnädiger mit diesem Mann umgehen und ihm dieses Schicksal ersparen. Wunschdenken.
Den Rest der Fahrt redeten wir über belanglose Dinge. Aber das Gespräch ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Nicht mehr lange und er würde all seine Ideale verlieren – und Macht bekommen. Ich versuchte, nicht an die Zukunft zu denken, was gar nicht leicht ist, wenn man sie genau kennt.
Als es langsam dunkel wurde, erreichten wir einen Hafen.
„Ich werde in Calvi an Land gehen“, sagte Napoleone. „Wir müssen Vorräte laden und ich habe einige Dinge zu erledigen. Berière kann sich um dich kümmern.“
Das würde nicht nötig sein. „Ich muss gehen, Napoleone.“ Durch meinen Tonfall versuchte ich zu sagen, dass ich bleiben wollte. Er streichelte meine Wange und flüsterte: „Es mach keinen Sinn zu fragen, wie du von der Insel wegkommst, oder?“
„Nein.“
„Ich dachte ...“ Er brach mitten im Satz ab, „Keine Vorwürfe. Ich habe es versprochen. Aber lass mich nie wieder so lange alleine.“
Ich antwortete nicht.
„Du sagst nichts? Möchtest nichts versprechen?“
Ich hörte den unterdrückten Zorn. Seine Augen verdunkelten sich und glitzerten gefährlich. „Ich kann nicht, Napoleone. Die einzige Möglichkeit dieses Versprechen nicht zu brechen ist, es nicht zu geben. In Gedanken bin ich bei dir“, meine Stimme brach.
„Werde ich jemals mehr als einen Tag mit dir bekommen? Mehr als ein paar flüchtige Stunden?“
Ich schloss die Augen. Das wäre wundervoll. Ein Leben an der Seite des Mannes, der mich liebte. Aber das war nicht möglich. Wenn ich auch nicht wusste, wie das mit den Träumen funktionierte, wusste ich doch sicher, dass daraus niemals mehr als diese Stunden werden würden.
Da ich ihm keine befriedigende Antwort geben konnte, sagte ich nichts und verließ fluchtartig das Schiff.
Anna ließ nachdenklich die Aufzeichnungen sinken. Sie bestätigten ihre Befürchtungen. Napoleone ähnelte Stefan mehr, als Marie zugeben wollte. Und sie steigerte sich da in etwas hinein, das nicht gut enden würde. Das einzig Positive an dieser Sache war, dass sie diese Beziehung nur im Traum führte.
„Und?“ Maries Stimme riss Anna aus ihren Gedanken.
„Merkst du eigentlich, dass dein Napoleone Stefan ähnelt?“
„Das stimmt nicht!“
„Nicht? Er schreit, macht dir Vorwürfe, bringt dich zum Weinen und ein Kuss von ihm lässt dich alles vergessen? Ich sehe da schon Parallelen.“
„Nein. Napoleone stellt keine Bedingungen. Er verlangt nichts von mir. Er lässt mich gehen, das hätte Stefan nie zugelassen. Bei Napoleone darf ich einfach ich sein.“
„Er verlangt nichts von dir?“ Anna konnte nicht glauben, dass Marie das wirklich dachte. „Du denkst nicht, dass da einiges verkehrt läuft?“
„Doch. Er verändert sich, verliert seine Ideale. Er ist jetzt härter.“
Mit geschlossenen Augen massierte sich Anna die Schläfen. „Wir reden immer noch über Träume, oder?“
„Sicher. Auch wenn es sich immer noch nicht so anfühlt.“
„Dann würde ich sagen, dass er zu dem Mann wird, den die Geschichte uns beschreibt: kalt, skrupellos und selbstverliebt. Daran wirst du nichts ändern können.“
Energisch schlug sich Marie mit der Faust aufs Knie. „Ich werde es aber versuchen. Meine Liebe muss doch etwas ändern!“
„Das hat schon bei Stefan nicht funktioniert.“
„Das hier ist anders. Ich bin anders! Diesmal werde ich es schaffen.“
Anna blickte zu Marie, die mit Tränen in den Augen vor ihr saß. „Du würdest wirklich bei ihm bleiben, wenn du könntest, oder?“
Marie nickte. „Das macht mich fertig, Anna. Ich werde nie bleiben können, nie da sein, wenn er abends nach Hause kommt, nie mit ihm die kleinen Dinge des Alltags erleben.“ Ihre Stimme versagte und sie verbarg ihr Gesicht in den Händen.
„Ich weiß nicht, Marie. Wir reden über Napoléon I.. Vielleicht ist es besser, wenn du den Alltag mit ihm nie erlebst?“
„Soll das etwa gut sein?“
„Hast du mal überlegt, warum du diese Träume hast?“
„Woher soll ich das denn wissen?“ Ihre Worte klangen bitterer als beabsichtigt.
„Vielleicht soll dir das Ganze wieder Vertrauen in eine Beziehung geben?“
„Das ist aber ein merkwürdiger Weg, das zu erreichen. Ich soll lernen, eine Beziehung zu führen, indem ich keine führen darf?“
„Wenn du es so formulierst, hört es sich nicht überzeugend an“, sagte Anna seufzend. „Hast du inzwischen eine Ahnung, wer dieser Tristan Berière ist?“
„Keinen blassen Schimmer. Ich habe all meine Bücher durchgesehen und ein wenig im Netz recherchiert. Der Name kommt nirgends vor.“
„Aber er scheint ein Freund deines Napoleone zu sein?“
„Es sah so aus. Sie scheinen sich nahe zu stehen.“
„Ich bin gespannt, ob er noch eine wichtige Rolle spielt. Vorausgesetzt, deine Träume gehen weiter.“