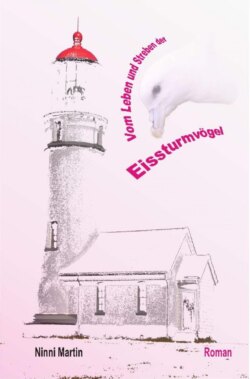Читать книгу Vom Leben und Streben der Eissturmvögel - Ninni Martin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеDer Unterrichtsraum wurde zum Backofen und die blanken Blechwände wirkten wie Heizkörper. Dabei waren es nur die matten Strahlen der Frühlingssonne, welche die Baracke von außen aufheizten. Wie erst hoch drohten die Temperaturen im Sommer zu steigen? Mahoud war von Haus aus einiges gewöhnt. Der Gedanke jedoch, in einer Gluthitze zu schmoren, bis er umkommen würde, erschreckte ihn. Er musste sehen, wie er so schnell wie möglich von hier fortkäme, wenn nicht auf legalem Weg, so durch Flucht. Im Heim für Asylbewerber zog der Sprachkurs sich zäh durch die Unterrichtseinheiten. Eine junge Deutschlehrerin mühte sich redlich ab. Sie litt unter der Hitze und der schlechten Luft besonders und weitaus schlimmer als die dreißig Kursteilnehmer. Viele von ihnen dösten vor sich hin. Wenigstens gaben sie Ruhe und störten nicht. Sicherheitspersonal, das von nahezu täglich wechselnden Dienstleistungsfirmen angemietet wurde, stand vor der Baracke und würde erneut nicht zögern, hereinzustürmen und Aufsässige und Störer niederzuknüppeln. Diese Mietschläger gaben auf ihre Art ein Beispiel von Rechtsstaatlichkeit, in deren Aufnahme die Opfer zumeist begehrten und dafür Anträge gestellt hatten. Mahoud hielt sich aus Konflikten heraus. Er zeigte sich lernwillig und arbeitete mit. Insgeheim nagte in ihm jedoch der Zweifel: Wollte er wirklich in diesem Land Asyl bekommen? Vor fünf Wochen war er in das Heim gebracht worden. Er fand sich unter jungen männlichen Asylbewerbern ohne familiären Anhang, in denen aus verklausulierten Gründen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung gesehen wurde. Genau genommen befand er sich in einem Lager, das von Stacheldraht umzäumt und von Wachmannschaften umstellt war. Mahoud bildete sich bald ein, dass dieser Ort geschaffen worden wäre, um eine unheilvolle Tradition der Geschichte am Leben zu halten. Für seinen Cousin, der ihm den unseligen Rat gegeben hatte, nach Deutschland zu flüchten, empfand er inzwischen puren Hass. Kanada oder Australien hätten ihn menschlicher und vorurteilsfreier aufgenommen. Mahoud sah sich in diesem Heim in Haft genommen, als Vorverurteilter abgestempelt und wie ein Gefangener gehalten. Niemand bekam Freigang. Wer Behördengänge zu erledigen hatte, musste sich in die Obhut von staatlich bestellten Begleitern begeben. Das Leben verlief unter unablässiger Kontrolle, in Eintönigkeit und Enge. Vormittags und nachmittags saß Mahoud im Kurs und versuchte, das Gute daran zu finden. In der Mittagspause gab es Gemeinschaftsverpflegung. Eine Großküche lieferte lauwarmes, geschmackloses Essen. Zweimal in der Woche fuhr ein Lastwagen vor, von dem aus Proviantpakete ausgegeben wurden. Wenn auch in begrenztem Umfang konnte jeder sich abends nach eigenem Geschmack verpflegen. Ein Bolzplatz hinter dem Gebäude lud an den Wochenenden zu Fußball oder Basketball ein. Mahoud nahm einige Male an den Ballspielen teil, bis Mitinsassen die Gelegenheit nutzten, ihn zusammenzutreten. Sie ließen ihre Wut an ihm aus und beschimpften ihn als Spitzel, der sich beim Aufsichtspersonal beliebt machte. Seitdem nahm Mahoud sich in Acht. Er traute niemandem und sprach mit keinem mehr. Ihn bedrängte Angst, im Schlaf erstochen zu werden. Stehlen konnten sie ihm nichts, denn er besaß nichts von Wert und ohnehin war jedem alles Wertvolle genommen worden. Sein Argwohn wuchs allmählich ins Absurde aus. Nur während der Kurse fühlte er sich noch sicher und bewacht. Der Unterricht zeigte bei ihm Wirkung. Vor allem durch den familiären Hintergrund begünstigt, lernte er Deutsch mit Leichtigkeit. Sein Vater beherrschte mehrere Sprachen und der Großvater war als indischer Kaufmann in das Emirat eingewandert. Als Händler mussten sie viele Sprachen und Dialekte so weit, so schnell und so gründlich lernen, um darin Geschäfte zu treiben. Die außerordentliche Anpassungs- und Lernfähigkeit der Benisads wurde belohnt und Mahoud wuchs in einer wohlhabenden Familie auf. Er hatte noch drei Schwestern. Früh wurde er darauf vorbereitet, die Geschäfte fortzuführen. Er lernte Indisch und Englisch, Französisch und Türkisch. Das Kaufmännische hingegen beherrschte er noch immer nicht.
Ohne anzuklopfen, betrat ein Verwaltungsangestellter den Kursraum und gab der Lehrerin ein Zeichen, zu unterbrechen. Er zeigte auf Mahoud und auf drei weitere Asylbewerber. Sie hätten sich sofort im Büro des Heimleiters einzufinden, denn es gäbe Neuigkeiten. Auf dem Weg dahin ließen sie sich Zeit für eine Zigarettenpause und der Vorsteher empfing sie mit einem Wutausbruch, warum sie ihn hatten warten lassen. Nur Mahoud verstand den Wortlaut und die Bedeutung der Schimpfworte und empfand etwas Stolz darüber, wie gut er die fremde Sprache bereits gelernt hatte. Er wagte sogar lauten Widerspruch, der den Leiter für einen Moment in Sprachlosigkeit versetzte. Er argwöhnte wohl, dass unter seiner Obhut Asylbewerber so gut für die Eingliederung vorbereitet wurden, dass sie lernten, sich mit Worten zu wehren. Wenn Mahoud und die anderen seine Hässlichkeiten tatsächlich verstanden hätten, wäre zu fürchten, dass sie sich bei Anwälten und Journalisten über ihn ausließen. Offensichtlich bereute der Vorsteher, sich eben in der Wortwahl vergriffen zu haben und schlug einen freundlicheren Ton an. Er beglückwünschte den Tamilen und die beiden Nordkoreaner und ließ Mahoud dabei aus, denn nur deren Asylanträgen war stattgegeben worden. Fortan waren sie geduldet, konnten sich frei bewegen und einer Arbeit nachgehen. Der Heimleiter drängte zur Eile. Sie sollten unverzüglich ihre Sachen packen und sich bereithalten, um abgeholt zu werden. Einem Verteilungsschlüssel folgend würden sie als anerkannte Asylanten in eine andere Stadt gebracht werden, die sie als Neubürger aufzunehmen hätte. Er reichte ihnen die Hand und verabschiedete sie mit einem verlegenen Gesichtsausdruck. Mahoud war sich sicher, dass keiner der drei Neubürger verstanden hatte, was ihnen soeben eröffnet worden war. Sie würden auf dem Hof einfach stehen bleiben und Zigaretten rauchen, ehe sie etwas belämmert zurück in den Kursraum gingen. Sie hätten auch kein Englisch verstanden. Ohne Dolmetscher blieben sie, wie fast alle anderen auch, im Mahlwerk einer seelenlosen Bürokratie hilflos und verloren. Davon schien der Heimleiter wenig zu ahnen, denn offenbar glaubte er an das System, das ihn ernährte. In einer wohl eingeübten Haltung, als müsse er allgemeine Dienstanweisungen und Vorschriften wie ein Uhrwerk abarbeiten, wies er Mahoud, auf einem Stuhl Platz zu nehmen. Seine Verunsicherung konnte er vor ihm nicht verbergen. In einem ebenso flüchtigen wie unpassenden Anflug des Triumphs genoss Mahoud die soeben bewiesene Macht der neu erlernten Sprache.
»Herr Benisad, Ihr Asylantrag ist abgelehnt worden. Es sieht nicht gut für Sie aus«, sagte der Heimleiter mit verkrampfter Menschlichkeit, die etwas Reue verriet. Dabei geriet er auf dem Gefechtsfeld der Dienstanweisungen in ein Niemandsland, denn zu sehr hatte er eben noch Mahoud mit Schimpfworten überladen, die keine Vorschrift vorsah. Mahoud gab ihm mit einer entspannten Körperhaltung zu verstehen, dass er den freundlicheren Tonfall als Entschuldigung annahm. Er vermied es, nachtragend zu wirken und antwortete auf Englisch, um den Heimleiter nicht weiter zu beunruhigen:
»Was kann ich unternehmen, um die Abschiebung abzuwenden?«
»Sie können gegen die Ablehnung Widerspruch einlegen. Auf diese Möglichkeit muss ich Sie aus rechtlichen Gründen hinweisen. Wenn Sie mich um meine persönliche Sicht fragen, möchte ich Ihnen davon abraten. Denn das Einzige, das Sie mit dem Widerspruch erreichen, ist die Verlängerung Ihres Aufenthaltes bei uns um einige Wochen. Letztendlich werden Sie Ihre Abschiebung nicht verhindern. Sie sollten sich die Enttäuschung ersparen und widerspruchslos in Ihr Heimatland zurückkehren. Wenn Sie heute den Verzicht auf Rechtsmittel gegen die Ablehnungsentscheidung erklären, werden Sie noch in dieser Woche ausreisen.«
Mahoud dachte nicht daran. Er wusste, was ihn erwartete, und der Heimleiter hätte die Folgen ebenso zu kennen. Dennoch fügte dieser hinzu:
»Im Emirat liegt nichts gegen Sie vor. Die Bearbeitung Ihres Asylantrags hat ergeben, dass Sie in Ihrer Heimat keinem existentiellen Druck ausgesetzt sind und nicht aus politischen Gründen verfolgt werden. Sie begehren hier ohne erwiesene Notlage Asyl und müssen deshalb abgeschoben werden.«
»Und warum dürfen die drei anderen bleiben?«, entgegnete Mahoud aufgebracht. »Der Tamile ist ein Mörder. Wären auch die beiden Nordkoreaner keine Verbrecher, könnten sie ohne Schwierigkeiten in Südkorea leben und brauchten kein Asyl in einem anderen Land!«
»Die drei dürfen bleiben, weil sie als Flüchtlinge anerkannt worden sind«, entgegnete der Heimleiter knapp und gab den Moment der Reue auf. Überhaupt sah keine Dienstvorschrift vor, sich mit einem abgelehnten Asylbewerber auf eine Diskussion einzulassen. Dennoch schien er Mahouds Ärger zu verstehen und war ebenso von der Duldung des Tamilen überrascht. Nach einer Gedankenpause gab er kleinlaut zu:
»Das Urteil verstehe ich auch nicht. Zumindest hatte der Tamile eine gute Anwältin und traf auf einen sehr nachsichtigen Vertreter der Widerspruchsbehörde.«
»Wenn ich morgen in meine Heimat zurückkehre, werde ich übermorgen tot sein!«, folgerte Mahoud ängstlich. »Sie und die Sachbearbeiter auf der Ausländerbehörde dürfen nicht daran zweifeln, dass mein Leben in Gefahr ist. Ich werde Widerspruch einlegen, um Zeit zu gewinnen.« Der Heimleiter wich seinem verzweifelten Blick aus. Mahoud sah ein, dass er von ihm keine weitere Hilfe zu erwarten hatte. Er fragte, ob er gehen könne, denn alles schien besprochen zu sein. Als er aufstand, zog ihn der Heimleiter beherzt auf den Stuhl zurück:
»Haben Sie ein Problem damit, sich von einer fähigen Anwältin vertreten zu lassen?« Offenbar kannte er jemanden und sprach aus Erfahrung.
»Nein!«, antwortete Mahoud und fragte sich verwundert, warum er den Anschein gab, als könne er gegen Frauen Vorbehalte hegen. Waren Araber wie er so leicht mit Vorurteilen zu belegen, nur weil sie aus einer archaischen Gesellschaft entstammten?
»Wir sollten versuchen, Frau Wuttke als Ihre Anwältin zu gewinnen«, empfahl der Heimleiter vertraulich und bot seine Unterstützung an. Er nahm für Mahoud Partei, schlug Dienstvorschriften in den Wind und wechselte abermals in das Niemandsland. Offenbar begann der Heimleiter, Gefallen an eigenen Entscheidungen zu finden. Ohne Mahouds Antwort abzuwarten, schickte er ihn hinaus:
»Wenn es jemandem gelingt, auch die hoffnungslosesten Fälle zu gewinnen, dann ist es diese Anwältin und niemand weiß warum. Denken Sie zum Beispiel an den Tamilen, der den besten Beweis für ihre Wunderkraft liefert«, versicherte der Heimleiter zum Abschied, als spräche er von einer Zauberin.
In der Nähe des Zauns wartete Mahoud auf einer Bank unter einer alten Buche, die im Sommer angenehmen Schatten spenden mochte. Noch fehlte das Laub. Das umgebende Gebüsch hielt kaum den kühlen Windzug ab, der über dem Bolzplatz den Staub aufwirbelte und in Schwaden heranwehte. Zumindest gab es rund um die Bank ausreichend Sichtschutz. Der Heimleiter riet Mahoud, sich nicht in den Barackenräumen mit der Anwältin zu besprechen. Die Wände aus dünnem Blech hätten Ohren. Oft wurden den Asylbewerbern nur halbherzige Anwälte zugeordnet, die von vornherein davon ausgingen, nicht viel zu erreichen. Unmut und Neid entstanden immer dann, wenn jemand bevorzugt erschien, der einen fähigeren und entschlosseneren Rechtsbeistand erhalten hatte. Renate Wuttke zählte in dieser Hinsicht zur ersten Wahl. Viele wollten von der alten Anwältin vertreten sein, die mit einer verlässlichen und vergleichsweise traumhaften Erfolgsquote als Hoffnungsträger galt. Nur wenigen wurde dieses Glück zuteil. Deshalb sollte Mahoud sich krankmelden und dem Kurs fern bleiben. So konnte keiner der andern Asylbewerber Verdacht auf eine Bevorzugung schöpfen. Renate Wuttke ließ auf sich warten. Er ahnte, dass seine Anwältin viel beschäftigt war und kaum Zeit für ihn finden würde. Dennoch setzte er seine ganze Hoffnung in sie. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sah er für sich eine gute Chance, mit ihrer Hilfe nicht abgeschoben zu werden, auch wenn alles gegen ihn spräche. Er kannte die Anwältin nur vom Sehen und dem Anschein nach als unruhigen, kettenrauchenden Menschen. Es hieß, dass sie nur denjenigen mit Erfolg verteidigte, für den sie auch Sympathie empfand. Mahoud nahm sich vor, ihr nicht die Zeit zu stehlen und in aller Kürze einen guten Eindruck von sich zu geben. Sie sollte nicht nur aus Sympathie, sondern ebenso aus Vernunft und Überzeugung für ihn kämpfen. Seine Unterlagen aus Schriftverkehr, Antrag und Ablehnungsbescheid hielt er bereit. Viel von dem Juristendeutsch verstand er nicht. Auch sein Dolmetscher konnte ihm die Einzelheiten nicht erklären. Wenn die Anwältin den Fall in ihre Hand nähme, brauchte er sich darum nicht weiter kümmern. Mahoud fing an, in der zugigen Frühlingsluft zu frieren, bis sie endlich kam. Sie kannte die Bank unter der Buche. Offenbar war es ebenso ihr bevorzugter Ort, sich mit Mandanten des Asylbewerberheims zu besprechen, sofern es nicht gerade regnete oder schneite. Kaltes Wetter schien sie nicht zu stören, denn sie selbst verströmte eine gewisse Kälte. Mahoud begrüßte sie mit festem Händedruck und stellte sich ihr selbstbewusst, höflich und nicht unterwürfig vor. Mit tadellosem Englisch und gewinnendem Benehmen versuchte er, vor ihr zu glänzen. Renate Wuttke hätte sofort zu begreifen, dass er mit guten und gepflegten Umgangsformen gelernt hatte, sich zu behaupten. Er wollte nicht wie der Tamile wirken, wie ein plumper ungehobelter Klotz. Sie fände kaum einen zweiten Mandanten, der allein von seiner Ausstrahlung her besser seinen Teil zum Gewinn eines Rechtsstreits beitrüge als er.
»Nun gockeln Sie bloß nicht so herum!«, fertigte Renate Wuttke ihn unversehens ab. »Geben Sie mir endlich Ihre Unterlagen und setzen Sie sich!«
Mahoud verlor der Faden, die Fassung und schließlich den Mut. Er fühlte sich so fremd wie auf einem anderen Stern. Was hatte ihn nur hierher gebracht, wo ihn alle abwiesen? Er überlegte, etwas zu sagen, sich zu entschuldigen, sollte er sich falsch benommen haben.
»Sie antworten nur, wenn Sie gefragt sind«, fuhr ihn die Anwältin an und ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Vergessen Sie diese Regel besonders vor Gericht nicht, wenn wir es so weit überhaupt schaffen!«
Mahoud setzte sich auf die Bank und schwieg. Die Anwältin nahm seine Unterlagen und ging lesend auf und ab. Sie rauchte dabei. Nach drei oder vier Zigaretten schien sie sich eine Meinung über ihn gebildet zu haben.
»Herr Benisad, Sie hätten eher in einem anderen Land Ihr Glück suchen oder sich hier nicht aufgreifen lassen sollen! Sie sind der aussichtsloseste Fall, der jemals an mich herangetragen worden ist. Aller Voraussicht nach wird Ihre Klage gegen den Ablehnungsbescheid vor Gericht noch nicht einmal zugelassen werden.«
Mahoud sah mit offenem Mund zu ihr hinauf und wagte es nicht, einen Laut von sich zu geben. Er zweifelte nicht daran, dass sie ihn als Mandanten dennoch annähme. Sein Fall bedeutete für sie genau die Herausforderung, nach der sie suchte und der sie nicht widerstehen konnte.
Renate Wuttke reichte ihm die Unterlagen zurück und schritt für drei weitere Zigaretten wortlos und in Gedanken versunken auf und ab. Dann wandte sie sich zu ihm:
»Falkner sind Sie? Ist das eine Arbeit, von der ein Mann leben kann?«
Mahoud sah sie verständnislos an.
»Antworten Sie, ich habe Sie etwas gefragt!«
»Es ist keine Arbeit, es ist ein Beruf, eine Leidenschaft!«, erklärte er stolz. Sein Mut kehrte zurück. »Mehr noch, es ist eine Kunst! Ich war damit auf dem Weg gewesen, Ruhm und Anerkennung zu finden und ein Vermögen zu verdienen. Ich galt als wahrer Künstler!«
»Es mag sein, nur dafür können Sie sich hier nichts kaufen. Liege ich falsch, wenn ich annehme, dass sie niemals Prüfungen in diesem Fach abgelegt haben oder brauchbare Sachkundenachweise vorweisen können?« Die Erfahrung gab Renate Wuttke beinahe Gewissheit. Es spielte keine Rolle, ob Sie einen Goldschmied, einen Lehrer, einen Atomphysiker oder einen Falkner vertrat. Kaum einer konnte verwertbare Unterlagen wie Zeugnisse oder Bescheinigungen vorweisen. Sie alle waren gleich, denn sie alle waren Asylbewerber gleichermaßen.
»Ich habe von den besten Falknern lernen dürfen. Geben Sie mir Gelegenheit, zu zeigen, was ich beherrsche«, erwiderte Mahoud trotzig. Natürlich hatte er nie eine Schule für Falknerei besucht, keine Prüfungen abgelegt oder jemals eine Urkunde erhalten. Darauf kam es in seiner Heimat nicht an. Es zählte nur das Können, das täglich zu beweisen war.
»Ohne Jagdprüfung und anerkannte Weiterbildung für Beizjagd sollten Sie sich hierzulande von Greifvögeln fernhalten. Sie werden niemanden finden, der für Sie die Kosten einer ordentlichen Ausbildung übernehmen wird und nach Aktenlage sind Sie mittellos.« Die Anwältin brachte Mahoud auf den Boden der Tatsachen. Minutenlang redete sie auf ihn ein und legte dar, welchen Ordnungen oder Regeln er nicht entsprach. Am Ende sprach sie vom Geld, das ihm fehlte.
»Bitten Sie Ihre Familie um finanzielle Unterstützung und darum, Ihre Schulzeugnisse nachzusenden. Dann könnten Sie als Austauschstudent ein Studium aufnehmen und einen vernünftigen Beruf erlernen.«
»Ich habe keine höhere Schule besucht«, entgegnete Mahoud. Er hatte es längst bereut, sich dagegen aufgelehnt zu haben, von seinem Vater auf ein neuseeländisches Internat geschickt zu werden. Er sollte danach in England, Australien oder Kanada studieren. Als Heranwachsender wollte er nicht unbedingt lernen, viel eher wollte er frei sein. Er besuchte nur eine einfache Handelsfachschule und blieb dem Unterricht oft fern, um sich auf den Golfplätzen als Balljunge und Handlanger zu verdienen. Dort war er gefällig und beliebt. Es fiel ihm leicht, Kontakt zu finden. Der Falkner eines hohen Regierungsbeamten sprach ihn an und beschäftigte ihn später als Helfer. Seine Familie verstieß ihn dafür. Der einzige Sohn der Benisads war zu Besserem geboren worden als für das Leben eines Stallknechts. Nur Mahouds jüngste Schwester hielt noch den Kontakt zu ihm. Als seine Familie ruiniert wurde, weil sie der Rache der Familie des Mädchens, das er geschwängert hatte, zum Opfer fiel, brach auch diese die letzte Brücke ab. Widerstrebend dachte Mahoud immer und immer wieder daran zurück und überhäufte sich mit Vorwürfen. Was für ein liebestoller Narr war er gewesen! Das Mädchen wurde fortgeschickt, um in Frankreich oder in den Niederlanden abzutreiben. Er sah sie nicht wieder, dafür fremde Menschen, die ihm auflauerten. Mahoud kam mit dem Leben gerade noch davon, als auf ihn eingestochen wurde und die Klinge sich in seiner Jacke verfing. Einen weiteren Anschlag hätte er nicht so glücklich überlebt. Er musste sich verstecken und fand niemanden, der ihn aufzunehmen und zu helfen wagte. Mit dem letzten Geld gelang ihm die Flucht außer Landes. Mahoud wollte darüber nicht sprechen, blieb kurz angebunden und beteuerte:
»Ich kann niemanden um Geld bitten. Wie Sie bereits feststellten, bin ich mittellos.« Nichts anderes schien die Anwältin erwartet zu haben. Dennoch verbarg sie ihren Ärger darüber kaum. Für die Vertretung von Asylbewerbern wurde sie aus öffentlichen Mitteln und nach festen Regelsätzen bezahlt. Viel Zeit für diese Art von Mandanten durfte sie deshalb nicht aufbringen, andernfalls würde sich ihr Arbeitsaufwand nicht rechnen. Jeden Asylbewerber ließ sie deutlich merken, dass sie nicht aus Wohltätigkeit handelte und nur das Nötigste unternehmen würde. Wer allein auf Sympathie setzte, läge bei ihr falsch. Wer mehr Einsatz von ihr verlangte, der sollte aus eigener Tasche dafür bezahlen oder die Zahlung für sich aufbringen lassen. Nicht alle Asylbewerber waren wirklich arm. Woher das Geld stammte, vielleicht aus Drogengeschäften, Prostitution, Geldwäsche oder Waffenhandel interessierte sie nicht. Renate Wuttke besaß eine gute Hand, ihre Erfolgsquote zu vermarkten. Sie bestimmte nach eigenen Regeln den Preis für ihre Leistung. Mahoud verwunderte, dass seine Anwältin wegen des Geldes weiter auf ihn einredete und nicht locker ließ. Sie wollte unbedingt herausfinden, ob für ihn nicht doch ein Geldgeber eintreten würde. Am ehesten hätte sie gerne gehört, dass er Mitglied einer Organisation wäre, welche die Öffentlichkeit scheute. Dann wäre sie auch mit einer diskreten und unbürokratischen Bezahlung einverstanden gewesen. Doch Mahoud blieb bei dem, was er ihr bereits versichert hatte:
»Ich bin mittellos. Dennoch bitte ich Sie, mir zu helfen!« Er zweifelte nicht daran, dass der Ehrgeiz der Anwältin ihre Geldgier überwiegen würde. Er ahnte nicht, dass sie ihn insgeheim sympathisch fand. Wäre sie jünger, würde sie sich auf ihn als gut aussehenden, beeindruckenden, eloquenten und intelligenten Mann sogar einlassen.
»Unternehmen Sie zunächst nichts weiter!«, bestimmte Renate Wuttke nach einigem Zögern. Sie hatte sich endlich damit abgefunden, aus seinem Fall kein Kapital schlagen zu können. Wie Mahoud darauf hoffte, würde sie ihn nicht abweisen.
»Wir müssen die Zeit der Widerspruchsfrist so gut wie möglich nutzen. Es darf zu keinem Gerichtsurteil kommen. Ich werde in den nächsten Tagen sehen, was ich für Sie erreichen kann. Sie werden von mir hören.«