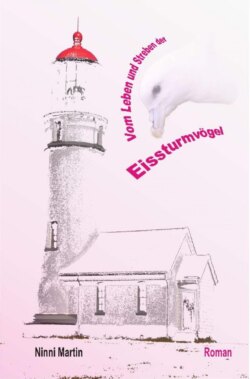Читать книгу Vom Leben und Streben der Eissturmvögel - Ninni Martin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.
ОглавлениеDie Dachwohnung war nun leergeräumt und besenrein. Heinrich ging von Zimmer zu Zimmer und prüfte das Parkett. Im Laufe der Jahre hatten Schrammen und Kratzer sich darin zu einem weitmaschigen Muster zusammengefügt. Unachtsamkeiten der Möbelpacker trugen ein Weiteres dazu bei, dass der Vermieter auf eine Kompletterneuerung bestünde. Die beim Einzug hinterlegte Kaution gliche den Aufwand sicher nicht aus und Heinrich rechnete mit einer sehr hohen Nachforderung. Er hoffte, sich mit dem Eigentümer auf eine Ratenzahlung zu verständigen, denn Geld, das er flüssig hatte, brauchte er dringender zur Renovierung seiner eigenen Immobile. Heinrich ging hinaus auf die Dachterrasse. Er lehnte sich an das Geländer und ließ ein letztes Mal die einst überragende Aussicht auf sich wirken. Er sah ein, dass die Zeit gekommen war, endlich fortzuziehen. Zumindest in dieser Hinsicht nahm er die Schicksalsfügung an, dass Marlene eine feste Stelle bekommen hatte. In Zukunft würde die Familie im Pfarrhaus der Gemeinde leben. Marlene dachte nicht daran, als Pfarrerin eine Berufspendlerin zu sein. Die Seelsorgerin hätte jederzeit erreichbar zu bleiben und das Zentrum der Gemeinde zu bilden, sagte sie und bestand darauf, als Heinrich sie dafür kritisierte. Dass sich für ihn der Weg zur Arbeit fortan um beinahe zwei Stunden verlängerte, störte sie nicht. Er sollte sich eben ein Beispiel an den anderen Berufspendlern des neuen Wohnorts nehmen. Schließlich bezahlten diese den Vorteil, in einer großen Stadt arbeiten und in einer ländlich schönen Umgebung leben zu dürfen, mit einem längeren Anfahrtsweg klaglos. Mit Sicherheit würde sich ihm eine Fahrgemeinschaft anbieten, denn als Pfarrersfamilie stünden sie hoch im Ansehen, und die Menschen suchten auch seine Nähe. Von allein hätte es Heinrich am Willen gefehlt, den endgültigen Schlussstrich unter ihrer viel zu teuren Mietwohnung zu ziehen. Weder er noch Florian empfanden Begeisterung über ihr künftiges Zuhause. »Einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul«, hielt Marlene ihm und seiner Kritik als Redensart entgegen. Immer wieder erinnerte sie ihn daran, dass sie sich im Hochhaus niemals wohlgefühlt habe. Zudem begründete sie den Wohnortswechsel als Gegenleistung, sich nunmehr mit Heinrichs Neuerwerbung ebenso abfinden zu müssen. Marlene hielt das Objekt für eine Schrottimmobilie, das viel zu weit entfernt lag und ein Vermögen für Renovierung und Unterhaltskosten zu verschlingen drohte. Beharrlich blieb sie bei dem Entschluss, nichts dazu beizusteuern. Wie anders konnte sie ihn sonst zum Weiterverkauf bewegen, sollten sich für das Gemäuer jemals Kaufinteressenten finden lassen. Er hatte das Gebäude bei einem Preisausschreiben gewonnen. Von einer alten Kirche war nicht die Rede gewesen und auch nicht von dem baufälligen Zustand, in dem es sich befand. Es war allein als Leuchtturm beschrieben worden. Auf dem Bild der Zeitungsanzeige gab es vor allem einen wunderschönen, rot-weiß gestreiften Turm zu sehen. So viel maritime Romantik wirkte unwiderstehlich. Die Werbeagentur, die das Gewinnspiel in den Wochenendbeilagen etlicher Tageszeitungen platziert hatte, verstand ihr Gewerbe. Heinrichs Glückslos war vor mehr als 150 Jahren zwar als Dorfkirche errichtet, jedoch nur eine kurze Zeit tatsächlich so genutzt worden. Nach einer Kommunalreform mit Zusammenlegung kleinerer Ortschaften hatte das Gebäude für die Kirchengemeinde an Bedeutung verloren. Bereits zur Kaiserzeit war es jahrelang leer gestanden und hatte angefangen, zu verfallen, bis der Kirchturm um die Jahrhundertwende ersatzweise als Leuchtfeuer genutzt wurde. Der ursprüngliche Leuchtturm des Küstenabschnitts war nämlich von einem Blitz getroffen worden und wie eine Fackel niedergebrannt. Die vorübergehende Nutzung der alten Kirche für den Schiffsverkehr lag nahe, weil von See aus ihr Turm sich sehr gut ausmachen ließ. Der Gemeinde brachte der Umbau des Turms in ein behelfsmäßiges Schifffahrtszeichen Mieteinnahmen sowie dem kleinen Teilort einige neue Einwohner. Heinrich widersprach Marlene, wann immer sie von seinem 'Pfarrhaus' und seinem 'Kirchturm' zu reden anfing, wenn sie sein Glückslos meinte und Streit suchte. Er hatte einen Leuchtturm gewonnen, worauf er beharrte. Diese Ruine wäre über einen längeren Zeitraum als Kirchengebäude genutzt worden denn als Leuchtfeuer, pflegte ihn Marlene prompt zu belehren.
Heinrich beugte sich über das Geländer der Dachterrasse und schaute hinunter auf die Straße. Der große Lastzug der Umzugsfirma stand bereits mit laufendem Motor bereit zur Abfahrt. Marlene und ein Vorarbeiter warteten auf der Straße, den Kopf weit im Genick und blickten zu ihm hinauf. Sie verharrten in dieser Haltung eine ganze Weile. Heinrich gab ein Zeichen. Der Vorarbeiter bestieg den anfahrenden Lastzug. Marlene rief etwas hinauf, doch Heinrich konnte sie durch den Motorenlärm nicht recht verstehen. Er winkte ihr noch einmal zu und versuchte ihr zu bedeuten, dass er gleich hinunterkommen würde. Ungeduld war in den letzten Jahren zunehmend zum Wesenszug seiner Frau geworden und offenbar hatte sie ihn damit angesteckt. Heinrich zog sein Mobiltelefon aus der Hosentasche und wählte erneut die Nummer von Tamara Balkov. Abermals hörte er nur die Stimme eines Anrufbeantworters. Er zögerte, ob er der Regionalbeauftragten der Mobilfunkfirma diesmal auf Band spräche. Heinrich sah davon ab, denn er wollte auf keinen Fall zurückgerufen werden. Er stellte an sich fest, dass auch seine Ungeduld mit jedem vergeblichen Versuch einer unbemerkten Kontaktaufnahme wuchs. Marlene sollte nicht wissen, dass er über ein Angebot der Mobilfunkfirma nachdachte, das ihm einen Ausweg aus seiner Geldnot ermöglichen würde. Durch die Vergütung brauchte er seinen Leuchtturm nicht wieder abstoßen und wäre in die Lage versetzt, ihn renovieren zu lassen. Heinrich verließ die Dachterrasse. Auf dem Weg zur Wohnungstür bemerkte er, dass er nicht mehr allein war. Ein Makler führte ein Paar mittleren Alters durch die Räume. Heinrich nahm sich einen Augenblick Zeit, die wahrscheinlich zukünftigen Bewohner wortlos zu mustern. Umsponnen von der Verkaufslyrik des Maklers konnten sie unmöglich ein noch besseres Angebot andernorts in Betracht ziehen. Das Paar schien kinderlos zu sein, gepflegt und augenscheinlich durch Sport- und Diätprogramme beeindruckend in Form. Sie hatten Zeit und Kraft vollständig in den beruflichen Aufstieg investiert, zu dem ein makelloses Äußeres wie selbstverständlich gehörte. Nun sollte eine Wohnung hoch über denen der anderen Stadtmenschen den erkämpften Status schmücken und bekräftigen. Heinrich erinnerte sich zurück an den Tag, an dem er mit Marlene hier eingezogen war. Der Anblick des Paares brachte ihm wieder eine Erkenntnis nahe, die er gerne längst verdrängt hätte und die ihm lästig geworden war. Den Anspruch dieser Wohnung und den damit zur Schau gestellten Lebensstandard hatte er nie erfüllt. Er hätte ehrgeiziger und verbissener um seine Karriere kämpfen müssen. Was hatte ihn daran gehindert? An Florian konnte es nicht gelegen haben. Für ihn war er nie der alles umsorgende, aufopferungsvolle Vater gewesen. Auch als Ehemann war er nicht sonderlich gefordert, sich gegenüber Marlene immerfort zu beweisen, denn für sie war er niemals die Hauptperson. Eine einfache Etagenwohnung oder eine Doppelhaushälfte hätte für das normale Leben seiner Mittelmaßfamilie ebenso genügt. Heinrich grüßte den Makler mit einem kurzen Nicken und ging.
Sie fuhren bereits eine halbe Stunde und hatten den Außenbezirk der Stadt gerade hinter sich gelassen. Die Ausfallstraße verlief geradewegs durch eine landwirtschaftlich intensiv genutzte Gegend mit ausgeräumten Feldfluren, die bis jenseits des Horizonts zu reichen schienen. Dann jedoch bogen sie im rechten Winkel ab und überquerten auf einer engen und geschlängelten Landstraße einen dicht bewaldeten Höhenzug. Im Anschluss daran drangen sie immer tiefer in einen spärlich besiedelten Landstrich ein. Der Redensart nach sagten hier Fuchs und Hase einander Gute Nacht, starben die Leute oder lag der Hund begraben. Wer in diese gottverlassene Einöde nicht hineingeboren worden war, konnte unmöglich länger als nötig bleiben. Zugereiste wären gut beraten, hier keine Wurzeln zu schlagen. Heinrich war die Strecke erst einmal gefahren, allerdings spätabends und bei Dunkelheit. Die Trostlosigkeit, die sich ihm nun bei Tageslicht mit jedem Kilometer, mit dem sie sich ihrem Ziel- und neuen Heimatort näherten, offenbarte, traf ihn hart. Auch Florian sah er leiden. Marlene verfiel ebenso in Schweigen, nicht unbedingt aus demselben Grund. Florian verkroch sich auf der Rückbank. Sein Sohn konnte den Anblick von Wildnis, Öde und verlassenen Dörfern nicht länger ertragen. Im Laufe der vergangenen Woche hatte er beinahe täglich seine Wut und Enttäuschung herausgebrüllt. Wie einen Deportierten würden er und Marlene ihn in einen Gulag verschleppen. Er hatte auf Knien gefleht, sich in der Stadt ein Zimmer nehmen zu dürfen. Dafür sei er zu labil und zu unreif, hatten sie ihm beizubringen versucht. Der Rückfall in Drogenexzesse sei vorherbestimmt, das Versagen in der Schule zwangsläufig. Die Therapeuten der Entzugsklinik hatten eindringlich dazu geraten, Florian aus seinem fatalen Umfeld herauszulösen und ihm die Chance eines Neubeginns zu bieten. Er sei noch jung und formbar und würde sich schnell neuen und günstigen Einflüssen öffnen. Von Vorteil sei es weiterhin, wenn Florian das laufende Schuljahr an einer anderen Schule freiwillig wiederholte, förderliche Freunde und Interessen fände. Zudem bedeute der Wohnortswechsel, dass er sich ohne störende Ablenkung auf ein gutes Abitur würde vorbereiteten können.
»Du darfst den Führerschein machen!«, ermunterte Heinrich seinen Sohn und verstellte den Rückspiegel, damit er Blickkontakt mit ihm aufnehmen konnte. »Ab dem Herbst kannst Du dann mit einem eigenen Wagen in Deine neue Schule fahren.« Das Gymnasium, auf dem sie Florian angemeldet hatten, lag in einem Provinzstädtchen, gute 30 Kilometer entfernt und noch tiefer in der Ödnis versteckt. Der tägliche Weg mit dem Bus dorthin bedeutete eine Weltreise. An einem so weit abgelegenen Ort konnten im Umfeld der Schule ausschweifende Feiern, Alkohol, Drogen und Beschaffungskriminalität keine Rolle spielen. Davon war Marlene fest überzeugt. Für Heinrich blieben genährt von seiner beruflichen Erfahrung leichte Zweifel. Mit dem unausgesprochenen Gedanken an eine tugendhaftere Zukunft ihres Sohnes pflichtete Marlene der Aufmunterung ihres Mannes bei:
»Etwas Besseres kann uns gar nicht passieren!« Auch sie verstellte den Spiegel an ihrer Sonnenblende, um Florian ins Blickfeld zu rücken.
»Euch vielleicht!«, maulte Florian und blieb wortkarg. Die Vorstellung, bald mit einem eigenen Wagen frei und beweglich zu sein, reizte ihn offenbar. Er würde, wann immer es möglich wäre, in die Stadt zurückkehren und sein vertrautes Leben weiterführen. Florian würde durchaus den Vorteil erkennen, eine gute Note im Abitur mit weniger Aufwand auf einem Wiesengymnasium zu erzielen als auf einem städtischen. In der Stadt gab es zu viele Mitkonkurrenten mit den gleichen überzogenen Erwartungen an ein zukünftiges Leben, die um die Gunst der Lehrer buhlten. Heinrich stellte zufrieden fest, dass Florians kleinlauter Protest nicht wieder in einer der fruchtlosen Diskussionen ausartete, die zuletzt nur mit gegenseitigen Schuldzuweisungen und Beleidigungen endeten. Am Ende würde sich Marlene erneut wieder auf die Seite ihres Sohnes schlagen. In den vergangenen Monaten hatte Heinrich sich in seiner eignen Familie zunehmend als Fremdkörper gefühlt. In der Enge des überladenen Mercedes wurde dieses Gefühl geradezu unerträglich. Inzwischen hatten sie auf der Landstraße ihren Umzugslastwagen aufgeholt. Im Schleichtempo schlängelte sich vor ihnen der Lastzug auf der Serpentine eines steilen Abhangs hinunter.
»Überhol doch!«, forderte Marlene, »wir müssen nicht noch eine Stunde unserem Hausrat hinterherfahren.«
»Ich kann nicht sehen, ob es Gegenverkehr gibt«, verteidigte Heinrich seine verhaltene Fahrweise. Auf der engen, steil abfallenden Straße wäre er auch ohne den langsamen Schrittmacher vor ihnen kaum schneller gefahren.
»Angsthase!«, stichelte Florian. Solche Gelegenheiten, sich mit seiner Mutter gegen ihn zu verbünden, hatte er noch nie ausgelassen.
»Du bringst mich nicht aus der Ruhe!«, erwiderte Heinrich und spielte den Gelassenen. Innerlich kochte er vor Wut. Am liebsten hätte er angehalten, wäre ausgestiegen, hätte seinen Sohn von der Rückbank gezerrt und ihn mit einem gewaltigen Fußtritt den Abhang hinuntergestoßen. Die Szene, die er sich dafür in seinen Gedanken ausmalte, verschaffte ihm Genugtuung und besänftigte ihn etwas. In Wirklichkeit hatte er seinen Sohn noch nie gewaltsam angerührt und auch in diesem Moment zweifelte er nicht daran, dass er sich niemals gegen seine Familie vergessen und vergreifen konnte.
»Feigling!«, spottete nun auch Marlene.
Heinrich riss das Steuer herum und gab Gas. Der schwerfällige und ebenso Öl schluckende wie durchzugsschwache Dieselmotor des alten Mercedes heulte laut auf. Vom plötzlichen Lärm musste der Fahrer des Lastwagens einen Schreck bekommen haben, denn der Lastzug ruckte nach rechts und schrammte an die Leitplanke. Funken flogen. Heinrich zog auf die Gegenfahrbahn und ließ seinen Wagen so gut es ging beschleunigen. Wenn auch die Geschwindigkeit nicht allzu groß wurde, wirkte das Überholmanöver wie ein Wettrennen mit dem Lastwagen, der ungebremst auf die nächste Haarnadelkurve zuflog. Es würde eng werden. Ein Traktor mit einem Langholzanhänger bog um die Kurve. Heinrich trat mit aller Kraft auf die Bremse. Die Räder des Mercedes blockierten. Mit rauchenden Reifen rutschte der Wagen auf den Traktor zu, blieb in der Spur und kam rechtzeitig zum Stehen. Der Umzugswagen verzögerte noch immer nicht. Durch die lange Talfahrt waren die Bremsen heiß gelaufen und der Lastzug war das Gefälle ohne Motorbremse hinabgefahren. In einem spitzen Winkel krachte das Führerhaus des Lastwagens gegen die Baumstämme des Holztransporters. Durch den Abprall verkeilte sich der nachdrückende Anhänger des Umzugswagens gegen die Zugmaschine, durchbrach die Leitplanke und stürzte entkoppelt über die Böschung in die Tiefe. Die Zugmaschine selbst kippte zur Seite und blieb quer auf der Straße liegen. Für einen langen Moment herrschte Stille. Jede Bewegung schien wie angehalten und eingefroren. Kühlwasser des Lastzugs, das über den heißen Motorblock sickerte, verflüchtigte sich mit einem anschwellenden Zischen und hüllte den Unfallort allmählich in dichten Dampf.
»Was bist Du nur für ein Idiot«, bemerkte Marlene ausgesprochen sachlich. Heinrich achtete nicht auf seine Frau, sondern blickte in den Rückspiegel. Er wartete nur darauf, bis sein Sohn sich aufrichtete, um auch seinen Kommentar beizusteuern. So weit wollte er ihn diesmal nicht kommen lassen und sprang aus dem Wagen. Er riss die Hintertür auf und zerrte Florian an den Füßen heraus.
»Hast Du etwas sagen wollen?«, schrie er seinen Sohn an, der nicht begriff, wie ihm geschah.
»Los, sag etwas! Wage es endlich!« Heinrich packte Florian am Kragen und warf ihn gegen den Mercedes. Er holte aus, um ihm ins Gesicht zu schlagen. Der Traktorfahrer eilte herbei und warf sich ihm in den Arm, nahm ihn in den Schwitzkasten und drückte ihn zu Boden. Er ließ erst locker, nachdem Heinrich hatte versprechen müssen, Ruhe zu geben. Aus dem Führerhaus der Zugmaschine kletterten nach und nach die Möbelpacker und schließlich der Fahrer heraus. Schlimme Verletzungen hatten sie sich nicht zugezogen und standen nun ratlos herum. Jemand telefonierte, um den Unfall der Polizei zu melden. Nach einer halben Stunde fanden sich zwei Streifenwagen ein. Die Polizisten nahmen den Unfall auf. Heinrich gab seine Aussage zu Protokoll. Als Jurist wusste er, wie er sich zu äußern hatte. Als Betroffener wunderte er sich, wie gleichgültig und entrückt ihm dieser Unfall vorkam. Ein Bergungsunternehmen mit schwerem Gerät wurde herbeigerufen und ließ dennoch über eine Stunde auf sich warten. Marlene und Florian saßen auf der Leitplanke und ließen Zeit vergehen. Heinrich setzte sich zu ihnen. Gemeinsam blickten sie den Hang hinunter, der übersät war mit den Trümmern ihres halben Hausrats.
»Wenn die Versicherung den Schaden übernimmt, verzeihe ich Dir«, sagte Marlene, ohne den Blick von dem Trümmerfeld abzuwenden. »Diese grässlichen Möbel hätten ohnehin nicht in unser neues Heim gepasst!«
»Ja, etwas Besseres konnte uns gar nicht passieren«, stellte Florian fest und ging sofort hinter seiner Mutter in Deckung. Er hatte inzwischen verstanden, dass er sich vor seinem Vater klugerweise in Acht nähme. Heinrich würdigte ihn keines Blickes. Was wäre, wenn die Versicherung die volle Verantwortung für den Unfall und die Schuld ihm zuschieben würde und sie ihn auf dem Schaden sitzen ließe? Wäre ihm dann Marlenes ewige Verdammnis gewiss? Er lachte bitter auf. Marlene sah ihn verwundert an und rückte von ihm ab. Es verging eine ganze Weile, in der nichts weiter geschah. Dann klingelte Heinrichs Mobiltelefon und zeigte die Nummer von Tamara Balkov an, die offenbar die automatische Rückruffunktion ihres Anrufbeantworters nutzte. Heinrich nahm das Gespräch an, misstrauisch beäugt von Marlene. Er sprach nicht viel und sagte nur Ja oder Nein. Schließlich legte er auf.
»Ottmar von Mannwitz«, erklärte Heinrich unaufgefordert. »Ich werde ihn morgen bei einem Gerichtsverfahren vertreten müssen. Ich muss zurück in die Stadt. Ich werde im Büro übernachten.«
»Geh nur wieder an die Arbeit«, antwortete Marlene mit einem Anflug von Ironie, »viel zum Einräumen nach dem Umzug ist uns ohnehin nicht geblieben.«
Heinrich ließ sie in ihrem Glauben. Per Anhalter gelangte er zurück in die Stadt. Am Bahnhof stieg er aus und ein Taxi brachte ihn zu einer Filiale einer Mietwagenfirma in einem Gewerbegebiet. Er buchte einen Kleinwagen für einen Tag zum regulären Tarif und gesondert für das anschließende Wochenende zu einer besonders günstigen Rabattpauschale. In einem Schnellrestaurant einer Autobahnraststätte aß er zu Abend. Er fuhr die halbe Nacht und erreichte in den frühen Morgenstunden den Küstenort. Der Wirt des einzigen Gasthofes hatte den Schlüssel zu einem kleinen Anbau wie üblich unter die Fußmatte gelegt. Heinrich brauchte nicht mit ihm zu telefonieren, um sich anzumelden. Für Stammgäste bot sich die Möglichkeit, zu jeder Zeit in die Kate zu gelangen und eines der noch freien Gästezimmer zu beziehen. Wenn auch jeder Komfort fehlte, hatte er die scheinbar alles umfassende Einfachheit an diesem Ort bereits zu schätzen gelernt. Später einmal würde er recht gut zu den Einheimischen passen, dachte er sich, ehe er einschlief.
Heinrich stand am gemauerten Torbogen, der einst den Zugang zum Kirchengrundstück markierte. Von dort aus gabelte sich ein schroff gepflasterter Fußweg nach rechts einen kleinen Hang hinunter zum Kirchhof und nach links eine Kuppe hinauf zum Gotteshaus. Zum Friedhof führte unterhalb bereits eine eigene und geteerte Zufahrt. Der Weg aus dem Dorf zum Tor war hingegen eng und geschottert geblieben. Seit einigen Tagen werkelte ein Bauunternehmen an und auf dem Grundstück, deren schwere Maschinen den Bogen nicht durchfahren konnten. Ein schrecklich großes Mauerstück neben dem Tor war deshalb niedergewalzt worden. Das müsse sein, versicherte Architekt Kurt Müller ihm. Heinrich brachte der Anblick der ausufernden Verwüstung auf. Seit seinem letzten Besuch vor Wochen waren scheinbar wahllos und überall tiefe Gräben gezogen worden. Bald sollten Stromkabel, Abwasser- und Drainagerohre verlegt werden. Alles wirkte maßlos und übertrieben. Hätten die bestehenden Leitungen und Rohre nicht für eine lange Zeit noch ihren Zweck erfüllt? »Auf keinen Fall!«, beteuerte der Architekt und ließ darüber keine Diskussion aufkommen. Heinrich ahnte, dass sein geringes Stehvermögen infolge seiner technischen Unbedarftheit ihm bald teuer zu stehen käme. Allerdings sei er nicht vom Fach, entschuldigte er sich selbst und zweifelte nicht daran, dass er bis zur Pensionierung beim Ausländerrecht verbleiben würde. Einen Wechsel in ein technisches Arbeitsgebiet, so wie es ihm Ottmar von Mannwitz gerade zeigte, konnte für ihn niemals infrage gekommen sein. Angesichts der Mondlandschaft auf weiten Teilen seines Grundstücks fühlte er sich seltsam bestätigt, auf seinem beruflichen Werdegang zumeist die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Er hatte es eben gewusst, sich von Angelegenheiten fernzuhalten, von denen er zu wenig verstand. Auf zwei Seiten des ehemaligen Leuchtturms oder Kirchturms, wie Marlene ihn unbeirrt belehrte, wenn sie nur bei ihm stünde, war das Fundament freigelegt worden. Ein Geflecht von Armierungseisen zeigte, dass die stützende Unterfütterung mit Beton zu einem der wesentlichen Arbeitsschritte der kommenden Woche zählen würde. Von der Baufirma war an diesem Freitag Nachmittag niemand mehr zu sehen. Die Mannschaft kam aus dem Osten und arbeitete nur an vier Tagen der Woche zu je 10 Stunden. An jedem Donnerstag Nachmittag fuhr der Trupp in das verlängerte Wochenende und weit zurück in die viele hundert Kilometer entfernte Heimat. Alles hätte seine Richtigkeit, beteuerte der Architekt und versuchte, ihm den Gedanken an Schwarzarbeit sofort auszutreiben. Heinrich verließ sich darauf und bohrte nicht nach. Zu viel Gesetzestreue konnte er sich ohnehin nicht leisten. Letzten Endes musste der Architekt seinen Kopf dafür hinhalten, falls Ungereimtheiten zutage treten und eine Anzeige erfolgen würden. Heinrich verstünde sein juristisches Handwerk gut genug, um ihm die Verantwortung zuzuschieben. Die Zeit verrann und er stand noch immer wie angewurzelt unter dem Torbogen. Zum verabredeten Termin war bislang niemand erschienen. Tamara Balkov ließ ebenso auf sich warten wie der Architekt. An einem Freitagnachmittag Termine zu setzen, schien keine gute Idee gewesen zu sein. Frau Balkov konnte es vorgezogen haben, das Wochenende ebenfalls tief im Osten zu verbringen und wäre schon auf dem Weg dorthin. Heinrich überlegte, ob er nach beiden telefonieren sollte. Eine öffentliche Telefonzelle zu suchen, käme nicht infrage und auch sein Mobiltelefon bliebe besser ausgeschaltet. Damit beabsichtigte er, Marlene erst am kommenden Tag anzurufen und zu behaupten, gerade erst an seinem Leuchtturm angekommen zu sein, um nach dem Rechten zu sehen. Seine Frau hätte keinen Anhaltspunkt dafür zu finden, dass er schon am Vortag vor Ort gewesen war. Er traute ihr zu, dass sie insgeheim sein Mobiltelefon orten ließe, wenn ihr die technischen Möglichkeiten dafür zur Verfügung stünden. Heinrich nahm sich schließlich Zeit für einen weiteren Erkundungsgang über sein gewonnenes Anwesen, um sinnvoll das Warten zu überbrücken. Ein Froschkonzert vom hinteren und sumpfigen Bereich des Grundstücks jenseits der Kuppe weckte seine Neugier. Bei seinem letzten Besuch war noch alles still gewesen und Boden wie Wasserpfuhle angefroren und mit Reif überzuckert. Würde er sich nachts an das Gequake gewöhnen können? Ihn überkamen leichte Zweifel, denn immerhin hielt er sich für einen geborenen Stadtmenschen. Er begann zu verstehen, warum der Architekt auf eine so umfassende Drainage gedrängt hatte. Letzten Endes würde die vollständige Trockenlegung des Sumpfes auch ein angrenzendes und geschütztes Biotop vernichten. Auseinandersetzungen mit amtlichen und selbst ernannten Naturschützern waren deshalb vorherbestimmt. Er würde den Kampf annehmen und verbissen um seine Rechte als Eigentümer kämpfen. Er begriff den Widersinn, denn im Grunde sehnte er sich nach Ruhe. Vor allem diese Hoffnung hatte ihn gelockt, den Gewinn anzunehmen. Weit kam Heinrich bei seinem Erkundungsgang nicht. Ein Sportcoupé fuhr bis dicht an den Torbogen heran. Tamara Balkov, die den Wagen steuerte, und der Architekt stiegen aus. Heinrich wunderte sich, dass beide zusammen erschienen, einander kannten und offenbar bei dem Umbau seines Anwesens bereits zusammenarbeiteten. Nun wurde ihm klar, warum der Architekt sich ihm mit dem Vorschlag einer Sanierung geradezu aufgedrängt und den Kontakt zu ihm gesucht hatte. Der Ausbau seines Leuchtturms zu einer Sendeanlage war offenbar von Anfang an das Ziel der beiden gewesen. Heinrich überspielte Verärgerung und Misstrauen mit einer freundlichen Geste und winkte ihnen zu, entgegen ging er ihnen nicht. Einige Minuten musste er warten, bis das Paar auf Gummistiefel gewechselt hatte und schließlich ohne Eile zu ihm hinauflief. Dennoch atemlos stellte der Architekt Tamara Balkov als Repräsentantin der Mobilfunkfirma vor. Den Händedruck mit der jungen Frau empfand er überraschend angenehm. Der gemeinsamen Begehung stand nichts im Weg und er ahnte, welche Vorschläge sie ihm unterbreiten würden. Am Ende ließe er sich auf alles ein, solange ihm ausreichend hohe Pacht- oder Mieteinnahmen sicher wären. Ohne Weiteres würde er gleich an Ort und Stelle den Vertrag mit Frau Balkov besiegeln. Er fand sie sehr sympathisch.
Heinrich schätzte, dass er sich noch daran zu gewöhnen hätte, die vertraute Ausfahrt zu passieren und die Autobahn erst an der übernächsten zu verlassen. Überhaupt war ihm der Weg zu seinem neuen Wohnort auf dieser Route noch vollkommen fremd. Genau genommen kannte er noch nicht einmal sein Zuhause. Marlene rief auf seinem Mobiltelefon an und bat ihn, Torten- und Kuchenstücke für sechs Personen mitzubringen. Eine Konditorei oder ein Café in einem der Dörfer, die er noch durchfahren musste, würde an einem Sonntagnachmittag geöffnet haben. Die Erwartung erfüllte sich nicht. In einem Dorf fand er zwar an der Durchfahrtsstraße eine Konditorei, die jedoch wegen eines Trauerfalls geschlossen blieb. In der nächsten Ortschaft lockten vor einem Ladengeschäft einige Tische mit Stühlen und Sonnenschirmen auf dem Gehsteig. Beim genaueren Hinsehen entpuppte sich das Café jedoch als Eisdiele. Ohne anzuhalten fuhr Heinrich daran vorbei. In den folgenden Dörfern fehlte scheinbar alles. Er traf noch nicht einmal Menschen, die er hätte fragen können. Am Ortsrand seines neuen Heimatdorfes entdeckte er eine Tankstelle. Sie bot ihm die letzte Gelegenheit, süße Stücke zu bekommen, wenn auch abgepackt in Folie und mit dem Haltbarkeitsdatum einer Dauerkonserve. Pflicht und Angst siegten über die Genusserwartung. Heinrich wählte mit einem unguten Gefühl das farblich Ansprechendste aus dem im Ganzen bereits angegrauten Sortiment. Das Kühlregal, aus dem er sich bediente, verdiente diesen Namen nicht. Schimmel auf einem See von Kondenswasser in einer verstopften Abflussrinne mahnten ihn, später nur bei einer Tasse Kaffee zu bleiben und nichts davon anzurühren. Er zahlte mit Kleingeld und fragte nach dem Weg. Soweit Heinrich sich erinnerte, musste er an der Kirche abbiegen und gut einen Kilometer hinter dem Ortsrand in ein enges, schluchtartiges Tal hineinfahren. Die Umgebung, die er nun zum ersten Mal bei Tageslicht betrachtete, erdrückte ihn. Steil und dicht bewaldet zogen die Hänge zu beiden Seiten der schlecht geteerten Straße hinauf. In dieser düsteren Gegend versprachen die Tage besonders kurz sein und bei Regen ließe sich die Zeit nur an einer Uhr ablesen. Das Reich der Finsternis stellte sich vor und schien Heinrich zu prüfen, ob er hier wirklich leben wollte. Natürlich kamen ihm Zweifel, die ihn drängten, einfach umzudrehen. Beinahe stand er davor, tatsächlich Reißaus zu nehmen vor diesem erbärmlichen Ort, vor Marlene und Florian und vor einer Zukunft, die er gewiss nicht wünschte. An einem regnerischen und trüben Tag hätte er die Wende auch tatsächlich vollzogen. Jedoch schien die Sonne und stand hoch im Zenit. Lichtstrahlen fanden ihren Weg durch das dichte Geäst von Baumkronen, die sich über die Straße wölbten. Als er um eine Kurve bog, sah er sein neues Heim auf einer Lichtung. Farbenfroh und bunt strahlte ihm ein altes Fachwerkhaus entgegen und lud ihn ein, darin zu wohnen. Heinrich konnte sich nicht dagegen wehren, dass das Gebäude, offenbar ein ehemaliges Forsthaus, für den Moment einen gewissen Reiz auf ihn ausübte. Zumindest war er neugierig geworden und die unbestimmte Ablehnungshaltung wich aus seiner Stimmung. Heinrich fuhr dicht an den Jägerzaun heran, der den kleinen und noch ungepflegten Vorgarten des Hauses umgab und parkte hinter dem Wagen von Renate Wuttke. Ein Fahrrad lehnte daneben an einem Holunderstrauch. Abgesehen von einem ihm noch unbekannten Gast waren seine Schwiegermutter und ihre Schwester zu einem Einweihungsbesuch gekommen. Vor allem deshalb hatte Heinrich für die Kaffeetafel zu sorgen. Bis auf den Kuchen ließ er sein Gepäck im Wagen und ging einen Fußweg entlang zur Haustür. Er klingelte und wartete, doch niemand öffnete. Er läutete erneut und fragte sich, warum er noch über keinen Hausschlüssel verfügte. Würde er jemals in diesem Gemäuer etwas zu bestimmen haben? Er wartete nicht länger und umrundete das Gebäude durch den Garten. Auf einer Wiese und neben einem blühenden Schlehenbusch sah er Marlene und ihre Gäste um einen blumengeschmückten Tisch sitzen. Zwei Thermoskannen mit Kaffee standen auf einem Beistelltisch daneben. Heinrich näherte sich und machte mit einem freundlichen Gruß auf sich aufmerksam. Florian nahm keine Notiz von ihm. Die anderen winkten ihm fröhlich bis ausgelassen zu. An der Art des Hemdkragens erkannte er den Unbekannten als einen katholischen Priester.
Eine bereits geleerte Sektflasche sowie eine noch halb volle Wodkaflasche erklärten die Heiterkeit der Älteren ebenso wie den Missmut von Florian. Sein Sohn saß vor einem Glas Kola und hatte durchaus Grund, sich als Einziger wie auf einem albernen Kindergeburtstag zu fühlen. Besonders ausgelassen zeigte sich der Priester, indem er Gottes Gruß an ihn um einen Trinkspruch erweiterte. Hochwürden neigte wohl aus Erfahrung dazu, zu Besuchen in der näheren Umgebung besser das Fahrrad als ein Auto zu benutzen. Marlene rückte etwas zur Seite und schuf Platz, der ausreichte, dass Heinrich auf einem Plastikgartenstuhl sich gerade noch zwischen ihr und Renate Wuttke zwängen konnte. Ein Gedeck wurde ihm zugeschoben, obwohl er mit einer ablehnenden Geste zeigte, dass er darauf keinen Wert legte. Marlene verteilte wortlos die Kuchenstücke, die er mitgebracht hatte, und schenkte den Kaffee aus. Sie hatte Besseres, zumindest Vorzeigbares von ihm erwartet und mühte sich, ihre Enttäuschung zu verbergen. Später am Abend, wenn alle gegangen wären, würde sie ihm dafür mit Vorhaltungen begegnen. Für den Augenblick jedoch beließ sie es mit einer Spitze:
»Na, wie hast Du Dich als Küster in Deiner eigenen Kirche gefühlt?«, frage sie mit gespielter Neugier und erklärte dem Priester:
»Mein Gatte hat beim Preisausschreiben eine Kirche gewonnen.« Ihre leise Bemerkung im Anschluss, dass er als Dummkopf sich eine Ruine habe andrehen lassen, hätte gleichwohl hörbar ihren katholischen Amtsbruder erreichen können. Heinrich erkannte die leidigen Anzeichen, dass seine Frau unter dem Einfluss von Alkohol wieder in die Peinlichkeit abglitt, die Beherrschung zu verlieren. So ließ sie auch diesmal die Gelegenheit nicht aus, ihn vor einem fremden Menschen bloßzustellen. Er schämte sich für sie und empfand eher als Wut vor allem Mitleid.
»Das Gebäude ist ein Leuchtturm«, berichtigte er und wandte sich mit selbstbewusster Miene an den Priester. Er brauchte den Geistlichen nicht überzeugen. An dessen glasigen Augen war deutlich zu erkennen, dass er ziemlich benebelt war und von Marlenes Anspielungen ohnehin nicht viel verstanden haben konnte. Heinrich ahnte, dass die beiden nicht nur in beruflicher Hinsicht gut miteinander auskommen würden. Bald würde er ihnen vorschlagen, gemeinsam ein Treffen anonymer Alkoholiker zu besuchen. In der mittleren Abstufung zwischen sturzbetrunken und nüchtern befand sich neben Marlene auch ihre Mutter. Diese kicherte ständig vor sich hin und wusste selbst nicht worüber. Ihre Körperhaltung zeigte, dass sie sich anders als ihre Tochter noch unter Kontrolle hielt. Renate Wuttke hatte weniger als die übrigen getrunken und war vollkommen nüchtern geblieben. Er erinnerte sich, dass sie dennoch unschlagbar trinkfest war und weithin als Frau mit Kondition galt. Von dieser Gabe hatte sie in zahllosen harten Verhandlungen im Laufe ihres langen Berufslebens gnadenlos Vorteil gezogen.
»Es geht mich nichts an, lieber Heinrich«, raunte Renate Wuttke ihm zu, »aber Sie sollten sich nichts einreden. Es war und ist eine Kirche.« Heinrich sah sie enttäuscht an. Sie hatte sich auf Marlenes Seite geschlagen. Ihm schien es lästig, mit ihr zu streiten, und wich aus:
»Unterhalten wir uns besser über etwas anderes, liebe Renate.«
»Das denke ich auch«, lachte Renate Wuttke und ließ davon ab, ihn aufzuziehen. »Reden wir doch von Ihrer und Marlenes Hausratversicherung. Ich darf davon ausgehen, dass Sie mich mit der anwaltlichen Vertretung beauftragen, falls es bei der Schadensregulierung zu Unstimmigkeiten kommt. Ich rechne damit, dass Ihnen als Unfallverursacher grobe Fahrlässigkeit unterstellt wird.«
Die Anwältin rief ihm das Unglück an ihrem Umzugstag in Erinnerung, an welches er das ganze Wochenende nicht zurückgedacht hatte. Mit ihr teilte er die Einschätzung, dass das Versicherungsunternehmen ihm Schwierigkeiten bereiten würde. Ohnehin hatte er sich vorgenommen, im Streitfall sich an Renate Wuttke zu wenden:
»Das ist doch Ehrensache, dass Sie Ihre Nichte und mich vertreten werden.«
Die Anwältin nickte zufrieden. Natürlich hatte sie sich zuvor mit Marlene verabredet, doch gab sie ihm das Gefühl, dass auch seine Zustimmung notwendig wäre.
»Da ist noch etwas«, ergänzte Renate Wuttke und rückte enger an ihn heran, »ich denke an die Jagdgesellschaft derer von Mannwitz am nächsten Wochenende. Sie nehmen wieder daran teil? Wie im vergangenen Herbst gibt es eine Jagd auf Überläufer.«
Heinrich war die Jagd längst entfallen. Nun erinnerte er sich an das Einladungsschreiben, das ihm Ottmar von Mannwitz vor einigen Tagen über den Tisch gereicht hatte. Die von Mannwitz drückten damit Ihre Anerkennung für sein Bemühen um Ihren Sohn aus. Aus Diplomatie hatte er beim letzten Mal die Einladung angenommen und sich zusammen mit Renate Wuttke, die wie als feste Größe zu jeder Jagd dazugehörte, daran beteiligt. Damals hatte er nicht wissen können, wie lange er noch mit Sohn Ottmar das Büro teilen musste. Ihm hätten unangenehme Folgen gedroht, das Entgegenkommen derer von Mannwitz nicht zu beachten. Deren weitreichender Einfluss in der gehobenen Gesellschaft war allgemein bekannt und nicht wenig gefürchtet. Bald würde er mit seinem Schützling nichts mehr zu schaffen haben und die von Mannwitz konnten ihm gleichgültig sein. Heinrich hatte längst das Interesse an der Jägerei verloren. Er hasste es, an seinen freien Tagen früh aufzustehen. Ihn widerte der überzogene Pomp und Protz der Jägersleute aus Landadel und Wirtschaft an. Die Elite fand sich im Morgengrauen nur zusammen, um sich gegenseitig Naturverbundenheit vorzuspielen. Das Warten und Frieren auf morschen Jägerständen ödete ihn an. In seiner ganzen Jagdlaufbahn hatte er noch nichts erlegt. Er schoss unverbesserlich schlecht und zuverlässig meterweit daneben. Heinrich sah sein weidmännisches Unvermögen durchaus als Vorteil. Bei jedem Fehlschuss war er dankbar dafür, dass er Wildtieren das Schicksal, angeschossen zu sein und qualvoll zu verenden, ersparte. Kurz nach der Heirat hatte ihm Marlenes Tante den Floh mit der Jagd ins Ohr gesetzt. An einem Nachmittag und, soweit sich Heinrich erinnerte, bei einer Kaffeetafel so wie dieser, hatte Renate Wuttke ihn dafür gewonnen. Marlenes Vorbehalte, dass ihr Ehemann das Töten lernen würde, hatte sie nicht gelten lassen und ihn auf die Jagdprüfung vorbereitet. Seither nahm Renate Wuttke ihn hin und wieder zu Jagdgesellschaften mit und stellte ihm Waffe und Ausrüstung zur Verfügung. Zu keiner Zeit besaß Heinrich ein eigenes Gewehr oder hatte jemals eine Pacht erwogen. Einen inneren Antrieb verspürte er für diese Freizeitbeschäftigung nicht und so dachte er nur zögerlich über die jüngste Einladung nach. Renate Wuttke bemerkte, dass er unschlüssig war und eher eine Teilnahme ausschlagen wollte. Sie ermunterte ihn:
»Nun kommen Sie schon! Vielleicht wird es aufregender als beim letzten Mal, als niemand etwas vor den Lauf bekam und wir alle nur bei Regen auf den Jägerständen herumsaßen.« Die Erinnerung an eine schwere Erkältung als Folge der stundenlangen Durchnässung bestärkte ihn in seiner ablehnenden Haltung. Doch die alte Dame ließ nicht locker und legte nach:
»Vergessen Sie die von Mannwitz nicht. Deren Einfluss könnte hilfreich werden, um Florian in eine gute Stellung zu bringen. Nehmen Sie Ihren Sohn doch einfach als Treiber mit. Jeder Teilnehmer hätte ohnehin mindestens einen zu stellen.« Dieser Vorschlag kam für Heinrich nicht unerwartet. Bereits beim letzten Mal hatte sie ihn bedrängt, Florian mitzunehmen. Damals hatte er abgelehnt, weil ihm eine Jagdgesellschaft zu gefährlich für einen Halbwüchsigen schien. Denn nicht nur er galt als miserabler Schütze. Die meisten anderen Jäger trafen auch nicht besser. Im Umgang mit einer Waffe vollkommen ungeübte Freizeitjäger bedeuteten für jeden, der in Schussweite geriete, eine Gefahr.
»Ich denke gar nicht daran!«, platzte Florian heraus und verließ lautstark seine Schmollecke, indem er plötzlich seine Sprache wiederentdeckte. Soweit Heinrich vorausahnte, bedeutete die sich offenbar anbahnende Protestkundgebung seines Sohnes der wohl einzige Beitrag, den dieser zur geselligen Unterhaltung an der Kaffeetafel beisteuern würde.
»Du wirst mitgehen, und wenn ich Dich zur Jagd prügeln werde!«, herrschte Heinrich ihn an. Mit einem vernichtenden Blick übermittelte er dem Sohn unmissverständlich seine Entschlossenheit. Noch ehe Marlene sich für Florian einsetzen konnte, kam Heinrich ihr zuvor und belehrte sie:
»Vergess die von Mannwitz nicht! Zum Wohl Florians werden wir sie mit Sicherheit noch brauchen. Die Zukunft Deines Sohnes wird nicht ohne Risikobereitschaft zu sichern sein!«
»Es ist ebenso Dein Sohn! Du bringst ihn in Lebensgefahr«, empörte sich Marlene und höhnte, »Du zerrst ihn mit wie ein Opferlamm!«
Heinrich lag rücklings auf einer einfachen Isoliermatte. Marlene hatte auf dem Dachboden ein ganzes Dutzend davon gefunden, das eigentlich zur Grundausstattung für Konfirmandenfreizeiten zählte. Die Hängematten, die dort noch lagerten, taugten nicht zur Einrichtung eines Behelfsschlafzimmers. Überhaupt schienen Jahre vergangen zu sein, dass das Inventar gebraucht worden war. Alles roch muffig und die Wolldecken waren von Motten zerfressen. Die Dielen knarrten, wann immer Heinrich sich zur Seite drehte. Marlene lag neben ihm und hatte sich von ihm abgewandt. Er nahm wahr, dass sie nicht schlief, eher hellwach im Stillen weiter grübelte. Sie war erschöpft von dem schier endlosen und harten Streit, durch den sie sich den ganzen langen Abend gequält hatten. Die vergammelten Kuchenstücke hatten nur den Auftakt gegeben. Anschließend waren mit verbitterter Leidenschaft und mit furchtbaren Hässlichkeiten die Unstimmigkeiten über Florians Zukunft übersteigert worden. Zuletzt ging es zum ersten Mal um die Frage, ob ein Zusammenleben noch zu einem Sinn führte. Heinrich war erleichtert darüber, dass in aller Wut und Aufgebrachtheit das Wort Scheidung dennoch nicht fiel. In seinen geheimsten Gedanken hatte er darüber nicht nachgedacht und konnte sich nicht vorstellen, dass er jemals so weit ginge. Würde Marlene die Grenze überschreiten? Schon berufsbedingt hätte sie vor einer Scheidung zurückzuschrecken. Das Amt einer Pfarrerin konnte sich durchaus als eine Art von Versicherungsschutz für eine kriselnde Ehe erweisen. Seine Erleichterung rührte vor allem aus dieser Einschätzung. Sie befanden sich beide im Umbruch, sie nur offensichtlicher als er. Ihr vertrautes Leben lag hinter ihnen. Vieles nähme einen neuen Lauf. Am Ende jedoch würden er und Marlene sich wieder finden. Daran zweifelte Heinrich nicht. Er nahm sich vor, ihr alle Freiheiten zu lassen, die sie brauchte, um in ihrem Beruf und auf ihrer neuen Stelle glücklich zu werden. Um seinen Freiraum wollte er behutsamer kämpfen, ohne Marlene in Wut und Raserei oder noch weiter in den Alkohol zu treiben. Er hatte genug davon. Wenn er die Ehe retten wollte, dann durfte er sich nicht in die Tristesse von Mittvierzigern, die sie beide waren, hineinziehen lassen. Sie hatten eben ihre Lebenszeit zu mehr als die Hälfte verbraucht und großartige Veränderungen schreckten sie ab. Jedoch ebenso wie Marlene konnte er nicht ausweichen, für sich Bilanz zu ziehen. Er verstand nicht, warum alles, was sie beide zusammen und jeder für sich erreicht hatten, so flüchtig schien und wenig wog. Woher war nur diese nagende Unzufriedenheit gekommen? Warum war er so undankbar geworden?
»Ich habe ein Geräusch gehört«, sagte Marlene und fuhr auf.
»Das wird Floh sein«, beschwichtigte Heinrich und drehte sich zur Seite. Sie hatten Florian den Priester begleiten lassen, der am späten Nachmittag, nachdem die Kaffeetafel aufgehoben worden war, nicht mehr geradeaus gehen konnte. Seitdem hatten sie ihren Sohn nicht wieder gesehen. Mitten in der Nacht war er noch immer nicht nach Hause gekommen.
»Nein, das sind andere Geräusche«, beharrte sie nach einer Pause des angestrengten Lauschens. Auch er hörte etwas. Ihm kam es vor wie ein raschelndes Tapsen und ein rasend schnelles Wuseln. Einen Grund zur Beunruhigung sah er darin nicht. Ein altes, morsches Landhaus musste von Natur aus eine völlig andere Geräuschkulisse bieten als ein nahezu vollkommen schallgedämmtes Apartment in der Stadt. Sie waren erst am Anfang, ihre neue Umwelt zu erleben und kennenzulernen.
»Lege Dich wieder hin!«, riet Heinrich unaufgeregt, »es sind wohl nur Mäuse, die im Gebälk um die Wette laufen.«
Marlene sprang auf und hastete zur Tür. Sie schaltete das Licht an und blickte sich mit Schrecken um. Sie war nahe daran, das Weite zu suchen, ohne zu wissen wohin. Erst in diesem Moment schien sie zu begreifen, dass sie tatsächlich in der Wildnis, mitten im Urwald lebten.
»Beruhige Dich, Mäuse tun Dir nichts!«, sagte Heinrich und überlegte, wie er sie ablenken konnte. Sie war nicht der Mensch, der vor Spinnen Angst bekam. Warum sollte sie sich vor Ratten oder Mäusen fürchten?
»In meinem Leuchtturm scheinen Marder sich eingenistet zu haben. Sieh mich an! Was kümmern mich die Mitbewohner? Die Viecher waren lange vor mir dort eingezogen.«
»Für Deine Kirchenfauna bist Du nur ein kurz verweilender Gast. Sie werden Dir hinterherwinken, wenn Du die Ruine wieder abgestoßen haben wirst«, lachte Marlene bitter auf. Er spürte, dass sie nahe daran war, in Tränen auszubrechen.
»Der Dorfpfarrer hat mir gestern im Dachstuhl jene Stellen gezeigt, wohin die Marder sich verkriechen. Er meinte, kein Kammerjäger würde sie jemals von dort vertreiben«, erzählte Heinrich von seinem Wochenendaufenthalt am Leuchtturm.
»Anstatt mit ihm die Baustelle zu besichtigen, hättest Du ihn verklagen sollen«, erwiderte Marlene mit Verbitterung, »er hat Dich betrogen! Das Preisausschreiben war eine Farce und Du warst der Dümmste, den er finden konnte.«
»Und wenn es so gewesen wäre, sehe ich das Gewinnspiel noch immer als glückliche Schicksalsfügung. Ich bin froh, dass ich zum Eigner eines Leuchtturms geworden bin.« Heinrich ahnte bereits, was er heraufbeschwor.
»Du bist doch krank!«, schrie sie ihn wütend an, »das Gebäude ist nichts als Schutt und Schrott!«
Sie waren wieder bei dem leidigen Thema angekommen und für den Augenblick verdrängte sie offensichtlich die Beunruhigung wegen des Ungeziefers in ihrem Haus. Sie ließ das Licht brennen, als sie wieder zu ihrem Lager wankte und sich neben Heinrich legte. Ihr Alkoholspiegel lag noch immer hoch. Eine zweite Flasche Wodka war am späteren Nachmittag allein zwischen ihr und dem Priester die Runde gegangen. Marlenes Mutter hatte vergeblich versucht, ihre Tochter zu bremsen. Weil sie wusste, wie es enden musste, hatten sie und ihre Schwester Hals über Kopf die Heimreise angetreten.
»Wie ist er denn so?«, fragte Marlene, als sie nach einer Weile etwas zur Ruhe fand.
»Wen meinst Du?« Heinrich befand sich bereits im Halbschlaf.
»Der Dorfpfarrer!« Marlene klang neugierig. Er hatte ihr bislang nicht viel von ihm erzählt. Vor der Begegnung am Wochenende traf er nur einmal auf ihn, als sie sich zusammen mit einem Justitiar vom Kirchenamt auf dem Notariat eingefunden hatten. Die Überschreibung der verlosten Immobilie auf ihn als Neueigentümer hatte wenige Minuten in Anspruch genommen und ohne Unterhaltung waren sie danach auseinandergegangen.
»Umgänglich«, antwortete Heinrich und drehte sich seiner Frau zu, um von seinen Erlebnissen vom Wochenende zu berichten. »Er hat auf den ersten Blick so gar nichts Geistliches an sich. Der Mann ist ein Riese, hat einen zotteligen Bart und ist am Hals und an beiden Armen tätowiert. Wer ihn nicht kennt, würde vor ihm davon laufen.«
»Sicher hast Du Dich geirrt und er war nicht der Pfarrer, sondern ein Obdachloser, der sich in Deinem Gemäuer einquartiert hat.«
»Gestern Morgen kam er auf einem Motorrad zum Friedhof. Er hat einfach über Jeans und Lederjacke den Talar geworfen und dann recht anständig eine Beerdigung vorgenommen. Ein normaler Pfarrer hätte die Bestattung nicht würdevoller gestaltet, soweit ich eine solche Zeremonie überhaupt beurteilen kann. Allerdings bestand die Trauergemeinde nur aus eine paar Totengräbern und Sargträgern.«
»Ein richtiger Pfarrer lebt seine Berufung und streift sie sich nicht einfach über, wann immer er sie gerade braucht. Dein Küstenpfarrer scheint nicht nur ein ausgekochtes Schlitzohr zu sein, sondern auch ziemlich oberflächlich. Die Menschen in dem Küstendorf hätten sich nach einem überzeugteren Geistlichen umsehen sollen.«
Marlene hielt ihren Spott nicht zurück. Von sich selbst und ihrer Berufung war sie sehr eingenommen. Niemand könnte ihr das Wasser reichen. Zu lange hatte sie auf eine Pfarrstelle warten müssen. Sie sehnte sich danach, endlich ihre Berufung leben zu dürfen. Enthoben durch den Alkohol und im Überschwang eines Moments der Fröhlichkeit sah Marlene sich am Ziel ihrer Träume. Allmählich wirkte sie versöhnlicher. Die Spannung fiel von ihnen beiden ab. Heinrich erzählte seiner Frau Weiteres vom Vortag. Wie er in dem Gasthaus gut genächtigt hatte und nach einem wirklich gehaltvollen Frühstück im Dorf die Runde gegangen war. Bei einem Friseur war er gewesen. Am späteren Vormittag hatte er die Fortschritte auf seiner Baustelle genau in Augenschein genommen und war mit dem Dorfpfarrer ins Gespräch gekommen. Gemeinsam waren sie in den Turm gestiegen, und zusammen hatten sie in dem Gasthaus zu Mittag gegessen. Dann sei er, so ließ er Marlene glauben, ein Stück die Küste entlang gefahren und am Strand einiger einsamer Buchten spazieren gegangen. Es habe ihm gefallen und gutgetan. Heinrich erzählte jedoch nicht die Wahrheit. Er erwähnte nichts von Tamara Balkov und wie er sich mit ihr in einem Hotel der nächstgrößeren Kreisstadt am späten Samstagnachmittag getroffen hatte. Er verschwieg Marlene, dass er dort stundenlang mit ihr als Vertreterin der Mobilfunkfirma die Klauseln des Nutzungs- und Pachtvertrags durchgegangen war. Zu seinem Vorteil hatte er einige Änderungen am Schriftsatz durchsetzen können. Er erzählte Marlene auch nicht, dass er am Vorabend den Vertrag unterschrieben hatte. Damit war die Finanzierung der Renovierungsarbeiten und des Umbaus seines Leuchtturms für viele Jahre gesichert. In Heinrichs Unterton mischte sich immer deutlicher ein Hochgefühl. Er bekam Angst, sich zu verraten. Bald würde er nicht länger der Versuchung widerstehen, alles hinter sich zu lassen und ein neues Leben an diesem fernen Ort zu beginnen. In seinem Traum erschien ihm diese andere Frau als Liebhaberin. Er war niemals zuvor fremd gegangen. Ebenso schloss er aus, dass Marlene sich hinter seinem Rücken jemals nach einem andern Liebhaber umgesehen hatte. Dennoch hatten Tamara Balkov und er sich für die Nacht ein Zimmer genommen, das Bett geteilt und miteinander geschlafen. Ihn plagten keine Schuldgefühle. Im Gegenteil, er war noch immer ergriffen vom Rausch der letzten Nacht, bewegt von Zufriedenheit, Glück und Erfüllung. Wie lange würde er alles das vor Marlene verbergen und seine Ehe noch bewahren können?