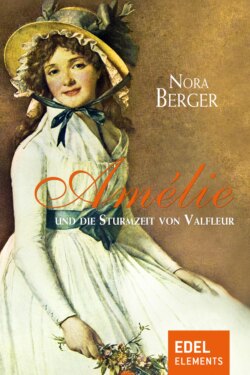Читать книгу Amélie und die Sturmzeit von Valfleur - Nora Berger - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9 Verwirrung der Gefühle
ОглавлениеNebelschwaden zogen am Morgen über die in der Hitze des Sommers vergilbten und vertrockneten Wiesen, und die Luft nahm jene würzige Schärfe an, die nach eingebrachter Ernte das Kommen des Winters ahnen lässt. An diesem Tag hatten d’Emprenvil und de Montalembert, der nun ständig auf Valfleur weilte, nur ein paar Hasen geschossen, und ihre Laune war nach dieser unergiebigen Jagd, bei der sie noch dazu einen der Hunde verloren hatten, nicht gerade bestens. Der Himmel hatte sich plötzlich zugezogen, ein paar Tropfen fielen herab, doch ein böiger Wind, der an den Ästen zerrte, jagte die Wolken davon. Schweigend ritten sie nebeneinander her, jeder in seine Gedanken versunken. Natürlich war es schön, auf die Jagd zu gehen und über Wiesen und durch Wälder zu galoppieren; es war schön, vorzüglich zu speisen und die ausgezeichneten Weine der Gegend zu genießen; es war erbaulich, geistvolle Gedichte zu lesen und amüsante Gespräche zu führen – und doch fehlte etwas. Der brennende Ehrgeiz saß tief im Innern und pochte hinter der Stirn; das Gefühl des Ausgesperrtseins kränkte und kreiste ununterbrochen im Kopf. Machtlos und schweigend mussten sie zusehen, wie Unruhe und Terror immer mehr um sich griffen. Sie durften nicht öffentlich reden und ihre Meinung kundtun, die Hände waren ihnen gebunden und ihr Mund unter der Drohung der Verbannung verschlossen. Wenn nur der König endlich ein Einsehen hätte und einer Begnadigung zustimmen würde!
Ein plötzlicher Regenschauer tauchte alles in ein tristes Grau, und die beiden Reiter beeilten sich, nach Valfleur zurückzukommen. D’Emprenvil, von heitererem Naturell als Graf de Montalembert, der trotz seiner jüngeren Jahre alles eher von der schwereren Seite nahm, übergab sein Pferd mit einer scherzenden Bemerkung dem Stallburschen und eilte ins Haus. Er musste mit Laura das Diner besprechen, das er in der kommenden Woche für ein paar Freunde geben wollte, die ihm am Hof als Fürsprecher und zugleich als Nachrichtenübermittler nützlich sein konnten.
Der Graf zog es vor, trotz des schlechten Wetters noch ein wenig durch den herbstlichen Park zu schlendern. Er schätzte die Gastfreundschaft d’Emprenvils, aber auch er hatte es seit Langem satt, auf dem Gut herumzusitzen und auf seine gewohnten Beschäftigungen zu verzichten, auf seine vertraute Umgebung in der Stadt, auf seine Bücher und Freunde. Warum hatte er sich, trotz seines bedächtigen Wesens, zu offener Rebellion hinreißen lassen? Es war völlig umsonst gewesen, und sein Ruf war fürs Erste ruiniert. Der Zustand des spätherbstlichen Gartens schien seine eigene Stimmung zu spiegeln – von einer Minute auf die andere war die heitere Beschaulichkeit durch eine Laune des Wetters wie hinweggeweht, die lieblichen Hügel waren vom Sturm zerzaust, die Wege matschig und voller Gestrüpp, kalt und struppig die Wiesen. Lange würde er es hier nicht mehr aushalten können, das stand fest. Rastlos streifte er über die aufgeweichten Wege und sog tief die gereinigte Luft in die Lungen ein. Sollte er den König nochmals um Verzeihung bitten und ihm seine treuen Dienste schwören? Er war kein Rebell, und er glaubte an die Monarchie. In seiner Fantasie sah er, wie der König ihm zulächelte und ihn vorzeitig begnadigte, ihn erleichtert als Mittler zwischen dem rebellischen Parlament und seiner despotisch anmutenden Reformpolitik begrüßte.
Völlig versunken in seine Tagträume, nahm er das wilde, unterdrückte Schluchzen in seiner Nähe zunächst gar nicht richtig wahr. Doch dann glaubte er, es hätte sich jemand im Gestrüpp verletzt. Er folgte einem kleinen Pfad, der an einer Weißdornhecke entlangführte, und bog vorsichtig die nassen Zweige auseinander. War das nicht Amélie, die älteste Tochter des Barons?
»Mademoiselle d’Emprenvil?«, fragte er leise, da sie ihn nicht bemerkt zu haben schien.
Erschreckt wandte sie ihm ihr verweintes Gesicht zu. Am liebsten hätte er sich sofort zurückgezogen, da es dem Mädchen bestimmt peinlich sei musste, dass er sie in einer solchen Gefühlsaufwallung sah. Doch es war zu spät, und so murmelte er verlegen eine Entschuldigung, indem er einige Schritte rückwärts tat und dabei unbeholfen über eine Baumwurzel stolperte. Ein Zweig, der sich im Stoff seiner Hose verfangen hatte, riss mit einem hässlichen Geräusch an dem feinen Tuch.
»Ich störe wohl, doch ich... kam gerade so vorbei... und dachte, es sei vielleicht ein Kind, das sich...« Er brach ab, da Amélie ihn aus großen, verweinten Augen reglos wie eine Erscheinung anstarrte, ohne zu antworten. Mit einer Hand verbarg er den Riss in seiner Hose, mit der anderen ergriff er den Hut, der zu Boden gefallen war, dann deutete er, so gut es ging, eine missglückte Verbeugung an und stotterte: »Wenn ich Ihnen sonst irgendwie helfen kann... ich meine... ich dachte... Sie sind vielleicht verletzt...«
Als Amélie sich immer noch trotzig weigerte, etwas zu sagen, entschloss er sich zu einem eiligen Rückzug. Dabei stieß er mit Wucht gegen einen herabhängenden Ast. Verdutzt rieb er sich die schmerzende Stirn und vergaß einen Augenblick die zerrissene Hose, die indiskret ein Stück Haut freigab.
Amélie hatte sein befangenes Gebaren in ihrem Seelenschmerz völlig abwesend beobachtet. Doch nun fühlte sie in der Magengegend ein gänzlich unangebrachtes, seltsames Kitzeln, ein Gefühl, das sie gut kannte und das sie völlig unvorbereitet in bestimmten Situationen befiel. Es stieg empor, weitete ihre Brust, kitzelte in der Kehle und ließ ihre Mundwinkel zittern. Mühsam versuchte sie, es zu unterdrücken, doch es dehnte sich aus und platzte schließlich in einem hysterischen, unaufhaltsamem Glucksen, einem ungehemmten Lachanfall lauthals aus ihr heraus.
Nun war es de Montalembert, der sie verblüfft anstarrte. Hatte er eine Verrückte vor sich? Charles hatte nie davon gesprochen, dass seine Tochter nicht normal sei – im Gegenteil, ihm war sie immer ausgesprochen liebenswürdig und vernünftig erschienen. Er stand eine Weile unentschlossen da und sah ein wenig hilflos zu, wie das Lachen sie schüttelte. Doch plötzlich, er wusste nicht, wie, griff diese unbändige Heiterkeit auch auf ihn über, erst lachte er leise wie aus Höflichkeit, dann immer stärker über das zerzauste Wesen vor sich, die schönen Züge entstellt und vom Weinen gerötet. Etwas unsagbar Losgelassenes lag in diesen Gesichtszügen, eine Hingabe an ein augenblickliches Gefühl, dem sie hemmungslos freien Lauf ließ, etwas, das befreiend und erlösend wirkte. Er lachte auch über sich selbst, wie er dastand, in seiner zerrissenen Hose, mit einer Beule am Kopf. Sie lachten schließlich beide um die Wette, als sei die Welt ein Narrenhaus, ein buntes Kasperltheater.
Als sie nach Atem ringend nach einer geraumen Weile fast gleichzeitig innehielten, kam Amélie die Merkwürdigkeit dieser Situation voll zu Bewusstsein. Sie murmelte verlegen: »Entschuldigen Sie, oh, entschuldigen Sie vielmals! Aber Sie sahen so lächerlich aus, nein, natürlich nicht direkt lächerlich... aber... nein, jetzt rede ich Unsinn. Was müssen Sie nur von mir denken? Ich komme mir ziemlich albern vor!« Mit gesenktem Blick strich sie sich die wirren Strähnen aus der Stirn, warf die aufgelösten Haare zurück und glättete ihr Kleid. Sie war sich der Peinlichkeit der Lage, der Unmöglichkeit ihres Aussehens und des Eindrucks, den sie machen musste, völlig bewusst, und doch fühlte sie sich plötzlich befreit und unsagbar erleichtert. Nach einem tiefen Atemzug machte sie erneut den Versuch, die Situation zu erklären: »Es sah wirklich zu komisch aus, wie Sie da plötzlich vor mir standen, wie aus dem Boden gestampft... mit der zerrissenen Hose. Sie machten Augen wie...«, sie unterdrückte mühsam das Lachen, das wieder hochsteigen wollte, »... wie ein erschrockener Frosch!«
De Montalembert lächelte sie verlegen an und betastete erneut die Beule an seinem Kopf. »Sie haben mir allerdings auch einen Schrecken eingejagt! Ich hielt Sie für toll... oder vielleicht verletzt... Geht es Ihnen jetzt wirklich gut, oder soll ich Sie zum Schloss begleiten?«
»Das wäre ja noch schöner, wenn ich dort nicht allein hinfände!«, erwiderte sie und sah ihn herausfordernd an.
Er war nun endgültig verwirrt und wusste nicht, was er von dem Mädchen halten sollte. Eine überspannte Göre wahrscheinlich. Hatte sie nun geweint oder gelacht, oder beides zugleich? Wahrscheinlich war es nur der dumme Streich eines siebzehnjährigen Mädchens. Aber ihr Lachen war einmalig und ansteckend gewesen. Seit seiner Kindheit war ihm so etwas nicht mehr passiert, und sein ganzer Missmut schien verschwunden, so plötzlich wie ein kurzes Sommergewitter.
Doch Amélie war ernst geworden; sie klopfte sich verschämt den Staub von ihrem Rock und sah ihn kaum an, als sie sagte: »Nein, entschuldigen Sie, ich finde natürlich sehr gut allein nach Haus. Mein albernes Benehmen ist einfach unverzeihlich, aber ich kann es Ihnen erklären... vielleicht nicht jetzt... später einmal. Auf jeden Fall haben Sie sicher einen unmöglichen Eindruck von mir. Erzählen Sie um Himmels willen Papa nichts davon.«
De Montalembert wehrte verwirrt ab. »Nein, da können Sie ganz unbesorgt sein.« Dann fügte er hastig hinzu: »Es ist ja weiter nichts geschehen, als dass ich Sie etwas erschreckt habe – was sicher nicht in meiner Absicht lag.«
Amélie lächelte ihn von unten herauf an. »Hätten Sie vielleicht ein Taschentuch für mich?«
»Aber ja, natürlich!« De Montalembert wühlte eilig zuerst in der einen und dann in der anderen Tasche, um ihr dann ein großes, bluten weißes Tuch zu reichen. »Wo geht es eigentlich hier wieder hinaus?«, fragte er, um die Stille zu überbrücken, während Amélie sich ungerührt die Spuren ihrer Tränen abwischte und sich laut schnäuzte. »Gibt es denn keinen Pfad?« Er betrachtete den Riss in seiner Hose und seinen schmutzverspritzten Rock mit den dunkelsamtenen Aufschlägen, aus dem ein hängen gebliebener Zweig eine Zierknopflasche herausgerissen hatte.
»Natürlich, gleich hier vorne. Und jetzt bin ich es, die Sie nach Hause bringen muss. Ich gehe voraus.« Amélie war schon wieder ganz die Alte, während sie leichten Schrittes den schmalen Weg einschlug, der in einer etwas abenteuerlichen Abkürzung zum Schloss führte.
Sie ärgerte sich nicht wenig über die dumme Situation, in der de Montalembert sie vorgefunden hatte. Hoffentlich würde er den Mund halten, ansonsten könnte es eine unangenehme Fragerei nach sich ziehen. »Was hast du denn, mein Kind? Hat dich jemand beleidigt?« Sie hörte schon den fragenden Ton ihrer Mutter. Niemals würde sie darauf antworten können. Alles nur wegen dieses dummen Armand. Sie wollte ihn nie mehr wiedersehen. Es gab ihr sofort einen Stich durch die Brust, wenn sie nur an ihn dachte. Amélie hasste ihn plötzlich. Dieser falsche Kerl, dieser Lügner! Wie er Isabelle, diese dumme Pute, die ihn anhimmelte, nur angesehen hatte! Schon als Kinder hatten sie sich gegenseitig nichts gegönnt, sie rivalisierten ständig um die Gunst der Eltern und noch mehr um die von Mademoiselle Dernier und natürlich um banale Dinge wie den größten Schokoladenpudding. Aber es war ihr eingehämmert worden, die Jüngere immer zu verteidigen, sie zu beschützen. Und nun ging es um einen Mann. Das war etwas völlig anderes. Sollte sie Isabelle, die Dünnhäutige, die Sensible, vor ihm warnen, doch wie sollte sie es anstellen, hin und her gerissen zwischen Wut, Trauer und Eifersucht? Und ich zahle es ihr doch irgendwie heim!, dachte sie wieder zähneknirschend, wenn sie an Isabelles verzückten Gesichtsausdruck dachte. Ein Schauder überkam sie, sie fröstelte in der kühlen, feuchten Herbstluft und fühlte einen plötzlichen Schwindel, sodass sie stehen bleiben und sich an einen Baumstamm lehnen musste.
De Montalembert war sofort bei ihr, fasste sie am Arm und sah in ihr leichenblasses Gesicht. »Was ist mit Ihnen?«, fragte er, aufs Neue beunruhigt. »Ist Ihnen kalt?« Er zog seine Jacke aus und legte sie ihr über die Schultern.
Amélie fühlte, wie ihre Zähne vor Frost aufeinanderschlugen, und war nicht imstande zu antworten. Sie lehnte sich an de Montalembert und vergrub ihr Gesicht in seiner Jacke, während sie fürchtete, jeden Moment ohnmächtig zu werden. Vorsichtig legte er den Arm um sie und stützte ihre schmale Gestalt, in der ständigen Angst, dass er vielleicht doch eine Kranke oder Hysterikerin vor sich hatte. Amélie zitterte am ganzen Körper, es schüttelte sie förmlich, und sie klammerte sich wortlos an ihn. Nach einer Weile ließ das Zittern nach, sie atmete tief durch und fühlte, wie ihre Kräfte zurückkehrten.
Sie machte sich los, und ihre ersten Worte waren, während sie de Montalembert bittend ansah: »Sie werden doch zu Hause nichts von dieser Geschichte erwähnen? Ich bitte Sie, versprechen, nein, schwören Sie mir, dass Sie es niemandem sagen werden!«
Der Mann lächelte verlegen und sah sie forschend an: »Ich wüsste nicht, was es da zu erzählen gäbe. Was auch immer, es ist ja nichts geschehen. Doch ich mache mir wirklich Sorgen um Sie...«, fügte er hinzu und strich ihr unwillkürlich eine Haarsträhne aus der Stirn.
Amélie blickte ihn mit ihrem liebenswürdigsten Lächeln an. Sie fand, dass der Freund ihres Vaters viel netter war, als sie zuvor angenommen hatte. Seine graugrünen Augen, mit denen er sie etwas unsicher anblickte, strahlten eine so liebenswerte Anteilnahme aus, dass man das Gefühl hatte, einem solchen Mann alles anvertrauen zu können. Bisher hatte sie ihn wahrgenommen, wie einen unter vielen Besuchern und Gästen, die kamen und gingen, doch nun sah sie, dass seine ernsten Züge eine große Offenheit ausdrückten und sich Stimmungen und Gefühle ganz klar darin spiegelten. Das Mädchen bemerkte, dass auch er sie ganz aufmerksam ansah, und sie fühlte instinktiv, dass sie ihm trotz ihres verweinten Gesichtes und ihrer wirren Haarmähne nicht missfiel. Sie reichte ihm die Hand mit aller Anmut, die ihr im Augenblick zu Gebote stand, und er zögerte nicht, einen zarten Kuss darauf zu drücken.
»Lassen Sie mich allein gehen«, bat sie, »ich fühle mich schon besser. Haben Sie vielen Dank für ihre Hilfe. Sie waren wirklich... wunderbar!« Mit diesen Worten warf sie ihm seine Jacke zu, drehte sich um und lief davon.
De Montalembert schaute ihr eine Weile reglos nach. Er wurde nicht schlau aus ihr, doch ihre Wildheit, ihre Hemmungslosigkeit und die Art, wie sie mit sanfter Stimme so einfach gesagt hatte, er sei wunderbar, hatten ihm ein wenig den Atem verschlagen. Er schüttelte über sich selbst den Kopf und ging langsam auf das Haus zu. Mit einem Mal fiel ihm ein, dass er die ganze Zeit nicht mehr darüber nachgedacht hatte, auf welche Weise er seinem Zwangsaufenthalt auf dem Land ein Ende setzen konnte.
Im Nebenzimmer des zum Diner üppig mit Silber und Kerzen dekorierten Speisezimmers plauderte man noch ein wenig bei einem Aperitif und blätterte in den neuesten Journalen. Dort wurde über die Vorbereitungen zur Ständeversammlung berichtet und über die Tatsache, dass der König mit dem Vorschlag Neckers einverstanden war, ebenso viele Deputierte des Bürgerstandes wie Abgeordnete des Adels und Klerus zusammen zuzulassen. Auch Flugblätter hatte man gesammelt, welche die Teuerung des Brotes anklagten und dazu aufriefen, die Kornböden zu plündern. Andere Aufrufe gingen noch weiter, nämlich die Schlösser anzuzünden und allen Adeligen die Kehle durchzuschneiden.
D’Emprenvil schüttelte missbilligend den Kopf und zerknüllte das Papier. »Ach, dass mir die Hände gebunden sind!« Zornig warf er die Blätter in den brennenden Kamin.
De Montalembert blickte zerstreut auf, er schrieb auf einem kleinen Tischchen an einer erneuten Petition: Man möge ihm wenigstens erlauben, seine Geschäftsunterlagen, die sich mit Prozessen wichtiger Mandanten befassten, aus seinem Haus in Paris zu holen.
Amélie verwandte an diesem Abend besondere Mühe auf ihr Aussehen und trug zum ersten Mal ihr neues zartgelbes Taftkleid mit grob gemusterten Spitzen an den Ärmeln und einem engen, mit weißen Satinschleifen geschmückten Mieder, das ihr Dekolletee betonte. Das Kleid, geschnitten im neuen Stil, ohne die überweiten Reifröcke und Buffons, war hinten in Falten gelegt und umschmeichelte ihre zierliche Figur. Die Mutter hatte es ihr schon vor Wochen anfertigen lassen, aber bisher hatte sie sich geweigert, es zu tragen – es schien ihr zu weiblich, zu verspielt, zu aufgeputzt. Doch jetzt, bei einer neuerlichen Anprobe, da sie sich vor dem Spiegel drehte und wendete, war sie erstaunt, welche zauberhafte Schönheit ihr in dieser neuen Hülle entgegenblickte. Kokett zupfte sie sich ein paar weich fallende Locken in die Stirn. Sie wollte das Bild ihres zerrauften Auftritts in den Büschen, der sie als exaltierten Wildfang gebrandmarkt hatte, unbedingt rückgängig machen. Ihr Anblick stimmte sie ein wenig heiterer, aber trotzdem fühlte sie in ihrem Herzen eine abscheuliche Leere, und sie vermied es, nachzudenken und den Schmerz zuzulassen, der sie sogleich überfallen würde. Oh, wie dumm sie gewesen war. Aber sie würde es diesem Treulosen zeigen! Rachegedanken verschiedenster Art schössen ihr durch den Kopf; sie fühlte sich in wenigen Stunden erwachsener und reifer geworden, so als wäre sie in ein neues Stadium ihres Lebens eingetreten.
Als sie das Nebenzimmer des Speisesaals betrat, nahm sie das Glas Champagner, das man ihr reichte und das sie vor dem Essen bisher immer zurückgewiesen hatte, und stürzte es mit großen Schlucken wie eine Medizin tapfer hinunter. Verstohlen sah sie zu de Montalembert hinüber, der in sein Schriftstück vertieft weiterschrieb.
Als er plötzlich aufblickte, trafen sich ihre Augen, und er starrte sie verwundert an, als hätte er sie noch nie gesehen. Amélie senkte den Blick und fühlte das Blut in ihre Wangen schießen. Der große vergoldete Spiegel über dem Kamin, in dem sie sich voll neu erwachter Eitelkeit hin und wieder beim Vorbeigehen betrachtete, zeigte ihr das schmeichelhafte Porträt einer hübschen jungen Frau, das Bild einer Amélie, die sie selbst noch nie gesehen hatte. Staunend sah sie sich an. Sie war ja wirklich schön! Sie bewegte sich gelassen und schien heiter, obwohl ihr Herz in abgrundtiefer Traurigkeit schlug! Wie konnte das nur sein?
Im selben Augenblick sah sie ihre Schwester Isabelle herein kommen, gelöst und unbeschwert, ein leichtes Lächeln um die Lippen. Auch sie hatte sich verändert; ihre Wangen schienen rosiger als sonst, und ein inneres Strahlen ließ sie zart und ätherisch aussehen. Sie ist verliebt, durchfuhr es Amélie, und ihr Herz zog sich wie unter einem Stich zusammen, als sie daran dachte, mit welch glückseligem Ausdruck Isabelle auf der Schaukel durch die Luft geflogen war und wie Armand sie zärtlich aufgefangen und umfasst hatte! Sie empfand unsagbare Verachtung und tiefen Groll für Armand, der ihren Stolz gekränkt hatte. Sie würde Isabelle über sein treuloses Herz aufklären, sobald es möglich war. Lächelnd erwiderte sie erneut den bewundernden Blick de Montalemberts und nickte ihm verschwörerisch zu, als hätten sie ein Geheimnis miteinander.
An diesem Abend ging ihr all das, was die Mutter ihr bisher vergeblich beizubringen versucht hatte, wie von selbst von der Hand; sie achtete auf die Gäste, kümmerte sich um die Tischordnung, darum, ob jeder genügend zu trinken und zu essen hatte; sie plauderte gewandt und war ganz die wohl erzogene Tochter des Hauses.
Laura ihrerseits entging nicht, dass Amélie nicht wie sonst mit zerstreutem Blick am Tisch lümmelte, sondern auf ihre Haltung achtete, und sie wunderte sich, wie aus dem unfertigen Mädchen so unvermittelt ein liebenswertes, gewandtes Wesen geworden war. Doch wo blieb Patrick nur? Er war nicht zum Abendessen erschienen, und sie runzelte nervös die Stirn. Seit der letzten Eskapade machte sie sich ständig Sorgen um ihn. Sie beobachtete sein Verhalten stärker als vorher und war gegen seine Launen überempfindlich geworden. Auch schien er ihr in letzter Zeit verschlossener denn je, und er gab sich übertrieben männlich und überheblich. Seinem Vater ging er aus dem Wege, wo er nur konnte, und die beiden schienen wie Feuer und Wasser zu sein. Gerade wollte sie nachsehen, ob er sich auf seinem Zimmer vergraben hatte, doch auf dem Flur kamen ihr die beiden jungen Männer entgegen. Auguste, bleich, mit einem dicken Verband um den Kopf, von Patrick gestützt. Laura stieß einen leisen Schreckensschrei aus.
Doch Patrick bedeutete ihr, es sei nichts Schlimmes geschehen. »Mama, mach dir keine Sorgen. Auguste ist vom Pferd gestürzt, aber er hat sich nur leicht verletzt. Ich habe mich um ihn gekümmert. Jetzt sollte er sich ein wenig ausruhen.«
Laura schüttelte den Kopf. »Immer seid ihr so leichtsinnig, wenn ihr zusammen seid!« Dann wandte sie sich in erzwungener Höflichkeit an Auguste: »Hast du große Schmerzen, du Armer? Du solltest dich lieber ein wenig hinlegen, mit einer Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen!« Auguste bewegte vorsichtig den Kopf, wobei es unklar blieb, ob es eher ein Nicken oder ein Kopfschütteln war. »Kann ich irgendetwas für dich tun? Hast du Medikamente bekommen?«
»Ja, ja«, beruhigte sie Patrick, »er ist bestens versorgt. Wir waren bei Dr. Tourmon unten im Dorf. Er wird morgen noch einmal vorbeischauen. Wenn es Auguste besser geht, komme ich später herunter.«
Laura nickte und sah den beiden nach, die langsam, Auguste auf den Arm seines Freundes gestützt, die Treppe hinaufstiegen. Seit Graf de Platier mit Frau und Tochter vorübergehend in die Stadt übergesiedelt war, wo sie sich ein bescheidenes Domizil suchen wollten, während Arbeiter damit beschäftigt waren, wenigstens einen Teil des Wohnflügels wieder halbwegs bewohnbar zu machen, fühlte sich Laura für den Nachbarsohn mitverantwortlich. An Patrick war ihr indes aufgefallen, wie erwachsen er mit einem Mal schien, dass er Verantwortung übernahm und sein Leben selbst organisierte. Nachdenklich ging sie in den Salon zurück und sah zu ihrer Verwunderung, dass Amélie das Tablett mit dem Mokka in der Hand hielt und es mit liebenswürdigem Lächeln herumreichte. Das war das erste Mal, dass sie dies ohne ihre ausdrückliche Aufforderung tat und auch ganz ohne ihre sonstige mürrische Miene. Ihre Kinder schienen zu selbstständigen Wesen herangewachsen zu sein! Sie fing den Blick de Montalemberts auf, zu dem Amélie sich gerade graziös hinabbeugte, um seine Tasse zu füllen. Er schien etwas zu sagen, woraufhin Amélie laut auflachte, in einer Weise, die sie, wenn sie ihre Tochter nicht so gut kennen würde, als außerordentlich kokett bezeichnet hätte.
Doch Desmoulins, der ihr wie ein Schatten überallhin folgte, riss sie aus ihren Gedanken. »Ist irgendetwas geschehen?«, fragte er mit schmachtender Besorgnis und streifte wie unabsichtlich ihre Hand.
Laura zog sie schnell und unwillig zurück. »Nein, es ist nichts.« Mit diesen Worten ließ sie ihn stehen und ging schnell zu den anderen hinüber.
Desmoulins blickte ihr gekränkt nach. Wie immer behandelte man ihn wie einen ausgedienten Gegenstand, der überflüssig herumstand! Aber sie würden sich alle noch wundern, in Paris hatte er jetzt schon einen Namen! Auch de Montalembert schien ihn einfach zu übersehen, dieser eingebildete Aristokrat, der all das besaß, was er selbst nicht hatte. Ihm lächelte die Gastgeberin freundlich zu, ihm reichte sie persönlich das Konfekt, besorgt darüber, dass ihm ja nichts fehle. Ein dumpfes Gefühl der Eifersucht wallte in ihm auf.
Doch der junge Magistrat winkte abwesend, nickte der Gastgeberin nur zerstreut zu und konnte sich kaum auf ein Gespräch konzentrieren. Immer wieder ertappte er sich dabei, wie seine Blicke Amélie suchten, die er zum ersten Mal wirklich wahrzunehmen schien. Hatte sie vorher auch schon diesen sprühenden Glanz, dieses sanfte Strahlen in ihren dunklen Augen gehabt? Wie hübsch, ja geradezu bildschön sie sich in dem gelben, duftigen Kleid bewegte, das ihre alabasterfarbenen Schultern freigab, über die schwere, brünette Locken fielen.
Amélie spürte seine Bewunderung, und auch sie streifte ihn oft wie unabsichtlich mit ihren Blicken. Irgendwie hatte sie das Bedürfnis, de Montalembert noch einmal auf die blamable Situation am Nachmittag anzusprechen und ihm eine plausible Erklärung zu liefern, vor allem aber, sich noch einmal zu versichern, dass er auch ganz gewiss mit niemandem darüber reden würde. Als der Baron kurz den Raum verließ, fasste sie sich ein Herz und trat mit gespielt gelassener Miene auf den Grafen zu. »Ich.... ich muss Ihnen etwas sagen!« Unter seinem leicht amüsierten Blick, mit dem er sich ihr lächelnd zuwandte, stockte sie jedoch und wusste plötzlich nicht mehr, was es da überhaupt zu erklären gab.
De Montalembert, ganz höflicher Weltmann, kam ihr zuvor: »Sie sehen ganz bezaubernd aus, Mademoiselle Amélie! Sind Sie wirklich dieselbe Person wie heute Nachmittag?«
Der letzte Satz klang ein wenig spöttisch, und Amélie, die ungern eine Antwort schuldig blieb, spürte, wie sie über und über errötete. Sie drehte sich ärgerlich um. »Ihnen liegt wohl sehr viel an Äußerlichkeiten«, sagte sie über die Schulter zurück.
»Nein, warten Sie!«, rief er und ergriff ihre Hand, »so war das nicht gemeint, Sie sind in jeder Situation ein wunderschönes Mädchen. Nur heute Abend fällt es mir besonders auf. Aber Sie wollten mir doch etwas sagen...«
»Möchten Sie noch etwas Mokka?«, fragte Amélie nach einer verlegenen Pause und zog ihre Hand vorsichtig zurück, ehe sie ihm in der Pose der gewandten Tochter nachschenkte. »Es war nicht weiter wichtig... eine Banalität.« Als sie aufsah, spürte sie den zufriedenen, wenn auch etwas erstaunten Blick ihrer Mutter, die sie beobachtete.
Die zierlichen Tassen in der Hand, gingen sie zum Fenster und blickten in den nächtlichen Garten hinaus. »Es ist plötzlich kalt geworden«, sagte de Montalembert, »und ich fürchte, es wird heute noch einen gewaltigen Sturm, wenn nicht gar Hagelschlag geben.«
»Ja«, erwiderte Amélie und nippte an dem schwarzen Getränk, das sie im Grunde verabscheute, »der Winter hat zwei Seiten; die trostlose Natur und dunkle Einsamkeit ringsherum, aber auch eine von Kerzenlicht erhellte Stube, ein flammender Kamin, vor dem man träumen kann...« Sie brach ab, als hätte sie zu viel gesagt, von seinem Blick, der in ihren Augen eine Antwort suchte, verwirrt.
In einer impulsiven Geste hielt er ihre Hand fest und blickte sie offen an. »Wissen Sie, dass ich schon lange nicht mehr so herzlich und völlig ohne Grund gelacht habe wie heute Nachmittag? Sie waren wirklich ansteckend in Ihrer Unbeschwertheit.«
Statt ihm die Erklärung für ihr Verhalten zu liefern, wie sie ihr vorgeschwebt hatte, schwieg Amélie nur verlegen; sie errötete und versuchte, ihre Hand aus der seinen zu befreien. Doch der Graf achtete nicht darauf und fuhr nachdenklich fort: »Früher haben wir oft gelacht, ganz spontan, oft sogar bei ernsten, meistens aber bei nichtigen Anlässen, mein Bruder und ich. Wir brauchten uns nur anzusehen und schon kitzelte es uns in der Kehle. Je mehr wir es unterdrücken wollten, umso stärker wurde es, und schließlich hielten wir uns vor Lachen die Bäuche, während alle anderen uns verständnislos ansahen. Dieses losgelöste Gefühl, wenn das Lachen so aus einem heraussprudelt, den ganzen Körper schüttelt, ja, einen geradezu atemlos macht!« Er sah verträumt in die Ferne, immer noch ihre Hand haltend. »Das habe ich alles vergessen, es ist schon so lange her. Und heute habe ich durch Sie erfahren, dass ich noch immer so lachen kann – das war wie ein Ruf aus meinen Kindertagen.«
Amélie fühlte sich bei der Erinnerung an den vergangenen Nachmittag fast ein wenig unbehaglich, und sie wechselte geschickt das Thema. »Sie haben einen Bruder? Lebt er auch in Paris?«
De Montalemberts leuchtende Augen verschatteten sich plötzlich. »Nein, er ist schon lange tot. Es war ein Unfall, eine völlig dumme Geschichte. Wir hatten eine neue Kutsche, und er wollte unbedingt, dass eines seiner schwer zu bändigenden Pferde eingespannt wurde, ein wunderbarer Schimmel... Er ging dann durch, und dabei geriet mein Bruder so unglücklich unter die Räder... Aber das liegt schon so weit zurück... Und heute sah ich Julien vor mir, lachend, so wie ich ihn am meisten in Erinnerung habe.« Er stockte, seine Augen verloren sich in der Ferne.
Amélie, die ihm aufmerksam zugehört hatte, sah ihn mitfühlend an. Sie wusste nicht, dass er seinen Bruder schon so früh verloren hatte; denn seit er im Hause aus und ein ging, hatte er niemals von seinen Angehörigen gesprochen.
Unvermittelt ließ er ihre Hand los, und sie erschrak fast über die Stimme der Mutter, die sie rief: »Wo steckst du denn, mein Kind? Sei so nett und hol mir von oben meinen weißen Kaschmirschal mit den Fransen! Blanche ist wie immer zu dumm dazu, sie wird alles durcheinanderwühlen und ihn doch nicht finden. Es ist kühl geworden, findest du nicht?« Lauras fliederfarbenes Seidenkleid raschelte, als sie näher kam. Die rotblonden Korkenzieherlocken fielen ihr über das tiefe Dekolleté, und ihre dunklen Augen, die das italienische Blut einer alt eingesessenen gräflichen Familie verrieten, glühten auf und hefteten sich forschend und streng auf die Tochter.
Amélie hasste es, ausgerechnet in diesem Moment als Kind behandelt zu werden! Wieder einmal kam sie sich neben der zierlichen, reiferen Schönheit der Mutter plump und unbeholfen vor. Unwillig nahm sie das Tablett mit dem Mokka, de Montalemberts Blick meidend. Mama brachte es immer fertig, dort aufzutauchen, wo sie am wenigsten erwünscht war, immer wollte sie im Mittelpunkt stehen!
»Ich habe doch nicht etwa Ihre Unterhaltung unterbrochen?« Laura nahm den Platz ihrer Tochter ein und fächelte sich mit ihrem Fächer kokett Luft zu. »Denken Sie daran, mein lieber Richard, meine Tochter ist noch ein bisschen zu jung, als dass Sie ihr den Kopf verdrehen sollten!« Sie lachte leicht und glockenhell auf, als hätte sie nur eine witzige Bemerkung gemacht. Aber ihre Stimme hatte einen warnenden Unterton, der Richard nicht entgangen war.
Charmant erwiderte er: »Amélie ist wirklich eine bezaubernde Schönheit, die ganz der Mutter nachschlägt – aber Sie haben recht, sie ist fast noch ein Kind!«
»Dann sind wir uns ja einig«, erwiderte Laura. »Aber ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie irgendetwas in Paris zu besorgen haben. Monsieur Desmoulins reist morgen ab – und Sie wissen ja, er hat einen gewissen Einfluss, der nicht zu unterschätzen ist. Er könnte in seiner Zeitung beispielsweise gewisse Dinge veröffentlichen, ohne Namen zu nennen, versteht sich...«
Müde strich sich de Montalembert über die Stirn. »Vielleicht.... aber ich möchte nichts riskieren, ich habe schon zu viel gewagt.«
»Kommen Sie«, unterbrach ihn Laura und nahm seinen Arm, »ohne Ihren Namen preiszugeben, riskieren Sie doch nichts!«
Desmoulins stand mit seiner gewohnt finsteren Miene in einer Ecke und war nicht sehr erbaut von de Montalemberts Gesellschaft; der Graf verkörperte für ihn den Prototypen einer privilegierten Klasse, deren Vorrechte er in seinen Schriften geißelte.
Laura ließ die beiden Männer innerlich aufatmend allein. Seit sie Desmoulins gewährt hatte, was sie ihm so halbherzig und leichtsinnig in Aussicht gestellt hatte, befand sie sich in einer beinahe unerträglichen Lage. Wie ein Schatten verfolgte er sie auf Schritt und Tritt mit seinen schmachtenden Blicken und seiner leidenden Miene. Nur gut, dass er am folgenden Tag abreisen wollte.
Charles d’Emprenvil beobachtete den Journalisten mit einer Art zerstreuter Nonchalance; ihn kümmerten die Verehrer seiner Frau wenig, solange sie diskret waren und solange sie ihm seine Freiheiten ließ, die er sich in Paris nahm. Gewiss, er liebte Laura abgöttisch, sie stand über allen Frauen, die er kannte; vielleicht auch deswegen, weil sie ihm keine Szenen machte, ihn sein Leben leben ließ, ohne ihm Fesseln anzulegen. Als er wieder auf das vor ihm stehende Schachspiel sah, runzelte er die Stirn, denn der alte, schon etwas schwerhörige Graf d’Almeras hatte ihm gerade einen Läufer abgenommen, und er sah seine Partie in Gefahr.
Amélie, die ihrer Mutter den gewünschten Schal gebracht hatte, trat neben ihn, legte ihrem Vater die Arme um den Hals, und der Baron, erneut abgelenkt, strich ihr zärtlich übers Haar: »Mein kleines Mädchen«, murmelte er, »du siehst heute wunderschön aus in deinem gelben Kleid! Ich bin stolz auf dich. Richard hast du ja schon ganz in deinen Bann gezogen. Mir ist nicht entgangen, wie gut ihr euch unterhalten habt!«
»Ach, Papa«, wehrte Amélie verlegen ab und deutete auf das Spiel, »du willst doch nicht verlieren!« Und wirklich, die Hand des triumphierenden Grafen, der sich seines Sieges schon sicher schien, entwendete ihm gerade einen weiteren Bauern.
Aber d’Emprenvil ließ sich nicht beirren, er zog seinen Springer und bedrohte die Dame seines Mitspielers, ehe er fortfuhr: »Richard ist ein wirklicher Kamerad, ein wertvoller Mensch – du könntest dich auf ihn verlassen.« Verschwörerisch zwinkerte er seiner Tochter zu und verfolgte dann gespannt den nächsten Zug seines Gegners, mit dem dieser seine Dame in Sicherheit brachte.
Amélie blieb stumm und schaute auf das Brett, auf dem die Figuren starr und geheimnisvoll dastanden – doch schon im nächsten Moment konnte ein unvorhergesehener Zug den Gegner in die Enge treiben. Sie hasste es, wenn ihr Vater immer gleich Schlüsse aus einem Gespräch, einer Geste zog. Sie löste sich von dem Schachspiel und schlenderte weiter. Das Murmeln der gedämpften Stimmen, der Rauch würziger Zigarren, vermischt mit dem aromatischen Geruch des frisch aufgebrühten Kaffees und der regenfeuchten Kühle, die durch das offene Fenster drang, gaben Amélie ein unbestimmtes Gefühl der Zugehörigkeit zu den Menschen hier. Merkwürdigerweise hatte sie den ganzen Abend nicht mehr an Armand gedacht, obwohl sie sich eigentlich vor Kummer über ihn verzehren müsste.
Ihr Blick fiel auf Isabelle, welche die Mahnungen der Mutter überhört hatte. Sie stand abseits, wie ein heller Fleck in ihrem weißen Rüschenkleid, die Haare aufgelöst, an eine Nische des offenen Fensters gelehnt und sah aufmerksam in den Garten hinab. Amélie durchzuckte es, als hätte sie etwas Heißes berührt. Wem anders konnten ihre sehnsuchtsvollen Blicke gelten als diesem treulosen Burschen, der sich nicht ihretwegen, sondern wohl der Schwester willen im Garten herumtrieb, um auf ein Zeichen zu hoffen. Und sie selber war schon vergessen und abserviert. Wut wallte in ihr auf und ließ ihr Gesicht heiß aufglühen.
»Suchst du etwas dort draußen, Schwesterchen?«, fragte sie und trat zu Isabelle. »Es wird kühl, wir sollten das Fenster lieber schließen.«
»Ich...? Also nein, das finde ich überhaupt nicht. Die Luft ist so stickig hier – und ich bewundere den herrlichen Sternenhimmel. Siehst du die Milchstraße dort oben? Außerdem geht dich das überhaupt nichts an«, fügte sie hinzu, als sie Amélies spöttisches Lächeln sah.
»Die Sterne«, flüsterte Amélie, »seit wann siehst ausgerechnet du in die Sterne? Ich habe dich heute übrigens im Park auf der Schaukel gesehen – da schienst du dich für etwas ganz anderes zu interessieren!«
Isabelle lief puterrot an. »Verschwinde, Spionin, du brauchst nicht auf mich aufzupassen so wie früher! Ich verzichte auf deine aufdringliche Einmischung.« Wütend fiel sie in den kindlichen Ton zurück, der ihre früheren Auseinandersetzungen bestimmt hatte.
Amélie ihrerseits dachte gar nicht daran, sich diplomatisch zurückzuhalten. »Ich weiß alles«, brach es aus ihr heraus. »Ich habe euch heute am alten Spielplatz beobachtet, Armand und dich. Du wirst dich doch nicht mit so einem lächerlichen Gärtnerburschen abgeben? Wenn das Mama wüsste, sie wäre außer sich!«
»Lächerlich?« Die Schwester verzog höhnisch den Mund. »Und warum läufst du ihm dann hinterher? Du bist doch nur eifersüchtig!«
Amélie war, als hätte die kleine Schwester ihr einen Hieb in die Magengrube versetzt. Mit Erbitterung sah sie in Isabelles triumphierende Züge. Ihre Erregung unterdrückend versuchte sie, so kühl wie möglich zu erwidern: »Ich frage mich wirklich, was Mama sagen wird, wenn ich ihr die Geschichte erzähle!«
Mit gespielter Gleichgültigkeit ging sie davon, nicht ohne Isabelles halblaut gezischtes »Petzliese, erzähl es doch!«, zu hören. Sie fühlte, wie ihr wieder die dummen Tränen in die Augen schössen, und bemühte sich, ihre zuckenden Mundwinkel unter Kontrolle zu halten. Mit glühenden Wangen flüchtete sie in den dunklen Nebenraum der Bibliothek, in dem sich die Bücher häuften, die noch nicht eingeräumt, neu oder in Gebrauch waren. Ärgerlich schluckte sie, im Finstern umhertastend, die Tränen hinunter und war sich nicht ganz im Klaren, ob es der Kummer über Armands Untreue, die Eifersucht auf die Schwester oder aber die Angst war, die Eltern könnten etwas von ihren geheimen Treffen mit Armand erfahren, was sie so aufwühlte. Ah, welche Schande, welcher Lächerlichkeit war sie preisgegeben, wenn ihre Naivität ans Tageslicht käme! Was wusste eigentlich Isabelle darüber? Aufseufzend wollte sie gerade eine Kerze anzünden, als sie hinter sich die Türe hörte und furchtsam zusammenschrak. Doch gleich darauf ertönte die heitere Stimme de Montalemberts.
»Ach, hier haben Sie sich versteckt! Ich habe Sie schon vermisst und dachte, Sie seien schlafen gegangen.«
»Nicht schon wieder Sie«, stöhnte Amélie in gespielter Entrüstung. »Überall tauchen Sie plötzlich aus dem Nichts auf. Ich habe wirklich bald das Gefühl, von Ihnen verfolgt zu werden.«
»Keineswegs« – de Montalemberts Ton war eine Spur kühler geworden –, »ich suche eigentlich nur einen Band von Beaumarchais, den ich für Ihre Mutter holen wollte. Dass Sie hier sind, konnte ich nun wirklich nicht ahnen! Ich werde auch gleich wieder gehen, seien Sie unbesorgt.«
»So war es nicht gemeint«, erwiderte Amélie beschwichtigend und berührte ihn am Ärmel, als wollte sie ihn festhalten. »Ich... Sie wissen ja, ich bin heute etwas durcheinander. Hier ist übrigens Figaros Hochzeit, das Buch, das Sie suchen. Die Fortsetzung des guten Barbier ist sehr gefragt. Beaumarchais scheint wirklich in Mode zu sein, denn hier liegen gleich drei Ausgaben,«
Sie hielt ihm den Band hin, doch er sah Amélie nur verwundert und ein wenig forschend an. »Wollen Sie mir nicht sagen, was mit Ihnen los ist? Ich treffe Sie heute schon das zweite Mal mit Tränen in den Augen an. Was bedrückt Sie so? Vielleicht kann ich Ihnen helfen.« Er legte das Buch beiseite und strich ihr wie zufällig über das Haar.
Amélie wusste nicht, wie es geschah, doch plötzlich lag sie an seiner Brust und schluchzte wie ein Kind, das Schutz sucht, in sein gestärktes Spitzenjabot hinein. Im ersten Moment fühlte sich de Montalembert verwirrt und etwas hilflos, doch dann gehorchte er seinem Impuls und schlang die Arme um Amélie. Er murmelte ihr Trostworte ins Ohr, während er ihre Haare, Wangen, ihren Hals küsste – soweit es möglich war, denn sie hatte das Gesicht noch immer in seinem Jabot vergraben.
Amélie, deren Tränen der Wut rasch versiegten, hob den Kopf und sah ihn erstaunt an. In seinen graugrünen Augen lag eine Mischung aus Zärtlichkeit und einem gefährlichen Flimmern, das ihr einen Schauer über den Rücken jagte. Noch bevor sie sich über ihre zwiespältigen Gefühle klar werden konnte, hatte sich de Montalembert über sie gebeugt und begann sanft, doch dann immer leidenschaftlicher, sie auf den Mund zu küssen. Verwirrt spürte sie, dass sie, ohne es zu wollen, seine Küsse erwiderte, während eine seltsame Schwäche, die sie bisher nur in Armands Armen gespürt hatte, von ihr Besitz ergriff. Einem Instinkt gehorchend riss sie sich plötzlich mit fliegendem Atem und klopfendem Puls los. Irgendetwas war anders, weniger spielerisch als mit Armand, wo sie stets Herr der Situation gewesen war. Wortlos löste sie sich aus seiner Umarmung, strich sich die Haare aus der Stirn und versuchte, ihre Fassung wiederzugewinnen.
De Montalembert machte ein paar Schritte zur Tür, ordnete den Kragen seiner Samtjacke und das weiße Spitzenjabot, während er Amélie mit einem kleinen, merkwürdigen Lächeln in den Mundwinkeln ansah, ohne sich jedoch zu entschuldigen, wie sie es als selbstverständlich erwartet hatte.
»Was fällt Ihnen eigentlich ein«, brach sie schließlich mit zitternden Lippen das Schweigen, »Sie nutzen meinen Kummer und mein Vertrauen auf eine solch niederträchtige Weise aus! Sie spionieren hinter mir her, Sie...« Amélie suchte nach Worten, die sein Verhalten in der schärfsten Weise verurteilen sollten. Doch de Montalemberts Ruhe und sein Lächeln verwirrten sie.
Er zuckte die Schultern. »Wenn ein so bezauberndes Mädchen, das einen geheimnisvollen Kummer im Herzen trägt, sich in meine Arme stürzt, was sollte ich Ihrer Meinung nach tun?« Er ging auf sie zu, und seine Augen blickten sie in tiefem, treuherzig schimmerndem Grün wie zwei unergründliche Seen so arglos an, dass sie einen Moment nicht mehr wusste, was sie von ihm denken sollte.
»Es ist besser, wenn Sie jetzt gehen«, stotterte sie und verwünschte die Röte, die ihr wieder in die Wangen stieg, »lassen Sie mich in Zukunft einfach in Ruhe, anstatt immer hinter mir herzulaufen.«
»Hinter Ihnen herlaufen?« Seine Stimme klang wieder kühl und gelassen. »Mein liebes Kind, ich habe anderes zu tun als das. Ich kann schließlich nichts dafür, dass ich Sie wie ein Häufchen Elend ausgerechnet dort antreffe, wo ich etwas suchte. Geben Sie mir den Beaumarchais, und vergessen Sie das kleine Vorkommnis.«
Wütend packte Amélie den Band und warf ihn ihm mit einer plötzlichen, zornigen Aufwallung vor die Füße. De Montalembert packte ihr Handgelenk so fest, dass sie sich auf die Lippen beißen musste, um nicht vor Schmerz aufzuschreien. »Sie verwöhnte kleine Wildkatze, heben Sie das auf, oder ich werde Sie dazu zwingen!«, herrschte er sie an.
Verblüfft wie ein gescholtenes Kind bückte sich Amélie und legte rasch das Buch auf den Tisch.
De Montalembert ließ ihre Hand los und holte tief Luft; er fühlte, dass er zu weit gegangen war, und sagte leise: »Entschuldigen Sie, das war jetzt äußerst grob von mir. Dabei wollte ich so gerne Ihr Freund sein, aber diese Bezeichnung kann ich jetzt wohl nicht mehr in Anspruch nehmen.« Er senkte den Kopf und fügte hinzu: »Verzeihen Sie mir, bitte...«
Amélie lief zur Tür und knallte sie mit einem hässlichen Geräusch hinter sich zu.
Der Graf folgte ihr und rief ihr bedauernd nach: »Nun habe ich in Ihren Augen wohl endgültig verspielt!«
Amélie, von dem weichen Ton seiner Stimme trotz allem gerührt, drehte sich um und maß ihn mit einem zornigen Blick: »Ich dachte auch, dass Sie ein Freund sind, aber jetzt halte ich Sie eher für einen ungehobelten Grobian!« Mit diesen Worten stürmte sie, über die Schleppe ihres Kleides stolpernd, die Treppe hinauf.
Nachdem sie wirre Träume geplagt hatten, war Amélie schon im Morgengrauen aufgestanden, um durch den kühlen, tauglitzernden, nach Moos und Herbstfeuchte riechenden duftenden Park zu laufen. Als sie halb erfroren ins Haus zurückschlich, kam Mademoiselle Dernier ihr schon zu dieser frühen Stunde mit Christoph auf dem Arm entgegen. Sie wiegte ihn sacht hin und her und versuchte, ihn mit leisen Trostworten zu beschwichtigen. Der Kleine quengelte und war ganz rot im Gesicht; seine Wangen glühten in unnatürlicher Hitze, und seine fiebrig glänzenden Augen flackerten unruhig.
»Ich weiß nicht, was mit ihm los ist.« Vor lauter Sorge um ihren kleinen Schützling wunderte sie sich gar nicht, dass Amélie schon auf war. »Sophie hat mich geholt, er war in der Nacht so unruhig, und ich glaube, er hat Fieber. Vielleicht sollten wir einen Arzt rufen! Wahrscheinlich ist es nur eine kleine Unpässlichkeit, er zahnt ja auch. Ich wage nicht, Madame wegen einer Bagatelle so früh und vielleicht auch völlig unnötig zu wecken.«
Amélie küsste den Kleinen zärtlich und sprang die Treppen hinauf, obwohl sie wusste, dass die Mutter in den frühen Morgenstunden nicht gern gestört wurde. Als sie auf Zehenspitzen das Zimmer mit den elfenbeinfarbenen Seidenvorhängen betrat, schlief die Mutter noch fest in ihren Kissen. Leise zupfte Amélie an einem Zipfel der Bettdecke und flüsterte: »Mama, Christoph ist krank, Mademoiselle Dernier meint, er brauche vielleicht einen Arzt.«
Laura starrte Amélie verschlafen an. »Was sagst du da? Christoph krank? Was fehlt ihm denn, um Himmels willen?« Damit griff sie nach ihrem grünseidenen Morgenmantel und zog sich eilig die Schleifen aus den Haaren. »Schick mir Sophie und sag Mademoiselle Dernier, sie soll den Kleinen sofort zu mir bringen.« Mit den Füßen tastete sie nach ihren Pantoffeln. Die langen, offenen Haare fielen über das rüschenbesetzte Hemd, in dem sie, ungeschminkt und zierlich, im diffusen Licht wie ein kleines Mädchen wirkte.
Amélie zog sich zurück und suchte ihr Zimmer auf, um sich anzukleiden. Wieder kam ihr die Szene des vorangegangenen Abends in den Sinn und das seltsame Flimmern in de Montalemberts Augen, bevor er sie küsste! Ihr Herz klopfte wild bei der Erinnerung. Wie sollte sie ihm heute entgegentreten? Er würde sich etwas darauf einbilden, aber sie würde so tun, als wäre er Luft. Forschend musterte sie ihr Spiegelbild. Wie sah sie nur aus? Sorgfältig kämmte sie sich ihr schweres, dichtes Haar aus der Stirn, steckte es so streng wie möglich auf und versuchte, eine sehr blasierte Miene aufzusetzen.
Doch all ihre Mühe war umsonst gewesen: Ihr Vater war mit seinem jungen Freund schon bei Tagesanbruch aufgebrochen, um ein neues Pferd, einen temperamentvollen Trakehnerschimmel, den der Baron vor Kurzem gekauft hatte, an die Umgebung zu gewöhnen.
Mademoiselle Dernier und Laura mühten sich gemeinsam um den weinerlichen Christoph, der jede Nahrung ablehnte, nicht im Bett und nicht auf dem Schoß bleiben wollte, der ein paar Schritte lief, die Ärmchen um seine Mama schlang, sich dann aber krähend wieder losmachte und bei seiner Erzieherin Schutz suchte. Man hatte nach dem Doktor geschickt, der am Vormittag vorbeikommen wollte. Da die Temperatur aber nur leicht erhöht war, schien kein Grund zu größerer Besorgnis zu bestehen. Trotz allem waren die beiden Frauen beunruhigt über das Verhalten des kleinen Kerls.
Patrick, der meist gar nicht frühstückte, saß mit dem etwas wehleidigen Auguste, dessen Nase mit einem Pflaster bedeckt war, das eine Auge blau angelaufen, schon am Tisch und schien glänzender Laune zu sein. Seine grüblerische Reserviertheit war von ihm abgefallen wie ein gewechselter Rock. Es lag wohl daran, dass sein Entschluss feststand: Er würde in die Armee eintreten – auch wenn es seiner Mutter das Herz bräche, die ihn unbedingt als Magistrat und Gutsherrn sehen wollte. Sein Vater, seiner ständigen Rebellion , leid, hatte endlich zugestimmt, ihm eine Obristenstelle in Versailles zu kaufen.
Patrick aß mit großem Appetit und bemühte sich, höflich mit Desmoulins zu plaudern, dem er, trotz seiner spektakulären Rettung aus dem Gefängnis der Conciergerie, keine rechte Sympathie entgegenzubringen vermochte.
Doch er musste seine Gegenwart wohl oder übel in Kauf nehmen, denn es war ihm erlaubt worden, in seiner Begleitung und Obhut nach Versailles zu fahren und sich bei der Nationalgarde zu melden.
Als Amélie eintrat, erblasste der arme Auguste, seinen Zustand verwünschend. Am liebsten hätte er sich in diesem Moment unter dem Tisch verkrochen. Das junge Mädchen in ihrem einfachen, geblümten Musselinkleid erschien ihm einfach feenhaft schön. Er stotterte auf ihren verwunderten Blick etwas von seinem Reitunfall, und Amélie strich ihm zu seiner Überraschung mit einer versöhnlichen Geste mitleidig über den Arm.
Auguste fühlte sein Herz stärker schlagen, doch noch bevor er etwas sagen konnte, hatte sich das Mädchen schon wieder von ihm abgewandt und der Gouvernante den kleinen Bruder abgenommen.
Isabelle saß in Gedanken versunken am Tisch und sah in eine unbestimmte Ferne, während sie unablässig und mit großer Sorgfalt in ihrem Milchkaffee rührte. Amélie beobachtete die Schwester unauffällig, und es entging ihr nicht, dass die Kleine, sonst farblos und matt, wie von einem inneren Licht glühte.
Mit rosigen Wangen und glänzenden Augen, die Haare offen und lockig über die Schulter fallend, schien sie völlig verändert. Ihre sonst so schlaffe Haltung war gestrafft wie die einer Pflanze, der endlich die nötige Aufmerksamkeit zuteil wird.
Doch außer Amélie schien ihre Veränderung niemandem aufzufallen. Sie warf der jüngeren Schwester einen prüfenden Blick zu, als sich Isabelle, nach einem hastig hinuntergeschlungenen Stück Brot, erhob und um die Erlaubnis bat, dem Vater und de Montalembert bei ihrer Rückkehr ein wenig entgegenzugehen.
Laura blickte zerstreut auf. »Bitte, mein Liebling, entferne dich nicht zu weit oder nimm dir jemanden zur Begleitung mit. Du weißt doch, die herumstreunenden Bettler – man kann nie wissen, was ihnen einfällt. Sag doch gleich Armand oder Louis Bescheid.«
Amélie zuckte zusammen – ausgerechnet Armand! Das wollte dieses Biest doch nur erreichen. »Ich kann ja auch mitgehen, dann ist Isabelle nicht so allein«, sagte sie in geheuchelter Fürsorge.
Isabelle wurde blass und warf ihr einen wütenden Blick zu, aber Amélie zuckte nur die Schultern und sagte so gleichmütig wie möglich: »Vielleicht werde ich aber auch im Park bleiben.«
Sie stand auf und schlenderte scheinbar gelassen davon, während sich in ihrem Innern eine dumpfe, unbekannte Wehmut ausbreitete.