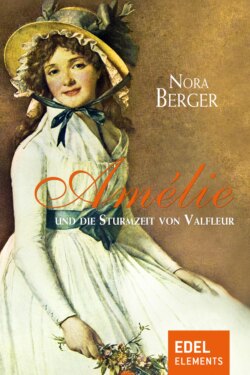Читать книгу Amélie und die Sturmzeit von Valfleur - Nora Berger - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Rede mit Folgen
ОглавлениеDie Kutsche holperte durch den strömenden Regen über die aufgeweichten Wege, und die Pferde kämpften gegen den in Böen heranfegenden Wind. Das Gewitter hatte nachgelassen, nur hin und wieder zuckten Blitze in der Ferne auf. Die Feuchtigkeit tat dem Boden gut, denn die monatelange Trockenheit ließ erneut eine Missernte befürchten. Baron d’Emprenvil lehnte sich auf dem unbequemen Sitz der Kutsche zurück. Unterwegs waren ihm trotz des schlechten Wetters Gruppen von Bauern begegnet, Menschen, die ihre Heimat verlassen hatten und hofften, in der Hauptstadt oder an einem anderen Ort ihr Auskommen zu finden.
Ja, die wirtschaftliche Not war groß, und ganz besonders bekam sie die Landbevölkerung zu spüren, denn ihr fehlte es am Notwendigsten. Aber auch um den kleinen Landadel stand es nicht zum Besten. Und jetzt noch das Edikt über die Stempel- und Bodensteuer, das der König gegen den Willen des Parlaments durchsetzen wollte! D’Emprenvil beugte sich wieder vor und blickte ungeduldig aus dem Fenster des Wagens, als wenn er damit die Fahrt beschleunigen könnte. Seine Gedanken kreisten um die Rede, die er am nächsten Tag im Parlament zu halten gedachte; er suchte nach eindringlicheren Formulierungen und murmelte ganze Passagen laut vor sich hin. Natürlich waren die Zeiten schlecht, und der Staat war über alle Maßen verschuldet. Doch auch de Brienne, der neu einberufene Finanzminister, hatte kein Rezept, um die Misere zu beheben. Es war unmöglich, sich gegen die Privilegien des Adels und der Kirche durchzusetzen, die sich einmütig weigerten, Steuern zu entrichten.
D’Emprenvil ballte die Fäuste wie gegen einen unsichtbaren Gegner. Das Edikt würde wieder die Falschen treffen. Warum war der König so schwach? Er lieh sein Ohr den Einflüsterungen der alten Geschlechter wie der Lamballe, Lauzun und Montmorency, die auf ihren Rechten beharrten. Doch es war den Bürgern und Bauern einfach nicht länger zuzumuten, dass sie die ins Unermessliche wachsende Finanzlast allein trugen. Sie spürten die Ungerechtigkeit am eigenen Leibe, und ihr Groll richtete sich vor allem gegen die Königin, die verhasste Österreicherin. Mit ihrem glanzvollen Lebensstil und den üppigen Festen war sie für die Bauern und kleinen Bürger der Inbegriff von sinnloser Verschwendung.
Die Vororte von Paris schälten sich trist und trüb wie Schatten aus der Dämmerung. Der Baron ordnete im Zwielicht des Abends seine Papiere. Es war beinahe acht Uhr, als er die Porte de Clichy durchfuhr, und er freute sich auf die lebendige, pulsierende Stadt. Das Landleben langweilte ihn, selten war er auf seinem Gut; sein Herz gehörte der Politik, und er hatte den Ehrgeiz, eine bedeutende Rolle darin zu spielen und die Geschicke des Landes zu beeinflussen.
Am Abend war in der Hauptstadt von der allgemeinen Krise wenig zu spüren. Die Straßen waren belebt von eleganten Menschen, eilig dahinrollenden Kutschen und Läden, in denen die Schätze des Luxus ausgebreitet lagen. In unzähligen Theatern der Stadt fanden Aufführungen statt, die Cafés waren erleuchtet, und aus den Fenstern der Wohnungen schimmerte Kerzenglanz.
Der Kutscher bog in eine breite, dunklere und ruhige Straße und hielt vor einem kleinen, schmalen Palais. Es war die Stadtwohnung der d’Emprenvils in der Rue Dauphine, die Laura so gut wie niemals bewohnte. Sie hasste die Ansammlung von Menschen in der Stadt, den Schmutz und die schlechte Luft, und der Baron hatte sie in den letzten Jahren, da die Kinder heranwuchsen, nicht mehr dazu bewegen können, das Pflaster von Paris zu betreten. D’Emprenvil musterte von der Kutsche aus die Fassade des vertrauten Gebäudes, die Marmorfiguren, die den Balkon mit den schmiedeeisernen Ranken trugen, und das aufwendig geschnitzte Portal, durch das man in den kleinen Innenhof fuhr.
Jean, sein vom Alter gebeugter, langjähriger Diener, erwartete ihn schon in freudiger Aufregung. Er hatte alles vorbereitet: Ein wärmendes Feuer flackerte anheimelnd im Kamin, denn nach dem Gewitter war die Luft abgekühlt. Eine kleine kalte Mahlzeit war auf dem Tablett neben dem Lieblingssessel des Barons angerichtet – ein Stückchen zarter Fasan, seine Lieblingspastete mit Pilzen und Kräutern, umrahmt von eingelegtem Gemüse in Aspik, sowie eine Flasche alter Bordeaux.
D’Emprenvil aß mechanisch, nicht recht bei der Sache, den Blick zerstreut auf die Ahnenporträts geheftet, die rechts und links vom Kamin hingen und seinen Vater zeigten, einen beleibten Lebemann mit weiß gepuderter, gelockter Perücke und beringten Händen im Stil Ludwigs des XIV., sowie seine jugendliche Mutter, schmal und ernst unter ihren natürlichen, rabenschwarzen Locken, mit dunklen Augen und alabasterfarbenem Teint. Er hatte sie kaum gekannt; sie starb schon in jungen Jahren an der Schwindsucht, und der Vater, ein lebenslustiger Hofmann, wie er im Buche stand, erlag eines Tages sehr plötzlich einer Magenverstimmung; man munkelte, eine seiner Mätressen habe sich mit einer Dosis Gift an ihm gerächt.
Das Klopfen Jeans unterbrach seine Gedanken. »Graf de Montalembert möchte Sie sprechen, er sagt, es sei dringend.«
Der Baron unterdrückte ein Gähnen und blickte auf die verschnörkelte Uhr auf der Konsole. »Um diese Zeit?« Er war müde und wollte am nächsten Tag ausgeschlafen sein. Jean zog die Brauen hoch, schlurfte zwei Schritte zurück und wartete. »Nun gut, lassen Sie ihn hereinkommen.«
Der Graf, ein blonder Mann, etwa Ende zwanzig, trat ein. Seine Wangen waren gerötet, und die graugrünen Augen blitzten, als käme er gerade von einem aufregenden Duell oder einem Rendezvous. »Entschuldigen Sie, Charles, dass ich Sie sogleich nach Ihrem Eintreffen in Paris überfalle, aber ich wollte heute Abend, noch vor der Versammlung, unbedingt mit Ihnen sprechen. Ganz Paris ist in Aufruhr! Neue Steuern! Diesmal soll es die Grundbesitzer treffen und auch die Bürger! Statt die Höflinge zu beschränken, geht es jetzt uns an den Kragen! Die Ratifizierung einer Stempelsteuer ist geplant. Ganz zu schweigen von der Grundsteuer, mit der man uns jetzt das Geld aus den Taschen ziehen will! Wir müssen uns vorsehen, um unsere Rechte zu wahren!« Er machte eine nachdenkliche Pause, dann fügte er hinzu: »Doch der König wird sich durchsetzen, befürchte ich.«
Der Baron lächelte. »Mein lieber de Montalembert«, beschwichtigte er seinen Freund und bot ihm einen Platz vor dem Kamin an, »es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Vielleicht gelingt es uns, das zu verhindern. Die Misswirtschaft des Staates existiert ja nicht erst seit gestern. Und sicher werden wir es nicht schaffen, von heute auf morgen Entscheidungen oder Änderungen zu erzwingen. Aber wir werden es versuchen – und dabei nicht lockerlassen.« Der Baron prostete seinem Gast zu, nachdem er ihm ebenfalls ein Glas gefüllt hatte, und betrachtete die Farbe des Weins. »Probieren Sie diesen Bordeaux. Das ist ein 1781er – ein besonders guter Jahrgang.«
De Montalembert nahm einen tiefen Schluck und atmete dann hörbar aus. »Natürlich haben Sie recht. Man darf nichts übereilen. Aber ich bin, um die Wahrheit zu sagen, ein wenig aufgeregt. Es ist meine erste Sitzung als Rat, seit ich von meinem Vater das Amt geerbt habe, und ich möchte nichts falsch machen. Ich dachte...«, er stockte und betrachtete seine mit Brillanten besetzte Gürtelschnalle, »...dass Sie mir vielleicht ein paar Regeln... ich meine... den Ablauf betreffend...«
D’Emprenvil lachte amüsiert. »Das dachte ich mir! Aber seien Sie ganz ruhig. Wir werden zusammen zur Versammlung gehen. Und im Übrigen haben Sie als Neuling noch nicht viel zu sagen; nur richtig abstimmen, das müssen Sie.«
»Dabei hätte ich so viel zu sagen!« De Montalembert sprang erregt von seinem Sessel auf. »Es ist unglaublich, dass die Prüfung der Finanz-, Polizei- und der Steuergesetze nur wieder der kleinen Gruppe des Hofadels überlassen bleibt, die selber nur an ihre eigene Tasche denkt.«
D’Emprenvil erhob sein Glas. »Wenn das wirklich Ihr Ernst ist, mein Lieber, dann werden wir morgen gemeinsam darum kämpfen, dass neue Anordnungen nicht so einfach durchgesetzt werden können. Wir werden es wagen, dem König die Augen zu öffnen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel, einen Bericht, den ich erarbeitet habe, über eine geheime Akte, deren Inhalt der König hinter unserem Rücken durchsetzen will... Und den Bericht werde ich morgen vorlegen.«
Der Graf erhob ebenfalls sein Glas und rief aus: »Es muss sich etwas ändern im Lande! Auf das Wohl Frankreichs! Gott möge dem König die Augen öffnen und ihm die richtige Einsicht schenken.«
Die Gläser klirrten aneinander, und der alte Jean, der im Nebenzimmer immer wieder einnickte, während er darauf wartete, den späten Gast hinauszubegleiten, schüttelte den Kopf, wenn er wieder ein paar Gesprächsfetzen aufschnappte. Der König und Schulden, das war doch schon immer so gewesen. Kriege, Mätressen, all das verschlang Unsummen... Was konnte der kleine Mann dagegen machen? Die Großen fraßen die Kleinen, und man schlug sich so durchs Leben. Revolten kosteten den Kopf, das wusste doch jeder. Er verstand nichts und wollte nichts verstehen von der gärenden Unruhe, die über dem Land lag.
Der Morgen des 3. September 1787 brachte eine frische Brise, klaren, blauen Himmel, Vogelgezwitscher und die Strahlen einer milden Spätsommersonne. Die Straßenkehrer waren noch am Werk, um mit müden Bewegungen die Überreste der Nacht beiseitezuschaffen, als der Baron nach einer recht kurzen Nachtruhe frisch und ausgeruht den sonnig durchfluteten Raum betrat, in dem er sein Frühstück einzunehmen pflegte. Die zierlichen Rokokomöbel und die mit südlichen Landschaften in Pastelltönen bemalten Wände vermittelten den Eindruck lichtvoller Heiterkeit.
Mit den Gedanken bei der bevorstehenden Rede, zog er anschließend die glockigen weißen Spitzenmanschetten ungeduldig durch die Ärmel der dunklen Jacke, die Jean ihm bereithielt. Zusammen mit den cremefarbenen Seidenstrümpfen zu den schwarzen, samtenen Kniehosen und den Schuhen mit den kostbaren Schließen vermittelte diese Kleidung den Eindruck von Schlichtheit und feierlicher Eleganz. Nur die Weste, aufwendig in Königsblau und zartem Gelb bestickt und mit goldenen Knöpfen, verriet die Würde seines Standes. Die weiß gepuderte Perücke mit herabhängendem Zopf und gerollten Seitenpartien, die der Baron nur ungern überstülpte, verlieh ihm darüber hinaus eine uniforme Anonymität. Behutsam legte ihm Jean den schwarzen Satinumhang über die Schultern und blickte seinem Herrn ehrfürchtig nach, der mit leichten Schritten das Haus verließ und in die Kutsche mit dem Hauswappen stieg, einem Löwen auf silbernem und grünem Grund mit zwei gekreuzten Säbeln. Die beiden Rappen zogen an, und die Räder setzten sich in Bewegung, während d’Emprenvils Gedanken bereits zu seinem Platz im Südsaal des Parlaments vorauseilten.
Gleichmäßig klapperten die Pferdehufe über das holprige Kopfsteinpflaster. Trotz der frühen Morgenstunde sah man viele Leute, und in jedem Winkel lagen abgerissene Gestalten, welche die Nacht, in Lumpen gehüllt, auf der Straße verbracht hatten. Der Baron, der das Fenster geöffnet hatte, blickte abwesend in die Gesichter von bleichen, abgezehrten Menschen, die stoppelbärtig die Köpfe hoben, als die Kutsche vorbeirollte. Vor den Bäckerläden hatten sich schon vor dem Öffnen lange Schlangen gebildet. Das Gerücht hatte sich verbreitet, dass man in Paris das Korn zurückhalte, um Reserven zu schaffen. Das fahle, ernüchternde Morgengesicht der Stadt bot ganz im Gegensatz zur vergnügungssüchtigen Betriebsamkeit am Vorabend ein Bild des Elends. So wie der Abend die Stunde der Reichen gewesen war, so blickte der Morgen mit den hohlen Augen des Hungers und der Armut der kleinen Leute um sich. Die Ratten huschten über Bürgersteige und Quais, auf der Suche nach Abfällen, die sie mit den Menschen teilen mussten, die der Morgen wie Strandgut an Land gespült hatte.
Die Kutsche rollte am Ufer der Seine entlang und ließ die Tuilerien und das Palais Royal, dessen Geschäfte noch nicht geöffnet hatten, hinter sich. Als sie die Pont de Change passiert hatten, tauchte auch schon das Palais de Justice vor ihnen auf. D’Emprenvil stieg aus und eilte schnellen Schrittes die Steinstufen des mächtigen Gebäudes empor, wo sich, von zwei Bediensteten in Livree flankiert, das große Tor für ihn öffnete. Der riesige Sitzungssaal mit seinen reich verzierten und verschwenderisch bemalten Wänden, den üppigen Säulen und der mit Bogen und Rosetten verzierten Decke war schon halb gefüllt. D’Emprenvil nickte dahin und dorthin, schüttelte Hände und sah sich nach seinem jungen Freund de Montalembert um, den er schließlich bleich und ernst in einer Ecke sitzen sah. Er winkte ihm einen kurzen Gruß zu und nahm dann selbst auf einer der Holzbänke Platz, die sich im Rund nach oben reihten. Die Stimmung war spürbar gespannt. Überall standen Grüppchen von Abgeordneten zusammen und diskutierten eifrig. Endlich ertönte weithin hörbar das dumpfe Klopfen des Holzes auf dem Tisch, und der Präsident eröffnete die Sitzung des Parlaments.
Erwartungsgemäß rief die Vorlage des Edikts über die Steuerreform, obwohl allen Abgeordneten bekannt und vom König als solches wie üblich angekündigt, Abneigung und Widerwillen hervor. Zwar schwankten einige Abgeordnete noch vor dem Akt des Ungehorsams und andere beschlossen, ihre persönliche Meinung dem Willen des Königs unterzuordnen, doch in dem Augenblick, als d’Emprenvil mit der Gabe der Beredsamkeit, seinem schauspielerischen Talent und dem Feuer der Überzeugung seine Rede begann, zog er alle Unschlüssigen auf seine Seite. Er sprach von dem geheimen Schlag gegen das Parlament, den der König plane, und legte das Dekret vor, das er heimlich an sich gebracht hatte.
De Montalembert lauschte, hingerissen von der rhetorischen Gabe des Älteren. Genauso war es! Die Zusammenhänge zeichneten sich klar und deutlich vor seinem geistigen Auge ab. Wenn man dem König jetzt nachgab, würde nur ein Loch gestopft werden, das viele andere aufreißen würde. Es galt, das Übel an der Wurzel zu packen! Zuerst und vor allem musste der Hof seine immensen Ausgaben beschränken und eine Besteuerung der Hofschranzen vornehmen. Wenn jetzt all die kleinen Besitzenden zahlen sollten, würde nach den Bauern auch über sie die Katastrophe hereinbrechen, der Handel würde erliegen, und die aufstrebende Industrie würde im Keim erstickt werden. Und was den kleinen Landadel betraf, so war er schon jetzt verarmt. Die Räte verloren ihre seit uralten Zeiten erkauften Sitze, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Der Kern des Staates war bedroht.
»Ich fordere die Einberufung der Generalstände!« Tosender Applaus brandete auf, als d’Emprenvil mit diesen Worten seine Rede beendete.
»Die Generalstände, die Generalstände!«, wurde gerufen. Auch de Montalembert fiel begeistert in die Bravorufe ein, die selbst kühle und sachliche Parlamentsmitglieder spendeten. Dann war es so weit, das Edikt war beinahe einstimmig abgelehnt worden, gegen das Veto des Königs – ein Meilenstein in der Geschichte, ein Sieg der Vernunft gegen die Macht. Graf de Larasalle, ein dem König nahe stehender und sehr ergebener Mann, Vermittler zwischen ihm und dem Parlament, saß mit verdüstertem Gesicht auf seinem Platz, von ein paar Hofleuten umgeben, die nicht wagten, eine eigene Meinung zu äußern. Aber niemand beachtete seine Einwände, und selbst als er einwarf: »Der König wird ein ungehorsames Parlament verbannen...«, goss er nur Öl ins Feuer, erhitzten sich die Gemüter nur noch mehr. Es wurde heftig diskutiert, alles schrie durcheinander, und bald glich der Saal einem Bienenschwarm. Wie war es zu diesem tumultartigen Protest gekommen, der wie ein Feuer entfacht war und nun wild loderte?
D’Emprenvil fühlte sich hochgestimmt, erleichtert und voller Zuversicht. Selbst der König konnte gegen die Entscheidungsgewalt von Vertretern des Volkes wenig ausrichten. Man hatte einen wichtigen Schritt gewagt, und man würde weitere folgen lassen. Es war nun an den Generalständen, die tagen sollten, um eine Entscheidung herbeizuführen. De Montalembert sah strahlend zu ihm hinüber und winkte ihm mit dem Siegeszeichen zu.