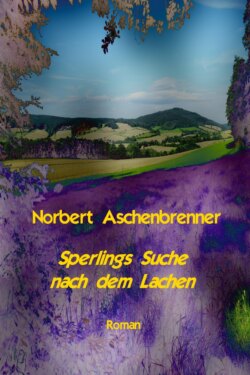Читать книгу Sperlings Suche nach dem Lachen - Norbert Aschenbrenner - Страница 7
5
ОглавлениеWir waren zehn Jahre alt, als wir in dieselbe Klasse des Robert-Schumann-Gymnasiums aufgenommen wurden. Vom ersten Tag an schlüpfte Arno Sperling wie selbstverständlich in die Rolle des Chefs. Durch den selbstbewussten, oft flapsigen Ton, den er im Umgang mit Autoritäten wie Hausmeistern, Sekretariatsdamen und unantastbaren Gottheiten im Range von Oberstudienräten anschlug, gewann er rasch unser Vertrauen. Es soll unter den Mädchen unserer Klasse einige gegeben haben, die sich bereits in dieser Anfangszeit unsterblich in ihn verliebt haben.
Während er also geradewegs zum unangefochtenen Sprecher aufstieg, brauchte ich mehrere Monate, um mich in der neuen Umgebung einzuleben. Ich gehörte zu den Unauffälligen, die nie ihre Hausarbeiten vergaßen. Selbst während des Biologie- und Geographieunterrichts bei Hubertus Kratschmer, einem ebenso schrulligen wie strengen Kauz mit buschiger Einsteinmähne, war ich bis zum Ende der Stunden aufmerksam und hatte stets die richtigen Antworten parat.
Ich erinnere mich nicht, jemals von Kratschmer abgeurteilt worden zu sein. Für Arno und seine wackersten Mitstreiter aber gehörten dessen Strafexerzitien zum Ritual jeder Stunde. Je nach Schwere ihrer Entgleisung mussten sie fünf oder zehn Minuten mit gesenkten Häuptern in einer Ecke des Klassenzimmers stehen.
Arno Sperling kam aus Thalbach, einem damals neunhundert Seelen zählenden Ort, der neun Kilometer südöstlich von der Kreisstadt Schönfeld entfernt liegt. Er war einer der zahlreichen Pendler, die mit der inzwischen stillgelegten Schönfelder Kleinbahn zum Schulbesuch anreisten.
Im Gegensatz zu den meisten Gleichaltrigen aus den umliegenden Dörfern, die uns stolzen Städtern am Beginn ihrer Oberschulzeit mit Zurückhaltung und misstrauischer Vorsicht begegneten, zeigte Arno nicht das geringste Anzeichen von Minderwertigkeit oder Respekt.
»Nur weil wir vom Dorf kommen und nicht ganz so geschwollen daherreden wie ihr, sind wir noch lange nicht eure Trottel«, sagte er herausfordernd. »Falls ihr glaubt, dass wir in unserem Nest den Mond noch immer mit einer Stange weiterschieben, dann seid ihr schief gewickelt. Wir machen’s inzwischen mit Elektrizität.«
Arno war der unumstrittene Mittelpunkt der Klasse. Nur widerwillig akzeptierte er Typen wie mich. »Aufgepasst! Mamas Liebling kriecht unterm Rock hervor«, raunte er ins Klassenzimmer, wenn mich Kratschmer nach vorn zur Tafel rief.
In den Pausen berichtete er oft mit verschlagenem Stolz, welches »neue Ding« er gerade allein oder mit einigen Thalbacher Komplizen ausheckte. Dann scharte sich alles um ihn und hing gebannt an seinen Lippen. Der besondere Reiz der Geschichten lag darin, dass sie sich fast ausnahmslos mit seinem »Kampf gegen den Sheriff« befassten. Der »Sheriff«, das wussten wir inzwischen, war sein Vater, der als Hauptwachtmeister die Dorfpolizeistelle leitete und sich nach Feierabend zum Bürgermeister aufschwang; ehrenamtlich, wie es damals in den Dörfern noch üblich war.
Die Tatsache, dass Arno wegen der Nähe zu seinem Vater und dessen Beruf ständig mit dem Gesetz konfrontiert war und von diesem regelmäßig »etwas zwischen die Hörner bekam« (Originalton Sperling), qualifizierte ihn in unseren Augen erst recht. Mich dagegen hielten alle für ein Unschuldslamm. Manchmal spielte ich diese Rolle so überzeugend, dass ich selbst daran glaubte, obwohl ich mir alle Mühe gab, zum engsten Kreis vorzustoßen. Von Arno einen anerkennenden Blick zu ernten, bedeutete mir bald mehr, als ein »Sehr gut« in Mathematik.
Schuld an meinem Naturell war gewiss mein Vater. Rückblickend erscheint er mir wie ein Chamäleon. Seine größte Begabung bestand darin, sich widerspruchslos jedem herrschenden Zeitgeist anpassen zu können. Vermutlich ist er im Bewusstsein dieser Fähigkeit Finanzbeamter geworden.
»Es ist gleichgültig, wer die Macht ausübt und unter welchem politischen Deckmantel das geschieht - jeder Staat existiert von den Steuern seiner Untertanen«, predigte er mir, wann immer er glaubte, mir den richtigen Weg weisen zu müssen. Doch die gedankenlose Überzeugung, mit der er von Untertanen und der Unentbehrlichkeit seines Berufsstandes sprach, wird mir erst heute bewusst. »Und damit er diese Steuern auf Heller und Pfennig bekommt«, fuhr er fort, »braucht er Leute wie mich. Wir sind die eigentlichen Künstler im Lande, unverzichtbar. Eine Straßenwalze zu fahren ist dagegen ein Klacks. Denk darüber nach, mein Junge.«
Mit diesem abfälligen Nachsatz zerstörte er meinen Kindertraum von einem Leben als Dampfwalzenfahrer.
Sein Opportunismus verhalf ihm zwar zu keiner besonderen Karriere, was zeigt, dass er im Vergleich mit erfolgreicheren Vertretern dieser Gattung wohl doch nicht immer künstlerisch genug gewesen ist, aber immerhin gelang es ihm, sein kleinbürgerliches Dasein schadlos durch die tausendjährigen Irrungen und Wirrungen und danach durch die Hungerjahre bis ins fette Wirtschaftswunder zu lavieren.
Von diesen Dingen verstand ich damals noch nichts, das kam erst später. Aber schon als Sechsjähriger begriff ich, wie ich mich aufs Beste bei diesem leidenschaftslosen Finanzbeamten ins rechte Licht zu rücken vermochte. Wenn mich nämlich meine Mutter am Abend als braves, fleißiges Söhnchen vorführen konnte, dann machte er schon mal großherzig einige Groschen locker oder schenkte mir, in einem unerklärlichen Anfall von Verständnis, jenes Feuerwehrauto, dessen naturgetreue Details mich seit Wochen voller Faszination zum Schaufenster des Kaufhauses Klingelmayer lockten.
Ich denke, für meinen Vater war die höchste Form des Aufruhrs das Ballen der Faust in der Hosentasche. Er hasste nichts so sehr wie Aufsässigkeit. Und vier Tage vor meinem neunten Geburtstag - einige Dinge behält selbst das löchrigste Gehirn - kurierte er auch mich von diesem Übel; zumindest ließ ich ihn für lange Zeit in dem Glauben, seine Therapie sei erfolgreich gewesen.
Ich verabscheute Eintopfgerichte jeglicher Art. Allein der Geruch, der sich beim Kochen in der Küche ausbreitete, genügte, um meinen Hals voller Ekel zuzuschnüren. Bei Tisch stocherte ich dann gewöhnlich maulend mit dem Löffel darin herum und wartete auf ein erlösendes Zeichen meiner Mutter.
An diesem Tag gab es Linsensuppe. Für mich der Gipfel der essbaren Abscheulichkeiten. Ich nörgelte wie immer und rührte angewidert in der Brühe, während die Augenbrauen meines Vaters sich zu einer schnurgeraden Linie verzogen. Ein Rülpser, der mir bedauerlicherweise entschlüpfte, ließ den Topf des Verhängnisses jäh überkochen. Vater packte seinen Teller und schleuderte ihn samt Inhalt wie eine fliegende Untertasse über den Tisch. Ich duckte mich flink, so dass der Teller dicht über mir vorbeisauste und an der Küchentür zerschellte. Der Zorn auf mich wurde durch den Fehlwurf noch gesteigert und äußerte sich in einer ungeahnten Wendigkeit, mit der mein Vater um den Tisch geschossen kam, mich wie einen unfolgsamen Hund im Nacken packte, auf den Boden drückte und so verprügelte, dass ich wimmernd vor Angst und Schmerz und aus Wut über mein Ausgeliefertsein zum letzten Mal in meinem Leben in die Hosen urinierte. Danach war ich, wie gesagt, vom Übel der Aufsässigkeit kuriert und wurde »klüger«.
Obwohl mir die Resultate von Arnos frecher Schläue mehr imponierten als die durch Wohlverhalten erschlichenen materiellen Erfolge im Elternhaus oder in der Schule, wählte ich - in Zweifelsfällen ganz Sohn meines Vaters - den Weg des geringsten Widerstandes.
Woran Arno erkannte, dass ich, genau wie er, eine Rolle spielte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, so scheint es, hat er mich irgendwann durchschaut. Wie sonst wäre es zu erklären, dass er mich eines Tages auch in seine Tuscheleien über auszuklügelnde Vergeltungsmaßnahmen gegen das Lehrerkollegium im Allgemeinen und gegen Kratschmer im Besonderen einbezog?
Der entscheidende Vorstoß in den Kreis der Eingeweihten gelang mir - wir waren inzwischen in der achten Klasse - mit einem Kniff, durch den ich in einer großen Pause für Zigarettennachschub sorgte. Der Trick, genauer gesagt, mein Hinweis an die Kassiererin des der Schule gegenüberliegenden EDEKA-Ladens, dass aus einem Obstgestell Äpfel auf den Fußboden gefallen seien - tatsächlich hatte ich sie selbst unbeobachtet dorthin gelegt -, dieser Trick, mit dem ich die gutgläubige Frau für einige Augenblicke von der Kasse und dem dort befindlichen Tabakwarenregal abgelenkt hatte, brachte mir ein bewunderndes Schulterklopfen ein. Niemand hatte mir den Mumm zugetraut. Ehrlich gesagt, ich mir auch nicht. Aber was tut man nicht alles, wenn man vierzehn ist und endlich für voll genommen werden möchte.
Ich rechtfertigte das Delikt vor mir selbst, indem ich mir sagte, dass der Gewinn, den ich daraus gezogen hatte, nämlich von Arno persönlich die erste Overstolz aus dem Päckchen geklopft und angezündet bekommen zu haben, für mich größer gewesen war, als der Verlust, den der Lebensmittelkonzern erlitten hatte. Und in der Tat, wie man heute allerorten sehen kann, habe ich das Unternehmen nicht in den Ruin getrieben. Trotzdem überkam mich noch Jahre später ein mulmiges Gefühl, wenn ich den Laden betrat.
Von da an durfte ich dabei sein, wenn Arno mit den anderen loszog, um »Frauen aufzureißen« oder im Keller von Peter Kleinschmidt Schallplatten der Beatles und Rolling Stones nachzugrölen.
Peters Vater war der bedeutendste Gastronom in Schönfeld. Ihm gehörten zwei Hotels, der Ballsaal und an diesen angrenzend, das New Heaven, die erste Diskothek der Stadt.
Es begann eine Zeit, in der meine nachlassenden schulischen Leistungen bei meiner Mutter eine Folge von Magengeschwüren erzeugten, weil es ihr »nicht in den Kopf wollte«, was da so aus heiterem Himmel mit mir vor sich ging. Ihr adrettes Ein-und-Alles glitt ihr aus den Händen, roch auffallend häufig nach Zigaretten und kaufte, anstatt sich die Haare schneiden zu lassen, für das Frisörgeld Schallplatten.
Das allein hätte sie vielleicht noch verkraftet und vor ihrem Akkordeon spielenden Gatten vertreten können, aber dass der kostbare Saphir plötzlich nicht mehr Freddy Quinns schmachtende Stimme, die von der Heimatlosigkeit im heißen Wüstensand erzählte, in die gute Stube beförderte, sondern »Negergeheul«, bei dem sogar die Gläser in der Vitrine vor Angst erbebten, das überschritt ihre Toleranzschwelle. Und war sie es bisher gewohnt, dass er ihr, strahlend und mit dem Heft winkend, in schöner Regelmäßigkeit ein »Gut« oder »Sehr gut« präsentierte, so hielt er es nun nicht mehr für nötig, »Ausreichend« oder bestenfalls »Befriedigend« vorzuzeigen, was in ihren Augen ein endgültiges Indiz für den Abstieg war.
Ihre Lieblingssätze in dieser Zeit waren: »Womit habe ich das verdient? Mein Gott, warum strafst du mich so mit diesem Kind? Junge, du ruinierst unser aller Leben. Was soll ich nur deinem Vater sagen? Du bringst mich noch ins Grab!«
Gleichwohl nahm sie mich meinem Vater gegenüber in Schutz und spielte heile Welt. Sie weigerte sich, ihr »Versagen als Mutter« - so nannte sie es - einzugestehen. Was nicht sein durfte, das gab es auch nicht. Dabei hatte das Ganze nichts mit Versagen zu tun. Ich denke, sie versagte nicht mehr und nicht weniger als andere Mütter oder Väter; sie konnten einfach nicht aus ihrer Haut, als ein Phänomen wie die Beatles mit frechem Rock ’n’ Roll in ihre kitschige Kulturwelt einbrachen und nach und nach die verkrusteten Normen enttabuisierten. Sie erlitten einen Schock, der ihnen die Sprache verschlug. Da stand plötzlich ein John Lennon auf der Bühne und sang - die sanften, kurzsichtigen Augen in verzückte Jugendmassen getaucht - bissige Lovesongs und Hymnen für den Frieden. Da artikulierten langhaarige Rebellen wie Mick Jagger, Bob Dylan und Jim Morrison ein neues, grenz- und gesellschaftsübergreifendes Lebensgefühl, das der Nachkriegsgeneration eine nie zuvor erfahrene Wärme versprach, ein Lebensgefühl, das laut und aggressiv und obszön, ohne den Umweg über das Gehirn, direkt in den Bauch eindrang und das melancholische Wimmern des Akkordeons mittels einer simplen und darum um so verdächtigeren Zauberformel verspottete: »Yeah, yeah, yeah!«
Und ich gehörte plötzlich dazu. Genauer gesagt, Arno ließ mich dazugehören; er tolerierte den Unauffälligen und erlöste mich so vom Dasein der grauen Maus. Ein Rebell wie Arno war ich allerdings noch lange nicht. Ich schwamm in der Masse mit, und dadurch war ich vielleicht noch unauffälliger als früher, denn jetzt machte ich nicht einmal mehr durch gute Noten auf mich aufmerksam. Ich nahm den Lehrstoff auf und erledigte das Nötigste, um über die Runden zu kommen.
Niemals wäre mir beispielsweise eingefallen, Kratschmers Biologieunterricht inhaltlich zu kritisieren, wie es Arno ständig tat. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit spickte er seine Antworten mit unter die Gürtellinie zielenden Anspielungen. Er selbst bezeichnete diese frühreifen Sticheleien prahlerisch als »sexualkundliche Hinweise«. Allgemeines Gekicher war die Folge und manchem unschuldigen Lämmchen in der Klasse trieb es die Schamesröte ins Gesicht. Den alten Pauker indes konnte er nicht beeindrucken, der klammerte sich an seinen Lehrplan wie ein Pfaffe an die Enzykliken und wenn es ihm gar zu bunt wurde, schickte er Arno vor die Tür und verpasste ihm einen Eintrag ins Klassenbuch.
Während Arno also seinen Phantasien - in dieser Zeit besonders den sexuellen - freien Lauf ließ, begnügte ich mich, wie man es von uns erwartete, mit dem Mikroskopieren von Blütenstängeln.
Die von Arno geforderte Sexualkunde war damals noch kein Thema für Vierzehnjährige, ebenso wie noch kein Wörterbuch den Begriff Pillenknick verzeichnete. Unterrichtsstoff, der annähernd in die von Arno gewünschte Richtung zielte, war erst zwei oder drei Jahre später vorgesehen und dann selbstverständlich nicht mehr bei Hubertus Kratschmer. Arno aber wollte und konnte, wie er sagte, nicht so lange warten. Er suchte Erfahrung und keiner von uns bezweifelte, dass er sie bald machen würde.
Als erstes Ergebnis seiner Suche führte er uns in Kleinschmidts Keller mit stolz aufgerichtetem Penis vor, wie man ein Kondom überstreift. Wir verhielten uns mucksmäuschenstill und verfolgten mit feuchten Händen und glühenden Ohren, mit welchem Geschick Arno die verschiedenen Handgriffe vom Aufreißen des Päckchens bis zum aktreifen Präparieren seines Gliedes beherrschte. Kratschmer hätte, vom Thema abgesehen, seine helle Freude an unserer Konzentrationsfähigkeit gehabt.
Mir wurde fast schwindlig vor Erregung und mein Blut schien wie erhitzte Kirschkonfitüre durch die Adern zu wabern, ähnlich wie in jenen Träumen, aus denen man mit einem unbeabsichtigten Samenerguss erwacht. Aber dies war kein Traum und ich verdankte es Arnos Lektion, dass ich mich fortan wegen der verräterischen Flecken in meinen Schlafanzughosen nicht länger mit einem schlechten Gewissen belastete.
Die nächste Station in Sachen praktischer Sexualerziehung hieß Adelheid. Sie war siebzehn, wasserstoffblond, vollbusig und langbeinig; ihre feuerroten, feuchtglänzenden Lippen machten nicht nur uns Jünglinge rasend. Sie war Schichtarbeiterin in der Blusenfabrik und trat sonntags als Gogo-Girl im New Heaven auf.
Ich weiß nicht, wie es Arno gelungen war, bei dieser Fleisch gewordenen Venus zu landen. Seine einzige Erklärung war ein geheimnisvolles Augenzwinkern, als er an einem bis dahin eher langweiligen Nachmittag mit ihr im Schlepptau in unserem Keller auftauchte.
Beim Anblick der jungen Frau verstummten die eben noch das Come on der Stones begleitenden Background-Sänger wie auf Kommando und begannen, weil sie plötzlich nicht mehr wussten, wohin mit ihren Händen, an den Hemdärmeln zu zupfen oder in den Hosentaschen nach Streichhölzern und Zigaretten zu kramen.
Adelheid tat so, als bemerkte sie unsere Verwirrung nicht. Um die Situation zu entschärfen, ließ Arno sein Zigarettenpäckchen kreisen und fragte Adelheid, was sie trinken möchte. Klaus Kaufmann schien die »göttliche Erscheinung« als Erster verkraftet zu haben, denn er versetzte Peter Kleinschmidt einen unauffälligen Rippenstoß, woraufhin dieser wie ein aufgedrehter Kreisel in einen Nebenraum hastete und aus den Beständen seines Vaters die verlangte Cola organisierte.
Während wir uns bemühten, möglichst lässig zu wirken und unseren heiseren Atem unterdrückten, nippte Adelheid an der Flasche und durchwühlte dabei den Schallplattenstapel, den Peter für unsere Session aus der Diskothek herangeschafft hatte. Sie fingerte eine Scheibe heraus und legte sie auf den noch rotierenden Plattenteller: P.S. I love you füllte das Gewölbe. »Toll! Genau da hab ich jetzt Bock drauf!«, jauchzte sie und begann, im sanften Rhythmus der Musik ihre Taille wie eine Schlange zu winden.
Wir saugten hastig an den Zigaretten und hingen mit sehnsüchtig verdrehten Augen an ihren Bewegungen. Sie schwebte elegant wie ein Matador an uns vorüber, strich Klaus die Haarsträhnen aus der Stirn, knöpfte mit einem Fingerschnippen den obersten Knopf von Peters Hemd auf, verpasste Max Harich - dem fünften Mitglied unserer Clique -, der immer bleicher geworden war, einen sanften Nasenstups, wobei sie gleichzeitig ihre Hüfte an der meinen rieb, und schlang schließlich ihre Arme um Arnos Nacken und wiegte ihn zärtlicht aber bestimmt, bis seine Beine staksig in den von ihr vorgegebenen Takt fielen.
Ich weiß nicht, wie es den anderen erging, mir zumindest wollte in der Nacht nach diesem ersten Nachmittag mit Adelheid das Einschlafen nicht gelingen: Eva hatte Besitz von mir ergriffen.
In den folgenden Wochen tauchte Adelheid, wenn es ihre Schicht zuließ, regelmäßig Hand in Hand mit Arno bei uns auf. Da Arno in dieser Zeit ständig knapp bei Kasse war und wir ihn - außer in der Schule, wo er nun auch hin und wieder mal fehlte - nur in Begleitung von Adelheid zu Gesicht bekamen, ist zu vermuten, dass er sein Taschengeld in sie investierte. Ob es ausreichte und sie seinen Wissensdurst stillte und ihn ans Ziel seiner Sehnsucht führte, so wie es bis heute kein Lehrplan vorsieht, haben wir nie herausbekommen. Er verschwieg uns beharrlich die Geschichte seiner ersten Erfahrung. Was immer ihm Adelheid gegeben hatte, eines Tages jedenfalls kreuzte er wieder solo auf, streckte sich lang auf der Matratze neben dem Plattenspieler aus und wollte A hard days night hören. Als der Song zu Ende war, richtete er sich auf, schnorrte bei Peter Kleinschmidt eine Zigarette und verkündete: »Jungs, es ist das Größte!« Was er damit meinte, seine Orgien mit Adelheid, denn als solche malten wir uns die Rendezvous der beiden aus, oder den Beatles Song, blieb offen.
Von diesem Tag an freilich schwänzte er keine einzige Unterrichtsstunde mehr und selbst Kratschmer ließ er - von manch mitleidigem Grinsen abgesehen - unbehelligt. Er ging brav wie wir anderen auch in Anzug und Krawatte zur Tanzstunde und verliebte sich bei Foxtrott, langsamem Walzer und Tango in Hanna Gerber, ein Mädchen aus unserer Klasse, das mehr als einen Kopf kleiner war als er. Sie hatte über die Schultern fallendes, seidig glänzendes dunkles Haar, braune Rehaugen, eine Stubsnase, einen Schmollmund und ihr Busen war, nach unseren damaligen Maßstäben, kaum der Rede wert. Ein weibliches Wesen also, das keinerlei Ähnlichkeit mit Adelheid aufwies.
Hanna war Kratschmers Liebling. Er nannte sie »Pünktchen«, was sich für uns anhörte, als wollte er uns mit dem Namen einer bisher unbekannten Pflanze vertraut machen, die er bei einer seiner Exkursionen in den umliegenden Wäldern entdeckt hatte.
Anfangs vermuteten wir, dass Arnos stürmisches Flirten mit Hanna nur dem einen Zweck diente, Kratschmer zu provozieren, indem er ihm seinen Engel abspenstig machte. Doch spätestens am Morgen jenes Samstags, an dem abends der Abschlussball des Tanzkurses stattfinden sollte, mussten wir uns eines Besseren belehren lassen. Es begann damit, dass Arno als Erster unser Klassenzimmer betrat, eine Tatsache, die bereits als besonderes Ereignis zu werten war, denn ich erinnere mich nicht, dass dies jemals zuvor schon einmal vorgekommen war oder irgendwann später noch einmal geschah. Gewöhnlich trudelte er erst einige Minuten nach dem Klingelzeichen ein, wenn wir anderen längst mit Chorgebrüll den Morgengruß der jeweiligen Lehrkraft erwidert hatten. An jenem Morgen durchbrach er diese Regel und gleichzeitig missbrauchte er zum ersten und einzigen Mal seine Rolle als Leithammel. Er baute sich wie ein Feldherr vor der Tafel auf und erteilte uns beim Betreten des Raumes klare Befehle, deren Ausführung die Sitzordnung der Klasse dahingehend änderte, dass er aus der letzten in die erste Reihe vorrückte und einen Platz neben seinem neuen Schwarm bekam.
Hanna errötete. Vermutlich sowohl vor Glück als auch vor Verlegenheit, denn ich sah, wie sich unter der Bank die Hände der beiden fanden und während der folgenden Geographiestunde fest ineinander verknotet blieben. Eine unmissverständliche Geste, die selbst Kratschmer nicht entgangen war, wie der Anflug eines bei ihm seltenen Lächelns zeigte. Vielleicht deutete er das Verhalten der beiden Verliebten als Anzeichen eines nahenden Waffenstillstandes, denn obwohl er mit keinem Wort auf die scheinbar geänderte Situation einging, machte ihm das Unterrichten an diesem Tag sichtlich mehr Freude als sonst und als die Klingel das Ende der Stunde anzeigte, floh er nicht, wie üblich, grußlos aus dem Raum, sondern kramte umständlich in seiner Mappe, wünschte uns ein schönes Wochenende und wartete, bis Arno und Hanna gegangen waren.
Am Abend schwebten beide, sichtlich der Stolz unserer Tanzlehrerin, über das Parkett im Kleinschmidtschen Ballsaal. In den Tanzpausen aber, wenn sie sich unbeobachtet glaubten, verschwanden sie nach draußen, bis die ersten Takte der Kapelle sie zurückriefen. Einmal allerdings blieben sie der Tanzfläche für eine längere Zeit fern. Aber das bemerkten nur wenige, denn inzwischen hatten Musik und Alkohol die formale Etikette soweit gelockert, dass die Aufmerksamkeit der Gäste nicht mehr allein auf Hanna und Arno ruhte.
Meine Eltern drängten zum Aufbruch. Sie verabschiedeten sich gerade unter lautem Hallo und mir unvertrautem Gelächter von ihren Tischnachbarn, als ich Arno entdeckte. Er klopfte Peter dankbar auf die Schulter und ließ einen Schlüsselbund in dessen Jacketttasche verschwinden, der mir wegen seines vergoldeten, in Form einer Acht gebogenen Ringes sehr vertraut vorkam: An diesem Ring baumelte der Schlüssel unseres Kellers, unserer zweiten Heimat. Ich spürte, wie ein Gemisch aus Bewunderung und Neid in mir aufstieg.
Pünktchen schien Arno in jeder Beziehung gut zu tun, denn es war gewiss kein Zufall, dass sich der Zeitpunkt, an dem seine schulische Leistungskurve anzusteigen begann, eindeutig auf die Tage nach diesem Abschlussball datieren ließ.
Zur Freude und Genesung meiner geplagten Mutter fand auch ich zu alter Form zurück. Unsere Meetings in Kleinschmidts Keller hielten wir nun nicht mehr täglich ab, sondern nur noch mittwochs, samstags und sonntags und nun waren auch junge Damen dabei, von unseren Prahlereien beim Tanzkurs angelockt. Am wohlsten aber fühlten wir uns nach wie vor, wenn wir Burschen unter uns waren, allein mit dem Beat; laut und stampfend und schweißtreibend blieb er für lange Zeit - trotz aller Knutschereien und schmachtendem Bluestanzen - der wichtigste Bestandteil unserer Tage.
Das Heimchen und der Halunke hangelten sich bis zur schulischen Reife. Wir durchschauten uns und respektierten einander und ich denke, dass es dieser Respekt war, der eine tiefergehende Freundschaft verhinderte.