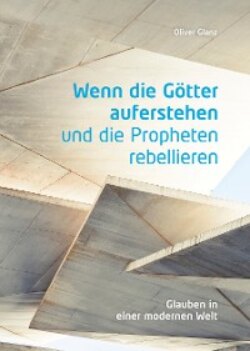Читать книгу Wenn die Götter auferstehen und die Propheten rebellieren - Oliver Glanz - Страница 10
3 DENKEN UND GLAUBEN
ОглавлениеDie Religionen der Völker zeigen uns oft die bizarrsten Vorstelllungen des göttlichen Wesens, aber wir dürfen uns die Sache nicht so leicht machen und sie als Aberglauben, Irrtum und Betrug verwerfen, sondern das höhere Bedürfnis ist, den Sinn und das Wahre, kurz das Vernünftige darin zu erkennen.
(Hegel, G. W. F. Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Berlin: Duncker und Humblot, 1840, 78.)
Literatur: Clouser, R. A. The Myth of Religious Neutrality: An Essay on the Hidden Role of Religious Belief in Theories. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2005; Dooyeweerd, H. »The Secularization of Science«, Montpellier, 1953; Woudenberg van, R. Gelovend Denken: Inleiding Tot Een Christelijke Filosofie. Amsterdam, Kampen: Buijten & Schipperheijn; KoK, 2004.
3.1 Einleitung: Theorie-Denken und Alltags-Denken
Jeder Mensch denkt. Ohne zu denken wären wir nicht in der Lage zu überleben. Im Alltag denken wir meist, ohne es zu merken. Denken ist nichts anderes als die sinnvolle Verarbeitung von Information. Diese Verarbeitung besteht aus zwei Elementen: (1) Erkennen von Unterschieden (Analyse) und (2) Erkennen von Zusammenhängen (Synthese). Das, was man im Denken differenziert, fügt man in einem weiteren Schritt wieder in einen sinnvollen Zusammenhang. So unterscheide ich zwischen dem Mann, der Frau und dem Kind, die ich sehe (Analyse). Es sind drei verschiedene Wesen. Und gleichzeitig erkenne ich, dass ein Zusammenhang zwischen der Frau, dem Mann und dem Kind existiert (Synthese): Es handelt sich um eine Familie mit Vater, Mutter und Tochter. Es liegt in der Natur des Denkens, dass Analyse und Synthese zusammengehören. Wer keinen Unterschied zwischen Frau und Mann machen würde, stünde in der Gefahr, die beiden Personen in einen falschen Zusammenhang zu stellen: z. B. als Geschwister (siehe Abb. 7).
Fazit: Denken findet statt, wo Unterschied und Zusammenhang von Informationen erkannt werden.
In unserem Alltagsdenken unterscheiden wir zwischen verschiedenen Phänomenen (Donner und Blitz, Brot und Apfelsaft, Essen und Trinken) und bringen sie in einen Zusammenhang (Unwetter, Nahrung, Mittagessen). Nur so können wir überleben. In der letzten Reflexion wurde davon geredet, dass der moderne Mensch vom rationalen Denken geprägt ist. Damit ist nicht so sehr dieses gewöhnliche Alltagsdenken gemeint, sondern wissenschaftliches oder theoretisches Denken. Ein solches Denken ist in gewisser Weise Denken in einem anderen Modus. Zur Vereinfachung wird das wissenschaftliche und theoretische Denken »Theoriedenken« genannt. Im Gegensatz zum Alltagsdenken verhält sich das wissenschaftliche Denken »mikroskopisch«. So wie das Alltagsdenken besteht auch das Theoriedenken aus Analyse und Synthese. Beim Theoriedenken wird allerdings nicht im Alltagsmodus, sondern im Mikroskopmodus analysiert und synthetisiert. Man unterscheidet darum nicht nur zwischen den Phänomenen »Hund« und »Mensch«, sondern zwischen den Blutbahnen und Nervenbahnen »innerhalb« eines Hundes. Wenn das Theoriedenken die Unterschiede »mikroskopisch« festgestellt hat, sucht es den Zusammenhang der zuvor unterschiedenen Elemente: Wie verhalten sich die Blutbahnen zu den Nervenbahnen des Hundes?
Verschiedenste mikroskopische Blickwinkel bestehen. Während der eine über die Substanzen innerhalb der Blutbahn und Nervenbahn nachdenkt (Biochemie), denkt, d. h. analysiert und synthetisiert, der andere über das Verhältnis von Fressvorgang und Speichelsekretion nach (Verhaltenspsychologie) und wieder ein anderer über Hormone und Brunftzeit (Biologie) (siehe Abb. 8).
Es gibt sehr viele verschiedene Seins-Aspekte, die man beim Theoriedenken unter die mikroskopische Lupe nehmen kann. Unter Seins-Aspekten werden alle Aspekte verstanden, die in einem existierenden Ding, Wesen oder Phänomen notwendigerweise anwesend sind (Hund, Stein, Liebe). Wenn man die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen betrachtet, gibt es die folgenden Seins-Aspekte, die man beim Theoriedenken in allen Dingen und Phänomenen unterscheiden kann (in Reflexion 5 wird auf die folgende Liste näher eingegangen):
1. quantitativer Seins-Aspekt (mehr – weniger)
2. räumlicher Seins-Aspekt
3. kinematischer Seins-Aspekt
4. energetischer Seins-Aspekt
5. biotischer Seins-Aspekt (leben – sterben)
6. sensorischer/psychischer Seins-Aspekt
7. logischer Seins-Aspekt
8. historischer Seins-Aspekt
9. linguistischer Seins-Aspekt (kommunizieren – misskommunizieren)
10. sozialer Seins-Aspekt
11. ökonomischer Seins-Aspekt
12. ästhetischer Seins-Aspekt
13. juristischer Seins-Aspekt
14. ethischer Seins-Aspekt
15. fidelischer Seins-Aspekt (vertrauen – misstrauen)
Jeder Gegenstand (Stein, Mensch, Baum) und jedes Phänomen (Liebe, Regen, Essen) kann in diese verschiedenen Seins-Aspekte unterschieden werden. Während ich im Alltagsdenken den Mann von der Frau abgrenze, bringt mich das Theoriedenken zum Abgrenzen von biotischem und psychischem Seins-Aspekt eines Gegenstandes. Wenn der Theoriedenker einen Seins-Aspekt abgegrenzt hat, kann er in ihm ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten finden. Der Verhaltenspsychologe, der den psychischen Seins-Aspekt des Hundes unter die Lupe nimmt, findet heraus, dass die Speichelsekretion auf Grund von Konditionierung zustande kommt. Wenn der Hund seinen Fraß sieht oder riecht, setzt die Speichelproduktion an. Wenn der Hund mit Fraß nun ein Klingelgeläut verbindet, setzt beim Glockengeläut die Speichelproduktion ein, selbst wenn es keinen Fraß gibt. Damit hat Pawlow innerhalb des sensorischen/psychischen Seins-Aspekts das Gesetz der Konditionierung entdeckt. Der Biologe, der den biotischen Seins-Aspekt erforscht, findet heraus, dass die Brunftzeit durch das genetische Erbmaterial immer in der günstigsten Zeit des Jahres stattfindet, um später beste Konditionen für den jungen Nachwuchs zu haben und damit das Überleben der Rasse zu sichern. Das ist das Gesetz der Selektion und Anpassung.
3.2 Die Göttliche Synthese
Immer dann, wenn ein Theoriedenker einen Seins-Aspekt eines Gegenstandes untersucht, wird er Gesetzmäßigkeiten finden. Damit ist aber erst die halbe Arbeit getan (siehe Abb. 9).
Nachdem der Theoriedenker den einen Seins-Aspekt (z. B. den sensorischen/psychischen Seins-Aspekt) des Hundes oder irgendeines anderen Gegenstandes von anderen Seins-Aspekten abgegrenzt und dadurch allgemeingültige Gesetze entdecken konnte (z. B. Gesetz der Konditionierung, Gesetz der genetischen Selektion), muss er nun – wie beim Alltagsdenken – durch die Analyse diesen Seins-Aspekt wieder in einen Zusammenhang (Synthese) mit den anderen Seins-Aspekten bringen, um ein sinnvolles Gesamtbild zu erhalten. Aber wie sollen sich die Gesetzmäßigkeiten des sensorischen/psychischen Seins-Aspektes zu den Gesetzmäßigkeiten des biotischen Seins-Aspektes verhalten? Genau an dieser Frage bricht der Streit der Theoriedenker aus, und die Wiederauferstehung des antiken Götterstreits findet statt (siehe Abb. 10). Der Verhaltenspsychologe ist so beeindruckt von der Macht der Konditionierungsgesetze, dass sie aus seiner Sicht das gesamte Verhalten des Hundes erklären könnten. Und so scheint es ihm sinnvoll, die genetischen Gesetze als eine Art verhaltenspsychologisches Folgegesetz zu betrachten. Beispielsweise kann Genmaterial durch verhaltenspsychologische Vorgänge manipuliert werden. Neueste Forschungen haben ergeben, dass viele übergewichtige Personen ein Gen besitzen, das die Fettleibigkeit fördert. Man konnte allerdings feststellen, dass dieses Gen auch bei sehr vielen Menschen vorliegt, die nicht unter Übergewichtigkeit leiden. Deren gesunde und geregelte Essgewohnheiten führte dazu, dass das Fettleibigkeitsgen nicht aktiviert wurde. Ganz ähnliche Zugsamenhänge lassen sich bei diversen Säugetieren feststellen.1 Biologische Abläufe sind darum vor allem psychisch bedingt. So könnte sich z. B. der Placeboeffekt erklären lassen. Biologische Mechanismen werden durch psychische Prozesse verursacht. Ein sinnvoller Zusammenhang entsteht, indem die verschiedenen Seins-Aspekte sich über die psychischen Gesetzmäßigkeiten zueinander verhalten.
Im Gegensatz zum Verhaltenspsychologen ist der Biologe so beeindruckt von der Macht der genetischen Gesetzmäßigkeiten, dass für ihn alles Verhalten auf den genetischen Code zurückzuführen ist. Nicht nur, ob ein Mensch an Krebs stirbt oder nicht, ist genetisch festgelegt, sondern auch, welchen Schönheitsidealen er nachgehen wird, um einen Partner zu finden. Aus dieser biologischen Perspektive lassen sich die ganzen verhaltenspsychologischen Vorgänge biologisch am Evolutionsprinzip erklären. Psychologische Mechanismen werden durch evolutionäre Prozesse bestimmt. Ein sinnvolles Gesamtbild entsteht, indem sich die verschiedenen Seins-Aspekte über die evolutionären Gesetzmäßigkeiten zueinander verhalten.
Was hier stattfindet, ist Reduktion. Alle übrigen Seins-Aspekte werden zu Unter-Aspekten eines anderen Seins-Aspekts reduziert. Hier entstehen die sogenannten »Ismen« (Biologismus, Psychologismus, Historismus). Bei jedem Ismus werden alle reduzierten Seins-Aspekte analog behandelt. Im Falle des Biologismus (evolutionäre Lebenserhaltungsprinzipien sind dominant) sieht das dann so aus, dass man von »religiöser Existenz« (fidelischer Seins-Aspekt), »sozialer Existenz« (sozialer Seins-Aspekt) und »moralischer Existenz« (ethischer Seins-Aspekt) spricht. Da, wo wir den sensorischen/psychischen Seins-Aspekt verabsolutieren, kommt es zu Analogien wie »logische Kohärenz« (logischer Seins-Aspekt), »kulturelles Empfinden« (historischer Seins-Aspekt), »Sprachgefühl« (linguistischer Seins-Aspekt), »moralisches Empfinden« (ethischer Seins-Aspekt).
Die gesamte Realität wird über das entdeckte Prinzip oder Gesetz einer spezifischen Wissenschaft sinnvoll erklärt. Das Viele lässt sich also durch das Eine erklären. Dabei ist jede ismatische Erklärung immer auch eine deterministische Erklärung, die sich sinnentleerend auf das Alltagsleben auswirkt (siehe Reflexion 1 und 2).
Die Tatsache, dass viele Ismen und damit verschiedene Wirklichkeitsverständnisse möglich sind, erklärt, warum vom Theoriedenken gesprochen wird. Alle logischen Rekonstruktionen eines Zusammenhangs der verschiedenen Seins-Aspekte sind nämlich nur Theorien. Jede Theorie kann die andere ausspielen. Und da, wo ein psychisches Phänomen nicht so einfach in den biologischen Reduktionismus passt, kann immer behauptet werden, dass in der Biologie noch weiter geforscht werden muss, um eine überzeugende Erklärung zu ermöglichen.
Fazit: Theoriedenken und damit wissenschaftliches Denken sind weder objektiv noch neutral.
3.3 Auf der Suche nach dem Zusammenhang
Wir sehen jetzt, wie der moderne Mensch mit seinem Dilemma von Objektivismus und Subjektivismus nicht so sehr vom Denken an sich geprägt ist, sondern von einem ganz bestimmten Denken. Nicht das Alltagsdenken, sondern die Ergebnisse des Theoriedenkens sind sein Problem. Soll das heißen, dass wir nicht mehr theoretisch denken sollen, und dass alle wissenschaftlichen Disziplinen letztlich keinen unumstrittenen Beitrag zum Verständnis des Lebens liefern? Das wäre ein voreiliger Schluss. Vielmehr müssen wir uns fragen, wie es zu diesem Phänomen des Reduktionismus kommt. Warum wird der Zusammenhang abgegrenzter Seins-Aspekte immer nur durch einen spezifischen Reduktionismus sinnvoll erklärt? Kann man einen sinnvollen Zusammenhang nicht auch ohne Reduktionismus gestalten? Warum kommt es zu diesem modernen Götterstreit, gibt es nicht auch Wissenschaft ohne Götter?
Wie schon Max Weber in seiner berühmten Vorlesung »Wissenschaft als Beruf« erklärte, hat der moderne Götterstreit sehr viel mit dem antiken Götterstreit zu tun. Im Römerbrief beschreibt der Prophet und Apostel Paulus, dass der antike Götterstreit (Zeus/Jupiter, Aphrodite/Venus, Dionysos/Bacchus, etc.) nur zustande kam, weil die Menschen dem wahren und einzigen Gott JHWH nicht mehr vertrauten (Römer 1,18 - 25). Paulus argumentiert weiter, dass da, wo JHWH als Schöpfer abgelehnt wurde, die Menschen einen Gottersatz in den Gegenständen der Schöpfung suchten. Für uns moderne Menschen ist es schwer, sich mit diesem biblischen Vokabular anzufreunden. Unter dem Begriff »Gott« verstehen die Propheten jemanden, der die Wirklichkeit so, wie wir sie kennen, geschaffen hat. Er hat unsere Erde, den Kosmos, Naturgesetze, Tiere, Menschen, in einen sinnvollen Zusammenhang gestellt. Für die Propheten besteht ein ganz klarer Unterschied zwischen dem einen Schöpfer (Gott) und der Vielfalt der Schöpfung. Der Existenzgrund der Wirklichkeit als auch deren Einheit und Zusammenhang liegen in Gottes Tat der Schöpfung begründet.
Die Abbildung 11 zeigt, dass es beim Begriff Gott in der Bibel, genauso wie in der Wissenschaft und ihren verschiedenen Ismen, darum geht, die Welt in einem sinnvollen Zusammenhang zu verstehen. Passend zu unseren Beobachtungen betonen die Propheten im Alten Testament, als auch Paulus und andere im Neuen Testament, dass man JHWH als Gott ablehnen kann. Man kann aber nicht Gott als eine Idee ablehnen, die die Diversität der Wirklichkeit in einen Zusammenhang bringt und den Grund für die Existenz dieses Zusammenhangs gibt. D.h. unabhängig davon, was man glaubt, muss man an etwas glauben, das diese Gottesrolle einnimmt. Der Mensch kann nicht sinnvoll leben, ohne die Gottesrolle konkret auszufüllen. Die Propheten beobachten, dass da, wo man JHWH als wahren und einzigen Schöpfer nicht mit dieser Gottesrolle identifiziert, die Menschen irgendetwas anderes mit dieser Gottesrolle in Verbindung bringen. Da es aber für die Bibel außer JHWH keinen Schöpfer gibt, muss der antike Mensch einen Gegenstand der Schöpfung mit dieser Rolle bekleiden. Und so wird die Sonne, die ja in der Bibel durch JHWH geschaffen wird, auf einmal in heidnischen Kulturen (z. B. Ägypten) selbst als Schöpfer der Wirklichkeit gesehen. Über die Sonne kann dann der Mensch die Vielfalt des Lebens erklären. Die Sonne gibt Wärme, lässt Pflanzen wachsen, reguliert die Zeiten und lässt Wasser verdunsten, sodass es regnet. Mit Hilfe der Sonne kann der innere Zusammenhang der Welt logisch erklärt werden (siehe Abb. 12).
Aber genauso wie die Sonne könnte ja auch der Berg den Zusammenhang der Wirklichkeit erklären (z. B. wie es die Bewohner Kanaans taten). Aus dem Berg kommen die Flüsse, die die Pflanzen wachsen lassen; der Berg bestimmt Wetter und Winde, von ihm erhält die Sonne in den Blitzen des Unwetters ihr Licht, usw. Weil die Menschen der Antike noch nicht so stark vom Theoriedenken, sondern vom Alltagsdenken geprägt waren, haben sie Gegenstände mit der Gottesrolle identifiziert. Heute findet das gleiche Phänomen statt, nur dass mit der Gottesrolle nicht mehr Gegenstände wie ein Berg, der Adler oder die Sonne in Verbindung gebracht werden, sondern bestimmte natürliche Gesetzmäßigkeiten, die sich in Gegenständen finden lassen.
Fazit: Der Berg ist durch die Genetik, der Adler durch die verhaltenspsychologische Konditionierung und die Sonne durch die Gesetze der Atomphysik ausgetauscht worden. In diesem Zusammenhang spricht dann Weber auch von der Auferstehung der alten Götter in neuem Gewand.
3.4 Präsident und Regierungsamt: Die Präsidentenwahl
Im Sinne der Propheten ist der atheistische Evolutionist genauso gottgläubig wie der Moslem oder Christ. Alle denken mit Hilfe der Gottesrolle. Während der Evolutionist an Zufall, Zeit und Selektion als Schöpfer der Wirklichkeit glaubt, glaubt der Moslem an Allah und der Jude und Christ an JHWH als Schöpfer der Wirklichkeit. Es geht beim Begriff Gott also um eine Funktion oder Rolle, nicht um eine konkrete Gottesidee. Gott ist also nicht so sehr der Präsident der Wirklichkeit, sondern das Regierungsamt für die Wirklichkeit. In der Bibel werden mit dem Wort Gott (Elohim) darum auch verschiedene Personen und Wesen in Verbindung gebracht. Während die Israeliten an JHWH als Gott glauben, glauben die Kanaanäer an Baal und die Ägypter an Aton als Gott. Wer das Regierungsamt innehat, kann also je nach Person/Glauben unterschiedlich sein. Den Regenten kann man wählen, z. B. das Evolutionsprinzip (time and chance), JHWH (persönlicher Gott in der Bibel) oder Aton.
Wenn nach der Analyse und der Isolierung eines Seins-Aspektes von anderen Seins-Aspekten wieder der Zusammenhang der Seins-Aspekte nach einem Ordnungsprinzip gesucht werden muss (Synthese), dann entscheidet sich, welchem Gott man glaubt. Ohne Gott geht es nicht, da sonst keine Synthese und damit kein sinnvoller Zusammenhang der Wirklichkeit besteht. Ohne Ordnungsprinzip leben wir in einer zusammenhangslosen und damit sinnlosen Welt. Der Mensch muss darum immer seine Regierung wählen. Die kritische Frage für das Theoriedenken ist dann, welches Prinzip zum Gott erhoben wird, um einen sinnvollen Zusammenhang entstehen zu lassen.
Fazit: Ohne Regierungsamt kann man die Welt nicht sinnvoll organisieren (Synthese).
Interessanterweise behaupten die Propheten, dass überall, wo ich einen Gegenstand oder Seins-Aspekt der Schöpfung zum Gott als oberstes Ordnungsprinzip oder Regenten mache (z. B. physikalische Prozesse und Gesetzmäßigkeiten), ich automatisch einen Gegengott erzeuge, der gegen das Primat des einen Gottes ankämpft (z. B. sensorische/psychische Gesetzmäßigkeiten vs. biotische Gesetzmäßigkeiten). Es wurde schon erläutert, dass da, wo man die Sonne zum Gott macht, mit der gleichen Selbstverständlichkeit der Berg zum Gott gemacht werden könnte. Je nachdem bestimmt die Sonne oder der Berg die Wirklichkeit. Genaus so verhält es sich in der modernen Welt auch. Wo ich biologische Gesetzmäßigkeiten zum Gott mache, bieten sich die physikalischen Gesetzmäßigkeiten genauso als Gott an. Beide »Präsidenten« können die Welt in einem sinnvollen Zusammenhang erklären. Dieser Götterstreit zeigt sich am praktischen Beispiel von Alexandra (Reflexion 1), die auf der einen Seite versucht, die Welt über den Physikalismus (Objektivismus) in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, aber ihre Welterklärung zugleich kompromittiert, indem sie dem Subjektivismus auch Raum gibt, um ihr Verliebtsein in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Dieser Dualismus ist typisch für den modernen Menschen.
Die Propheten behaupten immer wieder aufs Neue, dass da, wo man JHWH als Gott versteht, aller Dualismus ein Ende findet und der ewige Götterstreit zum Erliegen gebracht wird. Wer aber ist JHWH, und wie erklärt sich unsere Wirklichkeit über ihn in sinnvollem Zusammenhang? Das sind Fragen, die geklärt werden müssen.
3.5 Imago dei: Wer ist mein Gott?
Wir haben nun gesehen, dass modernistisches Theoriedenken nicht zur objektiven Wahrheit, sondern immer nur zu einer Theorie führt, die in einen gleichberechtigten Kampf mit anderen Theorien des Theoriedenkens gehen muss. Man kann hier vom Götterstreit der Ismen sprechen. Damit soll auch klar sein, dass das rationale Denken kein neutrales, zur Objektivität führendes Denken ist. Mag der Analyse-Teil des Denkens noch neutral sein, der Synthese-Teil ist es ganz sicher nicht mehr. Man könnte sogar sagen, dass der Synthese-Teil religiöser Natur ist, da die Synthese ja erst mit einer Gotteswahl möglich ist: Diese Gotteswahl ist nicht mehr objektiver Natur. Und so stellt sich heraus, dass das Denken, das die Moderne noch als neutral bezeichnet hat, zutiefst religiös ist. Sinnvoll denken kann man nicht ohne Anfangsidee, ohne Präsidenten, ohne Orientierung.
Nun mag der Eindruck entstehen, dass dem Theoriedenken skeptisch gegenüber gestanden wird. Das ist nur in begrenzter Weise der Fall. Ohne Theoriedenken bleiben viele unserer wichtigen täglichen Fragen ungeklärt. Es gibt keine Alternative zum Theoriedenken, wenn wir danach streben, die Wirklichkeit als Ganzes zu verstehen. Unsere Skepsis bezieht sich auf das, was das Theoriedenken inspiriert und lenkt. Denken und Rationalität sind keine neutralen Orte, nicht autonom, sondern stehen in einer religiösen Abhängigkeit. Welchen Präsidenten sollte man nun wählen, wenn man wählen muss, sich aber die Richtigkeit der Wahl nicht objektiv beweisen lässt?
Es mag vielleicht primitiv klingen, aber die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist das Experiment. Wenn es darum geht, die Wirklichkeit mit all ihren Phänomenen in einen sinnvollen, möglichst widerspruchslosen Zusammenhang zu bringen, muss geklärt werden, welcher Regent das am besten macht. Welcher Regent ist im Stande, die Widersprüche des Lebens sinnvoll zu integrieren, ohne sie zu ignorieren oder zu reduzieren? Welche Regenten bieten sich an? Wer oder was offenbart sich als Schöpfer unserer Wirklichkeit? Es wurde gezeigt, dass die verschiedenen, sich anbietenden Ismen keine idealen Regenten sind, da sie nicht gut die anderen Seins-Aspekte integrieren können (Subjektivismus und Objektivismus). Welcher Gott bringt alle anderen Gotteskandidaten zum Schweigen?
Markus, ein Geschichtslehrer aus Rotterdam, hat in seinem Leben viel experimentiert. In einer gewissen Weise ist sein Leben ein Labor. Er hat in seinem Leben schon so manche Regierungsauflösung miterlebt. So mancher Putsch und Staatsbankrott waren dabei. Aber heute kann er sagen, dass er schon seit einigen Jahren eine sehr vielversprechende Regierung im Amt hat, die sein Leben sinnvoll neu organisiert hat. Sein Leben gerät in einen immer sinnvolleren Zusammenhang. Er hatte bis dahin keine Regierung gefunden, die im Stande ist, das Dilemma von Subjektivismus und Objektivismus zu überwinden. Jetzt fühlt sich in der Lage, wieder frei lieben zu können und das Leben immer mehr zu genießen. Er ist zufrieden mit dieser Regierung.
Fazit: Die zentrale Frage ist, welche Regierung dein Leben und deine Erfahrungen am besten erklärt. Mit welchem Gott lässt sich dein Leben am besten führen? Mit welchem Gott identifizierst du dich? Voraussetzung für eine gute Wahl ist darum auch eine gute Kenntnis von dir selbst.
In den nächsten Reflexionen werden wir sehen, wie die Wirklichkeit sinnvoll erklärt werden kann, wenn sich unser Theoriedenken vom Geist der Propheten inspirieren lässt. Dabei lassen sich der Subjektivismus und naturalistische Reduktionismen überwinden.
3.6 Klärung
Die Frage stellt sich, wo du dich in deinem Experimentierprozess befindest. Was ist dein Präsident im Stande zu tun? Stellt er dich zufrieden? Kann er dein Leben in einen sinnvollen Zusammenhang bringen? Welche Präsidenten hast du bereits ausprobiert? Warum hast du sie gewechselt? Der gerade erwähnte Markus betont, dass da, wo JHWH nicht die Gottesrolle übernimmt, das Leben nicht aus der modernen Objektivismus-Subjektivismus-Zwickmühle befreit werden kann. Dein Leben wird, wenn es bewusst gelebt wird, von Lethargie und fehlenden Idealen geprägt sein. Wenn du bereit bist für ein weiteres Experiment, deine Regierung dich verlassen hat oder du nach etwas Besserem Ausschau hältst, dann versuche es einmal, so wie der eben erwähnte Markus, mit dem Gott der Bibel: JHWH. Regierungen kann man abwählen – es besteht also keine Gefahr. Aber gib JHWH als Regent zumindest eine Legislaturperiode Zeit. Es besteht die Möglichkeit, dass das Land in dir sich dann bessern wird.
Aber bevor du mit JHWH in der Gottesrolle experimentierst, solltest du dir im Klaren darüber werden, wer du bist. Wie schon erwähnt: Nur wer sich kennt, kann sinnvoll den Gott identifizieren, der das eigene Leben erklärt. Und so bieten sich folgende Übungen an:
→ Finde heraus, wer dich regiert und wo du den Ursprung deines Lebens lokalisierst:
Was sagst du und was denkst du, wenn Bekannte dich fragen, wie die Welt entstanden ist?
Welche Funktion hat für dich die Tatsache, dass Menschen Kinder zeugen können?
Warum denkst du, dass Menschen sich verlieben? Was denkst du über die Ursachen für ihre Begründung, die sie fürs Verliebtsein geben? Wende die Frage auf dich selbst an.
Welche Perspektive auf die Zukunft der Weltgeschichte gibt dein Gott? Leben wir in einer Geschichte des Fortschritts, nähern wir uns einer Apokalypse, oder wiederholt sich die Geschichte in ewigen Kreisläufen? Woher kommt es, dass du so denkst wie du denkst?
Was sagt dein Gott über die Tatsache, dass jedes Lebewesen einmal stirbt? Ist Leben und Sterben ein normaler Prozess chemischer Reaktionen von Biomasse? Gibt es eine Reinkarnation? Überlebt die Seele den Tod?
Gibt es Mächte, die einige der oben genannten Fragen besser beantworten als andere? Welche Mächte kämpfen da um die Gottesrolle?
→ Wenn du weißt, welcher Gott bzw. welche Mächte sich in deinem Leben um die Gottesrolle bemühen, ist zu klären, ob diese Mächte wichtige Phänomene des Lebens sinnvoll erklären können. Ein paar beispielhafte Fragen sollen dir helfen:
Krankheiten und Epidemien bedrohen den Menschen und andere Lebewesen immer wieder. Warum?
Die Wissenschaft lässt unser Leben immer fortschrittlicher werden. Warum?
Babys, die genug Nahrung, Ruhe und Wärme bekommen, aber keinen menschlichen Kontakt erleben, sterben. Warum?
Können die Phänomene Tafelrücken und Pendeln naturwissenschaftlich erklärt werden? Warum?
Warum hast du deinen Beruf, dein Studium oder deine Ausbildung gewählt?
Wie passt die Tatsache des Holocaust in dein Wirklichkeitsverständnis?
→ Der Philosoph Charles Taylor hat in seinem Buch Sources of the Self deutlich gemacht, dass der moderne Mensch an verschiedene Götter gleichzeitig glaubt. Ansonsten würde sich nicht erklären lassen, dass ein Evolutionist sich auch gleichzeitig für Menschenrechte einsetzt. Kannst du diese Beobachtung auch an dir selber feststellen? Lies Kapitel 1 (»Inescapable Frameworks«) und Kapitel 25 (»Conclusion: The Conflicts of Modernity«) von Taylor, C. Sources of the Self: the making of the modern identity. Cambridge: Harvard University Press, 2006.