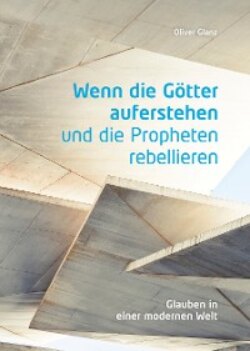Читать книгу Wenn die Götter auferstehen und die Propheten rebellieren - Oliver Glanz - Страница 9
2 VON DER UNABHÄNGIGKEIT IN DIE GEFANGENSCHAFT
ОглавлениеDie alten vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf. Das aber, was gerade dem modernen Menschen so schwer wird, und der jungen Generation am schwersten, ist: einem solchen Alltag gewachsen zu sein.
(Weber, M. »Wissenschaft als Beruf (1919)«. In Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, edited by Winckelmann, J., 582 – 613. 6th ed. Tübingen: Mohr Siebeck, 1985, 502)
Literatur: Kaufmann, W. A. Critique of Religion and Philosophy. Princeton: Princeton University Press, 1978; Nagel, T. »What Is It Like to Be a Bat?« The Philosophical Review 83, no. 4 (1974): 435 – 450; Randall, J. H. The Making of the Modern Mind: a Survey of the Intellectual Background of the Present Age. Boston, New York: Houghton Mifflin, 1926; Taylor, C. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press, 2006.
2.1 Einleitung: Gegenwart nicht ohne Vergangenheit
In der letzten Reflexion wurde gezeigt, wie sich die modernen Dogmen von Subjektivismus und Objektivismus sinnentleerend auf den Menschen auswirken. Dennoch werden sie in einer gewissen Weise von jedem geglaubt und dominieren den Alltag meist unbemerkt. Die vorgeschlagenen Aufgaben zur Selbstreflexion und zur Beobachtung haben den Einfluss dieser zwei Dogmen auf das eigene Leben vielleicht noch stärker bewusst gemacht. Ich hatte allerdings darauf verwiesen, dass die Grundlagen für diese Zwickmühle selbst erzeugt sind – zwar nicht von uns, aber von unseren Vorfahren. In dieser Reflexion wird versucht zu verstehen, wie eine vergangene Generation der Konstrukteur der modernen Zwickmühle zwischen Subjektivismus und Objektivismus wurde. Danach lassen sich die Schriften des biblischen Prophetentums als sinnvoller Gegenentwurf begreifen.
2.2 Cogito Ergo Sum
In der Schule haben die meisten gelernt, dass Descartes’ Satz »cogito ergo sum« (Ich denke, also bin ich.) gewissermaßen das Fundament der Moderne gelegt hat. Warum? Descartes hatte ein abenteuerliches und von vielen Unsicherheiten geprägtes Leben. In seiner Zeit entstanden die Nationalstaaten im Trubel politischer Unsicherheit; die Spaltung der Großkirche und des Protestantismus fanden statt und riefen eine religiöse Unsicherheit hervor. Durch Entdeckungen von Wissenschaftlern wie Kepler und Kopernikus entstand eine metaphysische Unsicherheit, deren Hauptfrage war: Was ist Realität?
Als Söldner kämpfte er am Anfang des Dreißigjährigen Krieges mal für die Protestanten (Fürst Moritz von Nassau), mal für die Katholiken (Maximilian von Bayern). Descartes sah Tausende ermordete Menschen in Dörfern, Städten und auf Feldern, nur weil sie aus der Sicht der Protestanten nicht an die biblische Wahrheit glaubten. Auf der anderen Seite ermordeten Katholiken mit ganz ähnlicher Begründung Protestanten, um die christliche Wahrheit zu verteidigen. Mord wegen unterschiedlicher Auffassungen von Wahrheit! Neben dem Kriegsgeschehen tat sich in Europa aber noch mehr. Viele Ansichten, die man damals über die Natur und den Kosmos landläufig hatte, wurden durch die Entdeckungen von Kopernikus, Huygens, Kepler und Galileo Galilei überholt. Die Erde war nicht mehr Mittelpunkt des Universums (geozentrisches Weltbild), sondern die Sonne (heliozentrisches Weltbild). Zumindest deuteten darauf alle wissenschaftlichen Berechnungen. Für den wissbegierigen Descartes stellte die Nachricht darüber, dass Galileo Galilei von den Inquisitoren zur Widerrufung seiner Thesen aufgerufen wurde, eine endgültige Kehrtwende dar. Für ihn entstand die zentrale Frage: Wer hat die Autorität, sagen zu können, was Wahrheit und Wirklichkeit sind? Der Papst, Kepler oder Luther? Wann kann ein Mensch überhaupt Gewissheit darüber haben, dass sein Glaube von der Wahrheit handelt und nicht von einer Illusion? Wenn das, wofür man im Dreißigjährigen Krieg kämpfte, am Ende nur Illusion und nicht Wahrheit war, dann war noch weniger zu rechtfertigen, dass man wegen »der Wahrheit« halb Europa tötete. Wie jeder in der damaligen Zeit war Descartes gläubig und fest davon überzeugt, dass es die eine alleingültige Wahrheit gibt. Aber wenn ganz Europa sich nicht einig darüber sein kann, was die Wahrheit ist, dann scheint zumindest halb Europa einer Illusion zu glauben und sich getäuscht zu haben. Und so fand Descartes sehr schnell den Gegenstand seines kritischen Nachdenkens: Täuschung. In seinen Meditationen (Meditationes de prima philosophia) untersucht er, worin man als Mensch überall getäuscht werden kann. Freunde können einen täuschen, Gefühle können einen täuschen. Es ist gerade des Teufels Expertise, jeden einzelnen Menschen zu täuschen. Aber Descartes ist kein Pessimist. Er glaubt daran, dass absolute Gewissheit, die jegliche Täuschung überwindet, zu erreichen ist. In seinen Meditationen kommt er zum Schluss, dass das einzige, was uns von jeglicher Täuschung bewahrt, das unabhängige Denken, die neutrale Rationalität sei. Mit seinem Satz »cogito ergo sum« will er somit sagen, dass das, was den Menschen im Innersten ausmacht, seine Fähigkeit ist, rational in Unabhängigkeit zu denken. Menschen lassen sich irreführen, weil sie nicht in Unabhängigkeit denken. Wer alle Regeln der Logik anwendet und sich nur von ihnen leiten lässt, wird die Wahrheit entdecken – unabhängig von Papst, Luther oder Kepler! Gerade erst im Schulterschluss von persönlicher Unabhängigkeit (Neutralität) und Ratio (Vernunft) lässt sich Wahrheit finden.
2.3 Hinwendung zum Ich – Anwendung von Rationalität: ein Problem
Mit Descartes hat sich der Ausgangspunkt der Wahrheitserkenntnis grundlegend geändert. Wahrheit wird nicht mehr von außen an uns herangetragen. Nicht mehr ein Prophet, Priester oder die Tradition vermittelt oder verantwortet die Wahrheit, sondern sie erschließt sich von innen, aus mir selbst heraus (Unabhängigkeit). Durch mein Denken (Rationalität) kann ich die Wahrheit erkennen. Man spricht auch von der sogenannten »Hinwendung zum Ich/Subjekt« oder zur 1. Person-Perspektive (»Turn to the self«).
Descartes’ Gedanken sind zu einem großen Teil gut nachvollziehbar. Seine Werke und Gedanken wurden vom Papst verboten, aber sie fanden so viele Anhänger, dass Jahrhunderte später der moderne Mensch zu einem großen Teil das Programm Descartes’ auslebt – mit all seinen problematischen Konsequenzen! Was ist das Problem?
Um der Täuschung und dem Zweifel zu entkommen, muss der Mensch sein rationales Denkvermögen in Unabhängigkeit (Neutralität) einsetzen, um Gewissheit über Wahrheit und Irrtum zu erlangen (siehe Abb. 5).
Wie gesagt, misstraut Descartes im Prinzip allem, auch den eigenen Sinnen. Würden wir den Sinnen vertrauen, würden wir denken, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht und am Abend wieder untergeht. Aber mit Hilfe von rational-analytischen Berechnungen hat man die sinnlichen Wahrnehmungen bis in die Kleinigkeiten zu zerlegen (Dekonstruktion) und zu untersuchen. Wenn man dann alle Elemente rational wieder zusammenstellt (Konstruktion), wird man herausfinden, dass sich in Wirklichkeit die Erde um die Sonne dreht. Diese rationale Analyseprozedur hat man auf alle Gegenstände anzuwenden. Und hier liegt das große Problem: Nach Descartes’ Methode wird die Welt da draußen durch meine innen liegende Rationalität rekonstruiert. Da die eigene Logik nach den Regeln der Kausalität funktioniert, ist die »wissenschaftlich« rekonstruierte Welt auch immer eine kausale Welt. Kausal bedeutet, dass die rekonstruierte Welt keine willkürliche Natur, sondern eine geregelte Natur hat. Wenn z. B. Sonnenlicht in einer bestimmten Wellenlänge auf bestimmte kugelförmige Wassertropfen einer Regenwand stößt, entsteht immer ein Regenbogen – ohne Ausnahme. Die Realität wird damit vorhersehbar. Wenn aber die gesamte externe Welt nach den Regeln der internen Logik rekonstruiert wird, ist alles kalkulierbar. Alles! D.h. wenn ich mit meiner Rationalität wissenschaftlich herausfinden möchte, wer ich in Wahrheit bin, dann bin sogar ich kalkulierbar, berechenbar, unfrei und eine Maschine. Auf einmal komme ich mit meinen Untersuchungen nicht nur zum Schluss, dass mein Haarausfall genetisch verursacht ist, sondern auch, dass meine Liebe zu meiner Frau aufgrund bestimmter biochemischer Prozesse zustandekommt. Und genau das ist das Problem des Objektivismus: Ich bin nicht mehr frei. Wenn ich das nicht anerkennen will, bin ich einer Täuschung zum Opfer gefallen. Das Ich wird durch eine objektive 3. Person-Perspektive definiert.
Mit der Hinwendung zum Ich (Subjekt) als rationales Wesen meint Descartes einen Weg gefunden zu haben, sich von der Gewalt der 3. Person, nämlich der Fremdbestimmung des Papstes, der Tradition und anderer Kräfte, zu befreien. Ironischerweise ist das Ich bzw. der Mensch in letzter Konsequenz aber wieder unfrei. Er ist zwar nicht mehr gefangen von den alten Kräften, wird aber jetzt von neuen, noch gewaltigeren Kräften beherrscht. Descartes’ rationalistische Methode ist wie ein Zauberstab: Jedes zuvor mysteriöse Objekt, das angetastet wird, ist auf einmal verständlich, erklärbar, logisch, aber gleichzeitig auch berechenbar und fremdbestimmt (siehe Abb. 6).
2.4 So sein wie du
Nun hat Descartes unser Problem von Subjektivismus und Objektivismus zu seinen Lebzeiten nicht mehr gesehen. Wenn er gewusst hätte, was die Folgen seiner Überlegungen sein würden, hätte er noch einmal angefangen sich zu fragen, ob er mit seinem »cogito ergo sum« nicht vielleicht einer Täuschung aufgesessen war. Für ihn war es wichtig, einen neutralen Ort zu finden, von dem aus man, ohne sich von Meinungen, Religionen oder Traditionen beeinflussen zu lassen, die echte Wahrheit entdecken kann. Und die menschliche Logik schien ihm so ein Ort zu sein. Ein Ort, den jedes Individuum für sich beanspruchen kann, denn er glaubte, dass jeder einzelne Mensch von Gott die Fähigkeit des rationalen Denkens erhalten habe. Jeder Einzelne kann sich also neutral der Welt nähern und herausfinden, was die Wirklichkeit ist.
In unserer ersten Reflexion haben wir festgestellt, dass kein Mensch nur objektivistisch leben kann. Subjektivität bleibt immer Bestandteil unseres Lebens. Das wird sichtbar in den Spannungen, die die »philosophy of mind« hervorruft: Auf der einen Seite sehen wir, dass unsere subjektiven Gedanken durch neurophysiologische Prozesse im Gehirn gesteuert werden (Objektivismus), auf der anderen Seite ist es unser Denken, das diese neurophysiologischen Prozesse erforscht (Subjektivismus). Das Geistige scheint sich nie aufs Physische reduzieren zu lassen.
Schlussendlich gehen wir alle davon aus, dass persönliche Freiheit – wenn auch unklar ist, in welcher Form und welchem Ausmaß – besteht. Zu viele menschliche Handlungen bleiben unklar, mysteriös und scheinen sich nicht wissenschaftlich erklären zu lassen. Für all diese Fälle gehen wir von der Freiheit des Menschen aus, Dinge zu tun, die dem eigenen Willen entsprechen, nicht aber allgemeinen Regeln und Normen. Darum glauben wir, dass Straftäter nicht notwendigerweise Straftäter hätten sein müssen, und verurteilen ihre Handlungen als freie und unentschuldbare Handlungen. Subjektivität ist also wesentlicher Bestandteil unserer Wirklichkeit, nur ist dieser subjektive Bestandteil per Definition nie auf dem rationalistischen Radarschirm zu sehen. Und das ist auch verständlich. Während die Rationalität eine neutrale, allgemeingültige, für jeden verbindliche, also frei von jeglicher Subjektivität existierende Methode sein will, entdeckt sie auch immer nur die allgemeingültigen, verbindlichen Gesetzmäßigkeiten, die das Leben »kontrollieren«– und damit immer nur den objektiven Teil der Wirklichkeit.
Thomas Nagel ist durch einen Artikel mit dem Titel »What is it like to be a bat« berühmt geworden. Dabei stellt er die Frage, ob wir als Menschen mit unseren wissenschaftlichen Methoden die Möglichkeit haben herauszufinden, wie eine Fledermaus die Realität erlebt. Wir können die Antwort bereits vermuten. Nagel macht ganz deutlich klar, dass das nicht möglich ist. Die Realität von subjektiven Erfahrungen kann nicht auf die allgemeingültige Schnittmenge, die verschiedene subjektive Erlebnisse haben, reduziert werden. Wenn das dennoch geschieht, hat man nicht die eigentliche subjektive Erfahrung beschrieben. Die subjektive Erfahrung ist immer mehr als ihre objektive Beschreibung. Das Problem des modernen Rationalismus ist, dass wir nach objektiver Wirklichkeit streben, aber im gleichen Moment die subjektiven, unterschiedlichen Erfahrungen verlieren, die genauso Bestandteil der Wirklichkeit sind. Wie kann ich aber wissen, wer der andere ist, wenn er mehr ist als das Produkt allgemeingültiger Gesetzmäßigkeiten? Wie kann ich wissen, wer ich bin, wenn ich mehr bin als das, was die Wissenschaft über mich zu sagen hat? Wenn der andere immer der Fremde bleiben wird, wie kann ich dann jemals mein Leben mit ihm teilen, ihn lieben, ihm vertrauen und ihn verstehen?
Fazit: Wer ich bin, wer du bist, bleibt dem objektiv-rationalistischen Denken verborgen. Ich und Du sind mehr als das, was die Wissenschaft mit ihrer 3. Person-Perspektive über uns zu sagen hat.
2.5 Neuauflage des ewigen Götterstreits
Aus der rationalistischen Methode Descartes’ folgt nicht nur, dass ich nie herausfinden kann, wer ich bin und wer der andere ist. Es ergibt sich ein neues Problem: Während viele Biologen erklären, dass jedes Handeln der Menschen letztlich evolutionistisch zu erklären ist (Ich verliebe mich, weil ich instinktiv das Überleben meiner Gene sichern muss.), widersprechen Historiker dieser Idee und zeigen auf, dass die evolutionistische Philosophie ein Zeitgeist-Phänomen ist, das seine Wurzeln in der Aufklärung suchen muss (damals wurde die biblische Eschatologie säkularisiert). Für den Historiker wird die Evolutionsidee darum als Zeitblüte wieder vergehen. Der Psychologe hingegen erklärt, dass der Versuch der Historiker, die Weltgeschichte zu systematisieren, als auch der Versuch des Biologen, menschliches Handeln auf biologische Prinzipien zu reduzieren, auf die Struktur der menschlichen Psyche zurückzuführen sind. Diese Struktur versucht ständig, komplexe Zusammenhänge auf einfache Systeme zu reduzieren. Es kommt zum Disziplinenstreit.
Wir sehen, dass es innerhalb der Wissenschaft sehr unterschiedliche rationalistische Ansätze gibt, Phänomene reduktionistisch zu erklären. Unser Beispiel hat drei Wissenschaftszweige (Biologie, historische Wissenschaft, Psychologie) in Konkurrenz gezeigt. Während für den einen die Evolutionsidee subjektiv und historisch bedingt ist (Historismus), ist für den anderen der Historismus subjektiv und psychisch bedingt (Psychologismus), und für einen weiteren sind die entwicklungspsychologischen Abläufe selbst nur Produkt der Evolution (Biologie). Eine Art Kampf um Objektivität findet statt. Der Kampfschauplatz ist die Arena der Universität. Während wir glaubten, dass wissenschaftliches Denken uns ein objektives Bild von der Wirklichkeit zeichnen kann, spricht jede Wissenschaft einen Subjektivitätsverdacht über die anderen Wissenschaften aus. Es gibt nicht die eine wissenschaftliche Stimme, die uns die objektive Wahrheit erzählt, sondern viele, in Konkurrenz stehende, rationale Stimmen. In diesem Kontext spricht Max Weber von der Wiederauferstehung der Götter. Jeder versucht, Einfluss bei den Menschen zu gewinnen, aber keiner kann wirklich überzeugen und siegen. Das einzige, was die Götter unserer modernen materialistischen Zeit von den antiken unterscheidet, ist, dass sie unpersönlich und rationalistisch sind. Aber wie früher haben diese Götter ihre Priester (Biologen, Psychologen, Historiker) und ihre Gläubigen (die modernen Menschen). Die Konkurrenz um die Wahrheit zwischen den Wissenschaften hat dazu geführt, dass es immer mehr interdisziplinäre Initiativen gibt, um herauszufinden, welche Berechtigungen und welche Art von Wissen jede einzelne Wissenschaft hat. Dieses Bemühen ist sehr wichtig, aber solange es modernistisch bleibt, ist die Problematik nicht zu überwinden.
Fazit: Die Wissenschaft hat nicht die Antwort auf die Fragen des Lebens. Viele verschiedene wissenschaftliche Theorien stehen miteinander im Konflikt.
2.6 Problembehandlung
Die Konstrukteure des modernen Dilemmas wurden vorgestellt und ihr Verlangen nach Mündigkeit deutlich gemacht. Sie wollten frei werden vom Wahrheitsdiktat verschiedener Kräfte und ihre ethische Verantwortung ernst nehmen, indem sie versuchten zu verhindern, dass länger im Namen der Wahrheit gemordet wird. Aber leider haben sie einen Weg eingeschlagen, der die Menschen schlussendlich in eine noch düsterere Gasse geführt hat. Zwei Probleme sind dabei ständig präsent: (1) Die Beantwortung der Frage nach dem »Wer bin ich? Was ist der Mensch?« rückt immer ferner, je moderner wir werden. (2) Die Antwort auf die Frage nach der objektiven Wirklichkeit scheint nicht durch neutrales rationalistisches Denken möglich. Der moderne Mensch ist nicht im Stande, diese Probleme zu lösen. Und so dominieren Subjektivismus und Objektivismus sinnentleerend weiter den modernen Alltag.
Es klärt sich in unserer Zeit immer mehr, dass ein Rückzug aus der Sackgasse nur mit einer Abwendung vom »cogito ergo sum« und den Denkkonzepten der Moderne geschehen kann. Aber wie soll das geschehen, wenn wir nicht wieder in einem Dreißigjährigen Krieg enden wollen?
In den nächsten vier Reflexionen (3 bis 6) wollen wir versuchen, unserem modernen Dilemma aus der Perspektive der biblischen Propheten zu begegnen. In dieser Konfrontation tut sich ein unerwarteter Weg auf, der es vermag, uns wieder an den Sinn und die Wirklichkeit des Lebens hinzuführen. In der nächsten Reflexion wird aus einer biblischen Perspektive erläutert, was passiert, wenn wir wissenschaftlich/rational denken und arbeiten, und weshalb die einzelnen Wissenschaftsdisziplinen gleichsam dem alten Götterkampf miteinander um die objektive Sichtweise kämpfen. Dabei sollen auch die Propheten zu Wort kommen. Daran anschließend wird in der Reflexion 4 skizziert, wie die Frage nach dem »Wer bin ich?« im Pentateuch (5 Bücher Mose) behandelt wird. Dort lässt sich eine Vision vom Leben finden, die den Menschen zurückführen will in die Selbstbegegnung und der Begegnung mit dem Mitmenschen. In Reflexion 5 wird in den prophetischen Zugang zur Objektivität eingeführt, ohne dass damit der Objektivismus als Bedrohung einhergeht. In Reflexion 6 wird gezeigt, wie aus prophetischer Perspektive Subjektivität und Objektivität in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen.
2.7 Klärung
Wir haben gesehen, dass da, wo versucht wird, Dinge verständlich werden zu lassen, indem sie in logischer Kausalität erklärt werden, die Freiheit des Menschen sehr schnell verdrängt wird. Das wird vor allem sichtbar, wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt. So wird – ganz zurecht – der Aufstieg des Nationalsozialismus vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs des Kaiserreichs und der sich daran anschließenden, unverhältnismäßig hohen Reparationszahlungen an die Siegermächte nach dem 1. Weltkrieg erklärt (Versailler Vertrag). Des Weiteren haben die brutale Oktoberrevolution in Russland und die dramatische Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre die Bevölkerung in der nationalsozialistischen Bewegung Hoffnung auf die Sicherung von Gerechtigkeit, Recht und Freiheit suchen lassen.
Diese historischen Rekonstruktionen der Abläufe und ihrer Dynamiken auf die Entscheidungen der Menschen zu verstehen, hilft, das erneute Aufkommen eines grausamen Nationalsozialismus zu verhindern. Aber genau hier fängt unser Problem an: Wo die Vergangenheit als eine kausale Kette von Ereignissen und Entscheidungen verstanden wird, kann schnell davon ausgegangen werden, dass der Nationalsozialismus unausweichlich war. Es hätte also gar nicht anders kommen können: A erzeugt B (nach A kommt nicht C). Wenn man allerdings anfängt so zu denken, gibt man die menschliche Freiheit auf. Schnell ist man dann geneigt zu sagen: »Mein Großvater hatte gar keine andere Möglichkeit, als der NSDAP beizutreten.« Menschliches Handeln, Entscheidungen und Überzeugungen sind dann nur noch Produkte der Umstände. Dass das aber nicht der Fall ist, wird immer dann klar, wenn der nächste Schritt aus der Gegenwart in die Zukunft gegangen wird. Deutlich wird, dass als Reaktion auf A neben B1 auch B2, B3 und Bn bestehen.
Diskutiere, wie sich Kausalität und menschliche Freiheit zueinander verhalten. In welchem Verhältnis steht unsere Betrachtung der Vergangenheit zu unserer Zukunftsschau?