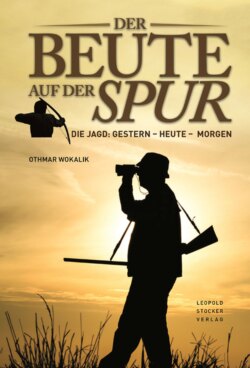Читать книгу Der Beute auf der Spur - Othmar Wokalik - Страница 22
ОглавлениеMit der Unterscheidung zwischen Hoher und Niederer Jagd wurden die bei der Hohen Jagd gebräuchlichen Ausdrücke von all jenen, denen nur die Niedere Jagd erlaubt war – und das war die Mehrzahl des gemeinen Volkes – nicht mehr verstanden. Die Berufsjäger als Begleiter des Königs, später der Landesherren, entwickelten abseits der Gemeinsprache eine ihrem Standesbewusstsein gemäße Berufs- und Standessprache.
Jagdverbote
Für Geistliche jeglichen Ranges galt ein rigoroses Jagdverbot. In praxi hielt sich besonders die hohe Geistlichkeit nicht an dieses Verbot. Viele Würdenträger waren leidenschaftliche Jäger. Infolge ihrer persönlichen Verbundenheit erlagen sie nicht selten der Versuchung, sich das Jagdrecht durch gefälschte Urkunden zu verschaffen. Überlieferte Fälschungen zeigen, dass besonders die Klöster durch die Verwendung solcher Urkunden sowie fadenscheiniger Vorwände ein Jagdrecht zu erlangen versuchten. Karl der Große soll dem Abt und den Mönchen des Klosters St. Berdin die Jagd auf Rotwild durch Bedienstete in den klostereigenen Waldbeständen zugestanden haben, um dem Kloster die Produktion von Handschuhen und Gürteln sowie das Einbinden von Büchern zu ermöglichen; das Diplom trägt das Datum 26. März 800.
Das Jagdverbot für Diakone, Priester und Bischöfe wurde schon sehr früh durch das Konzil von Agde (Südgallien) im Jahre 506 verhängt. Das Konzil verbot den genannten Personen auch das Halten von Jagdhunden und Falken. Nachfolgende Konzile bestätigten das Jagdverbot von 506, zumal die Kirchenfürsten ungeachtet des Verbotes weiterhin mit großer Leidenschaft jagten.
Schon in einem Beschluss des Concilium Germanicum vom 21. April 742 heißt es:
Überdies verbieten wir allen Dienern Gottes die Jagd und das Umherschweifen in den Wäldern mit Hunden. Auch dürfen sie keine Habichte und Falken halten.31
Allerdings gab es auch hochrangige Geistliche, die der Jagd nichts abgewinnen konnten und heftige Attacken gegen die damals weitverbreitete Jagdleidenschaft ritten.
Überliefert sind heftige Attacken des Bischofs Jonas von Orleans (821–844 n. Chr.), die zunächst gegen die Geistlichkeit, später auch gegen weltliche Würdenträger des Adels gerichtet waren, denen er vorwirft, viel Geld für Beizvögel und Jagdhunde, aber zu wenig für die Armen auszugeben. Den geistlichen Herren wurde vorgeworfen, ob ihrer Jagdleidenschaft zu vergessen, die heiligen Messen zu besuchen und so ihrem Seelenheil Schaden zuzufügen. Die Auseinandersetzung zwischen Jagdbefürwortern und Jagdgegnern währte vom 11. bis zum 16. Jahrhundert; sie wurde in Wort und Schrift ausgetragen. Einer der führenden Kämpfer war Adam von Bremen (11. Jh. n. Chr.), der die Vorwürfe gegen die geistlichen Jäger sogar in seiner Hamburger Kirchengeschichte vorbrachte. Jagdverbote für Geistliche gab es auch außerhalb des karolingischen Rechtsbereiches. Für Ungarn verbot der hl. Ladislaus 1278 den Ordensbrüdern jegliche Jagd, sei es mit der Waffe oder mit dem Falken.
Der Rat der Stadt im westfälischen Münster forderte noch im 16. Jahrhundert unter Berufung auf das Ius Canonicum (Kirchenrecht) ein rigoroses Jagdverbot für alle Geistlichen. Die Aufgabe der Geistlichkeit sei, so hieß es, die Kirchengüter zu verwalten und das Lesen, vor allem aber das Beten und den Glauben zu verbreiten. Tatsächlich unterschieden sich die geistlichen Herren kaum von den weltlichen Fürsten; sie gingen lieber zur Jagd als zur Messe und bestiegen lieber das Streitross als die Kanzel. Wie hartleibig die Exponenten dieser Auseinandersetzung waren, zeigt ein, wenn auch nicht alltäglicher Vorfall: Ein Bischof von Auxerre ließ einen seiner Diener deshalb kreuzigen, weil er einen Vogel aus seiner Falknerei verkauft hatte.32
Die Inforestation
Inforestation, also die Ablösung des freien Tierfangs durch ein Regelwerk mit der Einrichtung von Bannforsten, in denen nur der König das Jagdrecht hatte, Bannforste und königliche Jagdregalien stehen für die Feudalisierung der Jagd. Diese Regelungen mögen aus heutiger Sicht als ein unzulässiger Ausschluss großer Teile der Bevölkerung von der Jagd anmuten. Aber es gehört zu den Grundsätzen seriöser Geschichtswissenschaft, eine historische Periode nicht mit dem Parameter des Forschenden, sondern mit dem dazumal geltenden Prioritätenkatalog zu untersuchen; nur das ist erkenntnistheoretisch legitim, wenn ein objektives Urteil gefällt werden soll. So gesehen war das Mittelalter für Europa, ja teilweise weltweit, eine der produktivsten Epochen in der Geschichte der Jagd.
Was häufig als Vorbereitung für die Bewährung am Schlachtfeld angesehen wurde, mutierte zu einem erweiterten Verständnis des Menschen als Teil der Natur, zur Jagdleidenschaft und letzten Endes zu einem wesentlichen kulturschaffenden, bestimmenden Element. Das Mittelalter brachte das Sachbuch in der Jagd nicht als gelegentliche Ausnahme, wie dies schon in der Antike der Fall war, sondern in einer bis dahin nicht bekannten Fülle. Durch den vom Adel eingebrachten zeitlichen wie materiellen Aufwand für die Jagd kam es zu einer ganz erheblichen Vertiefung und Erweiterung der Jagdtechniken, dem Gedanken einer nachhaltigen, ethisch fundierten Hege, deren Legitimation sich nicht in der „Produktion“ eines möglichst hohen Wildbestandes erschöpft, wie dies beispielsweise in den Jagdgärten des alten China der Fall war. Die erstmalige Einführung von fest umrissenen und konsequent gehandhabten Schonzeiten ist ein beredtes Zeugnis für den Wandel im Verständnis der Jagd. Schonzeiten waren noch zur Zeit des freien Tierfanges unbekannt. Sachbuch, Jagdtechnik, Hege, Schonzeit und Waidmannssprache waren und sind das lebendige Vermächtnis der mittelalterlichen Jagd – bis in unsere Gegenwart.