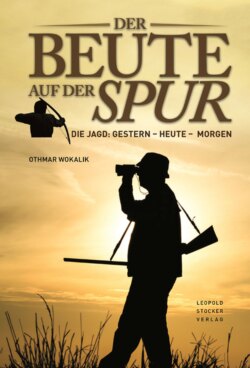Читать книгу Der Beute auf der Spur - Othmar Wokalik - Страница 24
ОглавлениеJagdkapitularien
Die Kapitularien des Königs waren das juristische Aggregat, mit dessen Hilfe das öffentliche Leben geregelt wurde. Zu den bekanntesten zählen die Capitulare de Villis und die Capitulare de Missis, welche die Bewirtschaftung der Kron- und Kammergüter zum Gegenstand hatten und überdies Anweisungen an die damit Beauftragten, desgleichen jagdlich relevante Bestimmungen enthielten.
Im „Inventar der Kammergüter“ wird unter anderem die Betreuung von Jagdfalken, Sperbern, Adlern sowie Jagdhunden und im Weiteren das Halten von Pfauen, Fasanen, Enten, Tauben, Rebhühnern, Turteltauben und Elstern, desgleichen von Dohlen und Staren angeordnet. Auch eine fachlich determinierte Unterscheidung der Jägerschaft findet sich in diesen Kapitularien; es gab die bersarii für die Hochwildjagd, die beverarici für die Wasserjagd auf Biber und Otter sowie Falkner und Wolfsjäger.
Die Jagdkapitularien Karls des Großen waren Ausdruck der Bedeutung, die er der Jagd beigemessen hat. Er übte sie seit seiner Jugend und bis ins Alter von 72 Jahren aus. Den erhaltenen Aufzeichnungen über seine Jagdausflüge und Jagdaufenthalte können wir unter anderem folgende Beispiele entnehmen:
Im Jahre 802 hielt sich der König auf Rot- und Schwarzwildjagd in den Ardennen auf; im Jahre 803 jagte er im Hyrkanischen Wald Auerochsen. Im Jahre 804 nahm er von Ende September bis Anfang November an einer Vielzahl von Rotwildjagden in den Ardennen teil. Vom Juli 805 bis zum Herbst desselben Jahres fanden „zusammenhängende Jagden“ statt, die sich von Aachen über Didenhofen bis nach Metz und von dort in die Vogesen erstreckten. Der König nahm an all diesen Jagden teil. In den Ardennen wurde er bei einer Wisentjagd von einem Stier verletzt, wobei Hose und Schuhe, wie der Bericht detailliert festhält, völlig zerrissen wurden.
Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen mit einem Falken. Aus seinem Buch De arte venandi cum avibus (Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen; Manfred-Handschrift, Biblioteca Vaticana, Pal. lat 1071), spätes 13. Jahrhundert
Über die Jagden in seinem Lieblingsrevier, dem Jagdpark Brühl in der Nähe von Aachen, der Residenz des Königs, sind uns Berichte mit ausführlichen Schilderungen des Geschehens überliefert; sie sind, dem Stil der Zeit entsprechend, nach antikem Vorbild verfasst, zum Ruhme des Königs, aber doch auch mit einer anschaulichen Wiedergabe des tatsächlichen Verlaufes.
Sehr bildhaft wird das Treiben der Jagdgehilfen, das Wiehern der Pferde, das Bellen der Hunde und das laute Rufen der Treiber geschildert. Der Jagdzug mit dem König an der Spitze verließ die Residenz unter lautem Trompetenklang. Von Karl dem Großen wird berichtet, dass er manche adelige Jagdkumpane ob ihrer Eitelkeit bestraft habe, indem er sie während der Jagd durch dichtestes Gestrüpp führte, mit der Folge, dass sie in zerrissenen Gewändern heimkehrten.
Den Aufzeichnungen über die Jagden der Karolingerzeit, vor allem der Parkjagden Karls, die an den Fürstenhöfen Europas noch bis ins 18. Jahrhundert in gleicher Weise praktiziert wurden, ist folgendes Prozedere zu entnehmen: es handelte sich dabei um eine eingestellte Jagd auf Schwarzwild; im Revier angelangt, wurden die Hunde, schwere Saupacker, geschnallt und in die Dickung gewiesen. Die Schar der berittenen Jäger umstellte das Holz. Die unberittenen Jagdhelfer hatten Speere mit Eisenspitzen und vierfach gesäumte Netze zur Hand. Endlich, so berichtet die Chronik, wurde im Tal ein Keiler hochgemacht. Nicht alle Hunde hatten die Fährte aufgenommen, nur einige Packer hetzen ihm nach. Während Jäger und Sauhunde dem Wild folgten, versuchte das wehrhafte Schwein zu entkommen, wurde aber endlich auf einer Bergkuppe gestellt. Wirbelnd flogen die Hunde, getroffen vom Schlag des Keilers, durch die Luft. Inzwischen hatten die Jäger den Keiler gestellt. Der König selbst aber war es, der ihn sodann mit dem Schwert abfing. Unzählige Rotten von Sauen waren die Beute des Tages, heißt es. Die Strecke wurde vom König an das Gefolge verteilt. Danach versammelte sich die Jagdgesellschaft auf einem schattigen Platz zum Jagdmahl. Auf diesem Platz in der Nähe einer Quelle wurden geschmückte Zelte aufgestellt, in denen das Mahl eingenommen und „Falerner Wein“ kredenzt wurde. Spät nach Sonnenuntergang suchten die müden Jäger sodann schlaftrunken am Boden Ruhe.
Vom freien Tierfang zum Feudalsystem
Mit den Karolingern bekam das Forstwesen weiteren Auftrieb. Die Grundlage der königlichen Hausmacht war letztlich der enorme Grundbesitz der Karolinger. Das Jagdrecht wurde grundsätzlich modifiziert, die Bannbezirke wurden weiter ausgedehnt, Hand in Hand mit der Entwicklung des Lehnswesens.
Ursprünglich waren Jagd und Fischfang mindestens in den Markgenossenschaften westgermanischer Stämme frei. Der „Tierfang“ stand dort jedem Waffenträger zu. Der König hatte bis zum 6. Jahrhundert keine Sonderstellung in Ausübung der Jagd; es gab auch keine Jagdverbote oder Schonzeiten im germanischen Volksrecht. Der Ausdruck Forst (forestis) findet sich erstmals in einer Urkunde aus dem Jahr 648, die die königlichen Wälder in den Ardennen betrifft. Über die Auslegung des Wortes „Forst“ (forestis, forest, forre) gibt es unzählige literarische Deutungsversuche und Hypothesen. Nach Lindner konnte jede Art von Landschaft, also Wüstungen, Kulturland, Wald, Felder oder Gewässer, zum „Forst“ erklärt werden. Durch den Eigentumsanspruch des Herrschers auf den gesamten herrenlosen Grund und Boden entstanden im 8. und 9. Jahrhundert die großen königlichen Waldbesitzungen, deren Wildbestand durch den „Forstbann“ geschützt war und ausschließlich durch den König bejagt werden durfte.
Erst die Schaffung dieser großen und zusammenhängenden Jagdreviere, die nicht betreten werden durften (königlicher Wildbann), machte die Abhaltung prunkhafter Hofjagden möglich, die den Mittelpunkt des jagdlichen Geschehens darstellten. In den Jagdkapitularien Karls des Großen wurden Strafen für die Übertretung des Königsbannes in den Forsten vorgesehen; die Strafe betrug – wie beim Friedensbann, dem Verordnungsbann und dem Verwaltungsbann – 60 Schilling. Wie rigoros diese Sanktion war, lässt sich daran ermessen, dass eine Kuh oder eine Stute um drei, ein Hengst um sechs Schilling zu haben war.
Behütete Kostbarkeiten
Eine Schonzeit für Wild ist – wie schon im frühgermanischen Volksrecht – auch den Jagdkapitularien Karls des Großen nicht zu entnehmen. Anhand überlieferter Streitfälle ist jedoch anzunehmen, dass dem Wald ein gewisser Schutz zuteilwurde. In den Aufzeichnungen über einen Streit zwischen dem Kloster St. Gallen und Bauern wird davon berichtet, dass Letztere von den Förstern des Klosters ermahnt wurden, bei der Waldnutzung, also dem Holzschlagen, dem Viehweiden und Schweinemästen nicht maßlos Eichen zu fällen; die Bauern würden damit sich und das Kloster schädigen.
Ein jagd- und kunsthistorisch bedeutsames, für das Mittelalter geradezu prototypisches und aus heutiger Sicht als Kostbarkeit gehandeltes Jagdgerät war der sogenannte Olifant, eine Bezeichnung, die aus dem altfranzösischen Sprachschatz herrührt und so viel wie „Elefant“ bedeutet. Dieser „Elefant“ war ein elfenbeinernes Signalhorn, das höchstwahrscheinlich aus dem byzantinischen Kulturkreis übernommen wurde. Das Führen des Elfenbeinhornes war dem Hochadel als Ausdruck besonderer Hoheit und Würde vorbehalten. Gefertigt war es aus dem Stoßzahn eines Elefanten und zumeist reichlichst mit Jagd- und Kampfszenen, Beschlägen aus Gold und – in den Gehängen – mit Edelsteinschmuck verziert. Es wurde während des gesamten Mittelalters als Signalhorn für Jäger und Hunde eingesetzt und soll der Überlieferung nach weit zu hören gewesen sein, wiewohl nur einige wenige Töne geblasen werden konnten. Des Sagenkreises zufolge, der Karl den Großen umgibt, stammt sein Olifant aus dem Besitz des bekanntesten seiner zwölf Paladine, nämlich Roland, der sein Neffe gewesen sein soll; Roland gilt als der Held des bekanntesten altfranzösischen Chansons, des „Chanson de Geste“, dem „Rolandslied“. Der Olifant Karls des Großen ist derzeit eine wohl behütete Kostbarkeit des Aachener Domschatzes. Berichtet wird, dass Karl den Olifant von Harun al-Raschid als Geschenk erhalten haben soll. Weitere Olifanten finden sich an und ab in Jagdsammlungen, in den Schatzkammern der großen Kathedralen, gelegentlich in den großen Museen.
Exkurs: Der heilige Hubertus
Der Geist weht, wo er will, sagt die Schrift, und so fiel die Geburtsstunde des hl. Hubertus ausgerechnet in eine Zeit der harten Auseinandersetzungen um die Jagd; das legendäre Erlebnis mit einem Hirsch, dem der hl. Eustachius seine Bekehrung verdankte, wurde im 16. Jahrhundert auf Hubertus übertragen.
Hubertus wurde als Sohn Bertrands von Toulouse, Herzog von Aquitanien und Verwandter des Hausmeiers Pippin der Mittlere, um 705 n. Chr. geboren und noch als Jüngling vom Burgunderherzog Theuderich III. zum Pfalzgrafen erhoben. Der Tod seiner Frau bei der Niederkunft ihres ersten Kindes hatte zur Folge, dass sich Hubertus weltlichen Vergnügungen und dabei besonders seiner Jagdleidenschaft vollständig überließ, die zuallererst dem Hochwild galt. Als er eines Tages in den weiten Wäldern der Ardennen – und hier beginnt der legendäre Teil der Überlieferung – an einem Karfreitag jagte, stand er plötzlich einem kapitalen Hirsch gegenüber. Im Begriff, seine Armbrust zielend auf den Hirsch zu richten, nahm er zwischen den Geweihstangen des Hirsches ein leuchtendes Kreuz wahr. Betroffen sank er in die Knie und unterließ den Schuss. Von da an beschloss er, sein Leben zu ändern, verzichtete auf alle Ämter und schenkte sein Vermögen den Armen; er zog sich als Einsiedler in die Einsamkeit der Ardennen zurück. Nach sieben Jahren wurde er in dieser Einsamkeit aufgespürt und nach Maastricht gebracht. Unter dem Einfluss des Bischofs Lambert zum Priester geweiht, trat er nach dessen Ermordung nach heftigem Sträuben dessen Nachfolge im Bischofsamt an. Alles dies ist historisch erwiesen – und auch, dass er als Bischof vor allem in seinem vormaligen Jagdgebiet missionierte und zu Ehren seines Mentors Bischof Lambert in seiner neuen Bischofsstadt, der späteren Stadt Lüttich, ein prächtiges Gotteshaus errichten ließ. Hubertus verstarb im Jahre 727 als rastlos tätiger Missionar unweit von Brüssel; wurde zunächst in Lüttich beigesetzt und in der Folge in das Kloster St. Hubertus von Audain/Namur überführt. Das Kloster wurde während der Reformationszeit aufgehoben; seit damals sind die Reliquien dieses Heiligen verschollen.