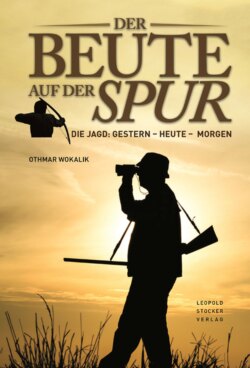Читать книгу Der Beute auf der Spur - Othmar Wokalik - Страница 27
Der Beginn der europäischen Beizjagd und ihre Entwicklung
ОглавлениеWill man dem Jagdwesen des Mittelalters gerecht werden, dann ist es unabdingbar, sich mit dem „beizzen“ (= beißen machen), wie die Jagd mit dem Greifvogel althochdeutsch genannt wurde, vertraut zu machen. Die Beizjagd war im Mittelalter außerordentlich beliebt und wird auch heute noch in den Steppenländern Asiens und Afrikas in einem Ausmaß gepflegt, das weit über die Bedeutung dieser Jagd im europäischen Raum hinausgeht. Sie ist kein Kind europäischer Jagdkultur; die Beizjagd fand ihren Weg in unsere Breiten erst durch die vom Ende des 11. bis zum Ende des 13. Jahrhundert währenden Kreuzzüge. Ihre eigentliche Heimat ist Asien. Die bislang ältesten Quellen, in denen über die Beizjagd berichtet wird, stammen aus der Zeit um 689 v. Chr. und erzählen uns von der Beize Wen-Wangs, des Königs des altchinesischen Staates Chu (689–677 v. Chr.), der am See Tong-Ting in der Provinz Human große Beizjagden veranstaltet hat. In Japan wurde die Beizjagd vom 16. Kaiser, Mintoku, im Jahre 335 eingeführt. Dabei kamen bereits 43 verschiedene Arten von Beizvögeln zur Anwendung. Nach der Überlieferung waren es fünf bekannte japanische Großfamilien, welche die Ausbildungsregeln entsprechend der traditionellen Lehre festgesetzt und praktiziert haben. Auch in Europa wurde die Beizjagd nach ihrem Bekanntwerden mehr und mehr betrieben; sie galt, weil vorwiegend zu Pferd ausgeübt, als ritterlicher Sport, der vom Adel und auch am Hofe des Kaisers gepflegt wurde. Allenthalben entstanden Falknerhöfe, in denen Anleitung, Zähmung, aber auch das Fangen der Falken sowie deren praktischer Einsatz gelehrt und geübt wurde. Über die Beizjagd in Europa zu berichten, wäre ohne Erwähnung Kaiser Friedrichs II. (1212–1250) unvollständig. Er gilt als einer der kompetentesten Beizjäger; ein Mann von undogmatischem, weitem Geist, der sich nicht nur mit antiker und arabischer Philosophie und Naturlehre beschäftigte. Er verfasste aufgrund eigener Beobachtungen das legendäre Buch „De arte venandi cum avibus“ über die Falkenjagd.
Kaiser Friedrich II., der an den Kreuzzügen teilnahm, hatte die vorderasiatischen Falkenhöfe kennengelernt und wurde einer der leidenschaftlichsten Falkenjäger seiner Zeit. Die Zeichnungen in seinem Buch wurden (vermutlich) von ihm selbst angefertigt. Es ist das erste wissenschaftlich-ornithologische Werk, das zu diesem Thema in Europa verfasst wurde. Die Fachliteratur in Asien ist erheblich älter. Im japanischen Kriegsministerium unterhielt der Kaiser eine selbstständige Sektion für die Falkenjagd; schon damals gab es in Japan eine umfangreiche Literatur über die Beizjagd. Kaiser Mintoku selbst war literarisch tätig geworden und verfasste ein einundachtzigbändiges Werk über Falknerei. Bei den Mongolen, traditionell der Beizjagd verpflichtet, gab es zur Zeit Dschingis Khans (ca. 1155–1227) über 7.000 Falknerfamilien, die dem Herrscherhaus unterstellt waren. In alter asiatischer Tradition wurde die Jagd auch bei den Mongolen als „Schule des Krieges“ verstanden; die Falknerei war stets eine Agenda des Kriegsministeriums und die Falkner waren in Jägerregimente gegliedert. Marco Polo, weitgereist, berichtet über die Falkenjagd Asiens in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts:
Sie haben Falken und Gerfalken in großer Zahl, tragen den Vogel auf der rechten Faust, binden ihm einen kleinen Wurfriemen an den Hals, der herabreicht, etwa bis zur Mitte des Leibes. Wenn sie die Vögel auf Raub loslassen, drücken sie Kopf und Körper etwas nach unten.33
Seit ca. 1304 wurde die Beizjagd Persiens zum Vorbild für die abendländische Jagd; sie wurde am persischen Hof in geradezu vollendeter Art und Weise praktiziert. Auch über den Aufwand, der in Asien für die Beizjagd getätigt wurde, berichtet Marco Polo in seinen Reiseberichten. Danach bestand das Jagdlager des chinesischen Kaisers aus mehr als 10.000 Zelten, in denen 2.000 Falkner samt allem Zubehör untergebracht waren. Der Aufwand vor der Türe Europas aber konnte sich gleichfalls sehen lassen. Die osmanischen Sultane Murad I. (1359–1389) und Sultan Bayezid I. (1389–1402) beispielsweise beschäftigten eine Unzahl von Falknern, Falkenjägern und Hundewärtern.
Die Beizjagd, „ein Import“ aus Asien, fiel in Europa auf fruchtbaren Boden. Ausgelöst durch die Handschrift Friedrichs II. wurden vom 15. bis zum 18. Jahrhundert eine Reihe weiterer, der Beizjagd gewidmeter Bücher veröffentlicht; diese verbreitete sich zunehmend und erreichte im Hochmittelalter ihren Höhepunkt. Sie wurde nicht allerorten gut geheißen. Schon die „Lex Ribuaria“ (um 630 oder später) verbot den Fang von zur Beizjagd geeigneten Vögeln.
Das Original des Buches Kaiser Friedrichs II. mit seinen Hunderten von Miniaturen ist verloren gegangen. Lediglich eine Teilabschrift aus der Mitte des 13. Jahrhunderts gelangte über Umwege in die Hände des Herzogs Maximilian I. von Bayern (1573–1651), der sie 1623 dem Vatikan als Geschenk überließ, wo sie heute noch aufbewahrt wird. Die erste gedruckte Ausgabe des Werkes stammt aus dem Jahre 1596.
1968 erschien sie als vollständige Faksimileausgabe. Das älteste der zahlreichen Lehr- und Jagdbücher, das sowohl die Beiz- wie auch die herkömmliche Jagd behandelt, erschien 1531 in Augsburg und trägt den Titel „Mejsterliche stuck von Bayssen und Jagen“. Von der Originalausgabe ist lediglich ein Exemplar vorhanden.
Unter den Autoren von Büchern über die Beizjagd finden sich außer Friedrich II. noch andere berühmte Namen; unter anderem Albertus Magnus (Albert der Große), Graf von Bollstädt, Dominikaner, scholastischer Gelehrter an der Universität Paris und Lehrer des Thomas von Aquin, der als der vielseitigste und produktivste Gelehrte des 13. Jahrhunderts gilt.
Albertus Magnus’ Buch über die Beizjagd trägt den Titel „Von den Falken und Habichten“. Zu nennen wären im deutschen Sprachraum noch Johann Wolf, in Frankreich Charles d’Arcussia, Jean de Franchieres oder Artelouche de Alagona. Die umfangreiche französische Literatur über die Beizjagd wurde großteils auch ins Deutsche übersetzt.
Die jagdhistorische Überlieferung zeigt, dass das Jagdgeschehen im ausgehenden Mittelalter vorwiegend von der Beizjagd bestimmt war. Selbst die Damen frönten dieser Jagd mit großer Leidenschaft; so auch Königin Elisabeth I. von England, Gegenspielerin von Maria Stuart. Ihr „Oberfalkenmeister“ war tatsächlich eine Meisterin, nämlich Mary von Canterbury.
Das Leit- und Idealbild vom Falkner, wie es damals gesehen wurde, finden wir unter anderem im „Neuw Jagd- und Weydwerk“ aus dem Jahre 1582; es heißt dort, dass der Falkner
gerade, freundlich, sanftmütig, holdselig und von vielen anderen guten, lieblichen Gebärden und Sitten sein muss. Er hat mutig, freundlich und zum Falkenweidwerk und Beizen überaus trefflich gute Lust haben.
Angemahnt wird überdies, dass dann, wenn der Falke untätig sei, der Falkner nicht zornig werden, und ihn (den Falken) darob übel anschreien, schelten, ihn etwa zucken, stoßen oder schlagen dürfe, sondern fein, sanftmütig und geduldig sein möge, den Fehler des Falken aber mithilfe von sittsamer und bescheidener Behandlung wieder gutmachen und ihn fein ordentlich und meisterlich abrichten müsse. Der Falkner soll arbeitsam sein, keine Mühe und Arbeit bei Tag und Nacht scheuen, immerdar an seine Falken denken; weder Wind noch Wetter, Hitze oder Kälte dürften seine Arbeitsfreudigkeit beeinflussen.
Der Wanderfalke (Falco peregrinus) war der häufigste Begleiter des Beizjägers; am meisten geschätzt wurden aber die Island-, Grönland- und Gerfalken. Es entwickelte sich ein schwunghafter Handel, besonders mit dem weißen Jagdfalken aus Grönland, der zur beliebtesten Handelsware, vorwiegend der dänischen Falkenjäger, wurde. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich der Handel mit diesem Vogel zur bedeutendsten Einnahmequelle Grönlands. Ein Zentrum des Falkenhandels war der Sitz des Johanniterordens auf der Insel Malta. Wie bei vielen zügellosen Eingriffen in die Natur kam es auch hier zu einem rapiden Schwund dieser Spezies im ausgehenden Mittelalter.
Der damalige Hauptlieferant von Jagdfalken war die 1396 gegründete Falkenschule des Deutschen Ritterordens in Marienburg; allein für das Jahr 1401 sind folgende Abnehmer überliefert: der König von Böhmen, der König von Polen, der Kurfürst vom Rhein, der Markgraf von Meißen, der Burggraf von Nürnberg, der Graf von Württemberg und der Herzog und die Herzogin von Österreich. Hierzu kamen 1402 der Bischof von Freising, der Herzog Luitpold, der Herzog von Sachsen, der Erzbischof von Mainz und der Herzog Wilhelm von Österreich sowie 1405 im Weiteren die Herzöge von Cleve (Holland), Sachsen, Geldern, Köln und Trier, die allesamt Jagdfalken als Staatsgeschenke erhielten. Im Jahre 1408 ging eine Lieferung von 80 Falken an den päpstlichen Hof, eine weitere an den König von Portugal, deren Ausmaß aber nicht bekannt ist. An den kaiserlichen Hof in Wien wurden 14 Vögel geliefert; im Jahre 1509 waren es 12 Beizvögel; 8 erhielt der päpstliche Stuhl; an die Könige von Frankreich, England und Portugal kamen je 6, an den Herzog von Sachsen 4 Falken. Während der Jahre 1533–1569 wurden allein vom Hochmeister des Deutschen Ordens 1818 Jagdfalken an diverse Fürsten und Herren verschenkt. Der Kurfürst von Brandenburg lieferte im Jahr 1650 dem König von Frankreich 12, dem kaiserlichen Hof in Wien 18, dem König von England einen, dem Prinzen von England 18 und dem Herzog Moritz von Sachsen 12 Falken.
Der personelle Aufwand für die Pflege und Haltung von Falken war beträchtlich. Am Hofe des französischen Königs Franz I. (1494–1547) wurden an die 300 Beizvögel gehalten, für deren Betreuung der „Grand Fauconnier de France“, René de Cossé de Brissac, verantwortlich war. Unter der Fuchtel dieses Oberfalkenmeisters standen 15 Edelleute und 50 Falkenmeister, neben zahllosen anderen Bediensteten. Der Oberfalkenmeister war aber nicht nur für die Falken des französischen Hofes zuständig, er war im Zusammenhang mit dem Falkenhandel auch fiskalischen Aufgaben betraut, hatte das alleinige Recht des Falkenverkaufes in Frankreich und musste dafür Sorge tragen, dass für jeden eingeführten Falken auch ein entsprechender Zoll eingehoben wurde.
Man kann sagen, dass die Jagd mit dem Falken im Laufe des Mittelalters die gleiche Bedeutung erlangte wie die Jagd mit der Waffe. Sie wurde den jahreszeitlichen Bedingungen entsprechend ausgeübt und erreichte im Monat März ihren Höhepunkt. Erst mit dem Aufkommen der Feuerwaffen und des Schrotes ging das Interesse an dieser Jagd nahezu vollkommen verloren, zumal die Beizjagd ein sehr kostspieliges Vergnügen war. Unserer Zeit blieb es vorbehalten, sich ihrer wieder zu besinnen und den überlieferten Jagdgebräuchen entsprechend auszuüben. Aufzeichnungen des Markgrafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Anzbach-Bayreuth aus der Mitte des 18. Jahrhunderts vermitteln eine Vorstellung von der Effizienz dieser Jagdart; er brachte mit seinen Beizvögeln innerhalb von 25 Jahren insgesamt 37.238 Stück Wild zur Strecke, davon insgesamt 14.087 Rebhühner, 5.059 Hasen, 6.563 Krähen, 4.174 Reiher und 1.763 Milane. Der Stellenwert, den die Beize im Mittelalter erreicht hatte, führte zu „Konfrontationen“ an den europäischen Höfen. Im Frühjahr rückte die konservative Jägerschaft, grün gekleidet, mit lautem Hörnerschall in den Hof ein und „überfiel“ unter Verwendung grüner Zweige die Falkner; der Höhepunkt dieses Treibens fiel jeweils auf den 13. Mai, den Beginn der Falkenmauser. Ab diesem Zeitpunkt ruhte die Beizjagd; es begann die Jagd auf den Hirsch, die bis zum 14. September dauerte. Danach gehörte der Schlosshof wieder den Falknern und es war die Reihe an den „Konservativen“, ihr Jagdgerät in den Kasten und die Hunde in den Zwinger zu sperren.
Eine ob ihrer Prägnanz und Kürze bestechende Charakterisierung des Falkens und des Beizjägers finden wir bei Ortega y Gasset:
Nachdem sich die Eignung des Hundes für die Jagd erwiesen hatte, war es naheliegend, das Verfahren zu verallgemeinern. Tatsächlich versuchte der Mensch auch, andere Tiere in seine jagdliche Betätigung einzubeziehen. Erfolg hatte er jedoch nur in sehr beschränktem und kümmerlichem Umfang bei den Frettchen und in höherer und rühmlicherer Form mit den Raubvögeln. Die Jagd mit Hunden findet ihr Gegenstück in der Falkenbeize. Auch der Raubvogel ist von Natur aus ein großer Jäger. Selbstverständlich ist sein Stil von dem des Hundes sehr verschieden. Diese Wappenvögel sind übel gelaunte Herrn, sie sind finster und halten sich abseits wie alte Marquis, ohne dass man zu ihnen in ein engeres Verhältnis kommen könnte. Ihre Zähmung war immer beschränkt. Sie sind und bleiben Raubtiere. Der Vogel ist im Allgemeinen viel zu wenig „intelligent“ und ohne Wandlungsvermögen. Um dies festzustellen braucht man nur die Starrheit seiner Körperform zu betrachten, die aus dem Vogel ein ausdrucksloses geometrisches, hierarchisches Tier macht. Das ändert nichts daran, dass die Raubvögel richtig gesehen, vielleicht die eindrucksvollsten Gestalten der ganzen Tierwelt sind. Der Adlerkopf, flach und gut gekämmt, der nur Hebelansatz für den unerbittlichen Schnabel ist, war immer das Sinnbild der Herrschaft. Das Falkenauge, das ganz Pupille ist, ist das Jägerauge, das wache Auge schlechthin. Der Raubvogel – Habicht, Edelfalke, Geierfalke – ist, wie der echte Aristokrat, düster und hart und ein Jäger.34