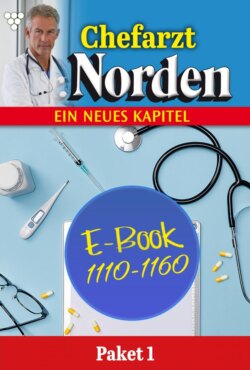Читать книгу Chefarzt Dr. Norden Paket 1 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAls der Notarzt Dr. Matthias Weigand den Privatwagen seines Chefs vor der Ambulanz der Behnisch-Klinik entdeckte, fuhr ihm der Schreck in die Glieder. In Windeseile machte er sich auf den Weg.
»Um Gottes willen, Daniel, was ist passiert?«, rief er schon von Weitem. Er winkte dem Pfleger Jakob, der sich eine leere Liege schnappte und dem Arzt hinaus folgte.
»Keine Sorge!« Daniel stieg aus, eilte um den Wagen herum und öffnete die Tür zum Beifahrersitz. »Fee und den Kindern geht es gut. Ich bringe unsere Nachbarin. Frau Wolter ist im Garten ausgerutscht und gestürzt. Verdacht auf Gehirnerschütterung und Steißbeinprellung.« Um das Hinterteil zu entlasten, hatte Daniel die Rückenlehne so schräg wie möglich gestellt und den Schwimmreifen ihres Enkelsohnes zur Entlastung unter ihr ramponiertes Hinterteil geschoben.
»Wie konnte das passieren?«
»Mein Enkel hat in einem Swimmingpool geplantscht und den halben Garten unter Wasser gesetzt«, antwortete die Patientin. »Ich hatte vergessen, dass kleine Jungen nur Unsinn im Kopf haben.«
Dr. Weigand schnitt eine Grimasse.
»Was wieder einmal beweist, dass das ewige Singleleben doch seine Vorteile hat. Da ich keine Frau und somit keine Kinder habe, werde ich auch niemals Großvater werden. Auf diese Weise bleibt mir zumindest so ein Schicksal erspart.«
»So ist es recht. Immer schön positiv denken«, erwiderte Daniel schmunzelnd, ehe er sich an seine Nachbarin wendete. »Frau Wolter, wir heben Sie jetzt auf die Liege. Das kann ein bisschen weh tun.«
»Habe ich eine Wahl?«, fragte sie zurück. Trotz der Schmerzen versuchte sie ein Lächeln.
»Im Wagen können Sie nicht bleiben. Also nein.« Dr. Norden erwiderte ihr Lächeln, ehe er sie mit Matthias’ tatkräftiger Unterstützung auf die Liege hob. »Das haben Sie sehr gut gemacht.«
»Vielen Dank!« Tapfer blinzelte Anna die Tränen fort, die ihr der Schmerz in die Augen trieb. Oder waren es die Sorgen, die alles so schlimm machten? »Ich frage mich nur, was aus Paul werden soll, wenn ich in der Klinik bleiben muss. Seine Mutter hat ihn bei mir abgeliefert, weil sie einen Auftrag im Ausland hat. Der Kontakt zu seinem Vater ist schon vor Jahren abgerissen.«
Sie waren auf dem Weg in die Klinik. Die Glastüren vor der Notaufnahme schoben sich lautlos vor ihnen auf.
»Machen Sie sich keine Sorgen. Dési hat ja noch Ferien und kann sich um ihn kümmern.«
»Sie weiß aber schon, dass er jede Menge Flausen im Kopf hat?«, fragte Anna skeptisch nach.
»Keine Angst. Wie Sie wissen, ist unsere jüngste Tochter mit vier Geschwistern gesegnet und dementsprechend mit allen Wassern gewaschen. Ich bin mir ganz sicher, dass sie mit dem kleinen Räuber fertig wird.«
Erleichtert atmete Anna Wolters durch und entspannte sich ein wenig.
»Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.«
»Vielleicht ist das gar nicht nötig.« Sie hatten die Radiologie erreicht. Fürs Erste wurde Daniel Norden nicht mehr gebraucht, und er blieb vor der Tür stehen. »Je nach Schwere Ihrer Verletzungen können Sie vielleicht morgen schon wieder nach Hause gehen.« Er versprach ihr noch, nach Erhalt der Aufnahmen sofort bei ihr vorbeizusehen, und sah dem Pfleger nach, wie er mit der Liege in der Radiologie verschwand. Dann machte er sich auf den Weg in sein Büro. Auch wenn er an diesem Samstag eigentlich frei hatte, konnte er es sich nicht verkneifen, nach dem Rechten zu sehen.
*
Dr. Adrian Wiesenstein saß auf der Terrasse seiner Altbauwohnung und starrte blicklos vor sich hin. Hin und wieder trank er einen Schluck aus der Tasse, die er in den Händen hielt. Er bemerkte nicht, dass der Kaffee längst kalt war. Er hörte auch nicht die Schritte, unter denen das altehrwürdige Parkett in der Wohnung knarrte. Er erwachte erst aus seiner Versunkenheit, als er die Stimme seines Sohnes hörte.
»Hallo, Papa.«
Adrian drehte sich nicht um. Er beobachtete einen Vogel, der in einer Schale in der Ecke des Gartens badete. Immer wieder tauchte er mit dem Kopf voran unter, um im nächsten Augenblick fröhlich mit den Flügeln zu flattern, dass das Wasser zu allen Seiten spritzte.
»Ich soll dich von ihr grüßen«, murmelte er, als er seinen Sohn hinter sich hörte.
Schimpfend flog der Vogel davon.
»War Dési hier?«, fragte Joshua hoffnungsvoll.
»Ach, sie weiß also auch schon, dass du mit deiner Mutter nach Zürich gehst? Was hat sie dazu gesagt?«
Joshua ließ sich auf zweiten Stuhl fallen.
»Du weißt doch, wie die Frauen sind.« Er zuckte mit den Schultern. »Ist ja auch egal.«
»Natürlich«, bestätigte Adrian sarkastisch. »Genauso, wie es mir egal ist, dass deine Mutter nach acht Jahren so mir nichts, dir nichts auftaucht und dich einfach mitnimmt.«
Betreten sah Joshua zur Seite. Er wusste nicht, was er darauf sagen sollte.
»Schon okay«, winkte sein Vater ab und seufzte. »Mach dir keine Gedanken um mich. Ich komme schon klar. Und was Dési angeht: Es ist eh nicht so gut, sich so früh festzulegen. Ich bin das beste Beispiel dafür. Wäre ich älter gewesen, hätte ich vielleicht erkannt, dass deiner Mutter die Schauspielerei wichtiger ist als alles andere. Aber so …« Das Ende des Satzes blieb unausgesprochen.
Joshua wusste auch so, was sein Vater sagen wollte.
»Bestimmt ist es besser so.«
Jedes seiner Worte schnitt Adrian tief ins Herz.
»Dann ist deine Entscheidung also endgültig?«, fragte er mit Grabessstimme.
»O Mann, Dad, mach’s mir doch nicht so schwer«, brauste Joshu auf. »Warum willst du nicht verstehen, dass das die Chance ist, von der ich schon so lange geträumt habe?« Er sprang auf und begann, vor seinem Vater auf und ab zu gehen. »Richtigen Schauspielunterricht zu bekommen. Gute Kontakte zu knüpfen. Paola kann mir Rollen verschaffen.« Er blieb vor Adrian stehen und sah auf ihn hinab. »Ich bin so schlecht in der Schule, dass ich niemals in deine Fußstapfen treten werde. Denkst du, es macht Spaß, dich immer nur zu enttäuschen? Ich bin nun mal nicht zum Arzt, sondern zum Schauspieler geboren.« Schwer atmend hielt Joshua inne.
Adrian sah verwundert zu im hoch.
»Du bist keine Enttäuschung. Auch wenn du kein Arzt wirst. Aber das habe ich dir ja schon hundert Mal gesagt.«
Joshua presste die Lippen aufeinander und wich dem Blick seines Vaters aus.
Auch Adrian stand langsam auf. Obwohl er im besten Mannesalter war, fühlte er sich wie ein Greis.
»Aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass die Bindung zwischen Mutter und Kind stärker ist als alles andere auf dieser Welt.« Er lauschte dem Nachhall seiner Worte und nickte, ehe er im Wohnzimmer verschwand und seinen einzigen Sohn allein auf der Terrasse zurückließ.
*
»Brüche im Steißbein sind leider wirklich oft schmerzhaft und langwierig«, erklärte der Pfleger Jakob, während er Anna Wolters Bett von der Radiologie auf die Station brachte.
»Muss ich denn operiert werden?«, fragte sie ängstlich.
»Ich habe zwar eine Meinung dazu, bin aber leider nur der Krankenpfleger«, erwiderte er. »Für weiterführende Hinweise wenden Sie sich bitte an den Arzt Ihres Vertrauens.«
Trotz ihrer Schmerzen musste Anna lachen.
»Und was, wenn ich Ihnen genauso vertraue?«
Voller Stolz reckte Jakob die Brust heraus.
»In diesem Fall verrate ich Ihnen, dass bei einer Verletzung wie der Ihren prinzipiell zunächst konservativ behandelt wird.« Es kam nicht oft vor, dass das Pflegepersonal um Rat gefragt wurde. Umso geschmeichelter fühlte sich Jakob in diesem Moment. »Konsequente körperliche Schonung und ausreichend entzündungshemmende Medikamente in Kombination mit Krankengymnastik leisten einen wichtigen Beitrag zur Genesung.« Er war am Ziel angelangt und wollte das Bett rückwärts ins Krankenzimmer fahren. Ein Stoß in die Seite ließ ihn taumeln. Er fuhr herum und sah, wie der Kinderchirurg Dr. Lammers weitereilte.
»Können Sie nicht aufpassen?«, schimpfte Lammers vor sich hin.
»Hier gilt die Straßenverkehrsordnung!«, rief Jakob dem unbeliebten, aber begnadeten Kinderchirurgen nach, als die Assistenzärztin Sophie Petzold um die Ecke bog.
»Einen wunderschönen guten Tag, die Herrschaften!«, grüßte sie gut gelaunt.
»Das sollten Sie mal dem Kollegen Lammers sagen«, brummte Jakob und machte Anstalten, das Bett ins Krankenzimmer zu ziehen.
Sophie dachte nicht lange nach. Sie steckte das Klemmbrett unter den Arm und packte mit an.
»Und Sie sollten sich nicht die Laune von solchen Miesepetern verderben lassen.«
»Die junge Frau hat recht«, mischte sich Anna in das Gespräch ein.
»Leichter gesagt als getan.« Jakob parkte das Bett am Fenster und stellte die Bremse fest. Er fuhr sich mit der Hand über die Augen. »Manchmal ist mein Geld schon sauer verdient. Besonders, wenn ich mir zu den Doppelschichten auch noch so blöde Kommentare anhören muss.«
Sophie musterte ihn besorgt.
»Alles in Ordnung?«
Jakob schüttelte sich wie ein nasser Hund und lächelte schon wieder.
»Alles gut. Es ist nur ein bisschen viel heute.«
Doch die Assistenzärztin blieb hart, was nicht zuletzt seiner Blässe geschuldet war.
»Wenn Sie hier fertig sind, möchte ich Sie sehen.«
»Heißt das, wir haben eine Verabredung?«
»Das heißt, dass Sie einen Termin haben«, gab Sophie Petzold streng zurück. Sie nickte Anna Wolter zu und bedachte den Pfleger mit einem strengen Blick, ehe sie sich wieder auf den Weg machte.
»Eine resolute Frau«, lobte Anna die Assistenzärztin. »Viel selbstbewusster, als wir es früher waren. Das ist wirklich ein Fortschritt.«
»Ich bin mir da nicht so sicher«, erwiderte Jakob zähneknirschend.
Anna lachte.
»Gehen Sie nur. Sie wird Ihnen schon nicht weh tun. Und bitte denken Sie daran, Dr. Norden vorbeizuschicken. Ich muss unbedingt mit ihm besprechen, wie lange ich hierbleiben muss. Wegen meines Enkels, Sie wissen schon.«
Jakob versprach es und machte sich ein paar Minuten später auf den Weg. Er suchte und fand Sophie Petzold in einem der Behandlungszimmer.
»Da sind Sie ja!« Sie deutete auf den Stuhl neben dem Schreibtisch. »Bitte machen Sie schon einmal den Oberarm frei.« Sie holte ein Blutdruckmessgerät aus einer Schublade und legte die Manschette an. »Neunzig zu fünfzig. Das ist eindeutig zu niedrig.«
Jakob wich ihrem Blick aus.
»Ist doch besser als zu hoch.« Er krempelte den Ärmel herunter und wollte wieder aufstehen.
Unbarmherzig drückte Sophie ihn auf den Stuhl zurück.
»Seit wann sind Sie bei der Arbeit?«
Jakob schnitt eine Grimasse.
»Ich wohne quasi in der Klinik.«
»Schon allein deshalb müsste Ihr Blutdruck viel zu hoch sein. Ich würde der Sache gern auf den Grund gehen.«
Sanft aber bestimmt nahm Jakob ihre Hand von seiner Schulter.
»Und ich muss jetzt leider zurück an meine Arbeit. Sonst haben Herr Lauterberg und Frau Amundsen bald gar keinen Blutdruck mehr, und ich habe dafür jede Menge Ärger am Hals.« Er sah sie so treuherzig an, dass Sophie lachen musste.
»Sie sind wohl nie um eine Ausrede verlegen.«
»Glauben Sie mir: Ich täte nichts lieber, als mich in Ihre schlanken, sinnlichen Hände zu begeben. Leider werde ich dafür nicht bezahlt.« Diesmal ließ sich Jakob nicht zurückhalten. Er stand auf, bedankte sich für ihre Mühe und verließ das Zimmer.
Sophie Petzold sah ihm nach. Instinktiv spürte sie, dass Jakob sie angelogen hatte. Doch nicht umsonst lautete ihr Spitzname Frau Ehrgeiz. Sie würde die Wahrheit schon noch aus ihm herauskitzeln. Davon war sie felsenfest überzeugt.
*
»Uno!«, triumphierte Dési. Sie musste nur noch eine Karte ablegen, dann war das Spiel gewonnen.
Mit düsterem Blick starrte der kleine Paul auf die Karten in seiner Hand. Unmöglich, das Ruder noch einmal herumzureißen.
»Ich hab keine Lust mehr!« Der Vierjährige warf seine Karten auf den Gartentisch und sprang auf.
»Komm schon! Das ist doch nur ein Spiel!«, versuchte Dési, ihn zu trösten. »Wo willst du denn hin?« Sie sah ihm nach, wie er über den Rasen hinüber zum Gartenzaun lief.
»Ich will zu meiner Omi.« Er hängte sich an den Holzzaun. Um besser sehen zu können, zog er sich hoch
»Du weißt doch, dass deine Omi im Krankenhaus ist.«
»Wann kommt sie wieder?«
»Das weiß ich noch nicht so genau.« Dési hatte sich zu dem Kleinen gesellt. Um mit ihm auf Augenhöhe zu sein, ging sie neben ihm auf die Knie. »Gefällt es dir hier denn nicht?«
Paul ließ den Zaun los. Er zuckte mit den Schultern.
»Ich will zu meiner Mami!« Seine Unterlippe begann zu zittern.
Allmählich geriet Dési in Panik.
»Ach, Hase, das geht jetzt nicht«, versuchte sie, den Kleinen zu trösten. »Ich mache dir einen Vorschlag: Ich rufe meinen Papa an und frage, ob wir deine Omi besuchen können. Und dann fahren wir zusammen ins Krankenhaus.«
Diese Antwort schien ihn nicht zufrieden zu stellen.
»Ich will zu meiner Mami!«, verlangte er und stampfte mit dem Fuß auf dem Boden auf.
Händeringend suchte Dési nach einem Ausweg, als sie einen Schatten im Augenwinkel bemerkte.
»Mum, Gott sei Dank!«
Auch Fee war erleichtert, ihre Tochter zu sehen.
»Désilein, sei so lieb und mach mir schnell die Haustür auf. Ich habe mal wieder viel zu viel eingekauft«, rief sie vom Gartenweg herüber.
Dési sah rasch hinüber zu Paul.
»Kommst du mit rein?«
Er schüttelte den Kopf.
»Na schön. Dann wartest du hier, ja? Ich bin sofort wieder da.«
Diesmal nickte der Kleine ernsthaft, und Dési spurtete durch das Haus zur Tür.
»Gut, dass du endlich zurück bist«, raunte sie ihrer Mutter zu und nahm ihr eine der beiden Taschen ab, die sie den Gartenweg hinauf geschleppt hatte. »Ich hätte nie gedacht, dass es so anstrengend ist, ein kleines Kind zu beschäftigen. Erzieher wäre definitiv nichts für mich.«
Fee stellte die Tasche im Flur ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Besorgt zog sie eine Augenbraue hoch.
»Habt ihr euch gestritten?«
Nun musste Dési doch lachen.
»Wenn ich ein paar Jahre jünger wäre, hätte ich für nichts garantieren können.« Sie berichtete vom Ende des Uno-Spiels.
»Hättest du Paul nicht gewinnen lassen können?«
»Das ist pädagogisch nicht besonders wertvoll. Hat mir Anneka beigebracht. Und die muss es ja wissen!«
»Wann habt ihr denn über so etwas geredet?« Fee packte die Taschen aus. Sie stellte Joghurt, Milch und Eier in den Kühlschrank, legte das Brot in die Schublade und die Tomaten in die Schale in der Ecke. »Deine Schwester ist seit fast einem Jahr in Neuseeland, um ihr Berufsanerkennungsjahr zu machen.«
Dési schnitt eine Grimasse.
»Das hat sie mir erzählt, bevor sie getürmt ist.«
»Manchmal ist es trotzdem besser, Nachsicht walten zu lassen. Besonders, wenn es sich um so einen sensiblen Fall handelt.« Fee faltete die Stofftasche zusammen. »Apropos Kleiner, wo steckt unser Gast überhaupt?«
»Paul ist draußen im Garten.« Siedend heiß fiel Dési ein, dass sie versprochen hatte, gleich wieder da zu sein. »Ich sehe mal nach, ob er sich inzwischen beruhigt hat.«
Kopfschüttelnd sah Felicitas ihrer jüngsten Tochter nach, ehe sie sich daran machte, die zweite Tasche auszupacken. Kurz darauf hallte Désis Stimme durch den Garten.
»Paul? Pa … aaulll? Wo bist du?«
Fee stutzte. Besorgt ging sie durch die Küche hinüber ins Esszimmer und trat von dort auf die Terrasse.
»Was ist los?«
»Paul ist weg«, stieß Dési aufgeregt hervor und lief hinüber zum Gartenhaus.
Fee sah ihr zu, wie sie die Tür aufriss und in das Durcheinander starrte.
»Was soll das heißen? Weg?«
Händeringend drehte sich Dési um. Sie war den Tränen nahe.
»Ich kann ihn nirgendwo finden.« Sie stürmte an ihrer Mutter vorbei ins Haus und hinauf in den ersten Stock. Dort durchsuchte sie jeden Winkel. Vergeblich. Paul war und blieb unauffindbar. Auch Fees Suche im Erdgeschoss blieb ohne Erfolg.
Schon fühlte auch sie Panik in sich aufsteigen. Doch sie war nicht umsonst Ärztin und an Notsituationen gewöhnt. Als ihre Tochter erneut an ihr vorbeilaufen wollte, hielt sie sie an den Schultern fest.
»In Ordnung. Beruhige dich! Lass uns in Ruhe nachdenken. Wo könnte Paul noch stecken?«
»Er hat vorhin gejammert, dass er zu seiner Omi will«, stieß Dési schluchzend hervor. »Als ich ihm sagte, dass das nicht geht, wollte er heim zur Mama.«
»Verständlich.« Fee ging in den Garten hinaus und sah sich um. Da entdeckte sie es! »Hast du das Gartentor offen gelassen?«
Désis Blicke flogen hinüber zum Tor in der Ecke.
»Nein.«
»Bist du sicher?«
»Ganz sicher!«
Felicitas musste nicht länger darüber nachdenken, was zu tun war.
»Trommel alle Freunde zusammen, die du finden kannst! Schnappt euch eure Fahrräder und macht euch auf die Suche«, wies sie ihre jüngste Tochter an. »Ich rufe inzwischen die Polizei.«
*
Wie angekündigt hatte der Kollege aus der Radiologie Dr. Daniel Norden die Bilder überspielt. Er nahm sich Zeit, sie zu befunden. Als er Klarheit über die Schwere der Verletzung hatte, machte er sich auf den Weg zu seiner Patientin.
Kurz vor Anna Wolters Zimmer klingelte sein Handy.
Daniel überlegte kurz, ob er den Anruf seiner Frau annehmen sollte. In Anbetracht der Tatsache, dass er den freien Samstag wieder einmal in der Klinik verbrachte, entschied er sich dafür.
»Feelein, es dauert wirklich nicht mehr lang …«
Sie unterbrach ihn unwirsch. Gebannt presste Daniel den Apparat ans Ohr und lauschte auf ihre Worte.
»Was sagst du da? Paul ist weg? Ja, ja, natürlich. Nein, das geht leider nicht. Das kann ich Frau Wolter unmöglich verschweigen. Aber mach dir um sie keine Sorgen. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Und bitte halte mich auf dem Laufenden.« Daniel schickte einen Kuss durch den Äther und legte auf.
Sein Herz war schwer, als er Annas Krankenzimmer betrat. Mithilfe einer Spezialvorrichtung hatte sie es einigermaßen bequem im Bett und sah erwartungsvoll zur Tür hinüber.
»Geben Sie sich keine Mühe, mein lieber Nachbar«, warnte sie ihn. »Ich weiß schon, was mir fehlt.«
»Interessant!« Dr. Norden zwang sich ein Lächeln auf die Lippen. »Ich wusste gar nicht, dass Sie über hellseherische Fähigkeiten verfügen.« Um Zeit zu gewinnen, trat er an ihr Bett und maß Puls und Blutdruck.
»Das tue ich auch nicht«, erwiderte Anna. »Der nette Pfleger hat mir schon verraten, dass mein Steißbein angebrochen ist. Er hat mir auch gesagt, dass ich außer Bettruhe, Medikamenten und Krankengymnastik keine Behandlung brauche. Das bedeutet, dass ich ebensogut heimgehen und auf meinen Enkel aufpassen kann.«
»Frau Wolter … «, begann Daniel zögernd.
»Ich weiß, was Sie sagen wollen«, winkte Anna ab. »Dass ich mich nicht bewegen und deshalb nicht auf den Räuber aufpassen kann. Für dieses Problem habe ich mir auch schon eine Lösung überlegt. Ich schlage mein Lager im Wohnzimmer auf und bestelle meine Freundin Petra Lekutat. Sie kann sich tagsüber um Paul kümmern, bis ich wieder halbwegs hergestellt bin.« Sie holt Luft.
Diese günstige Gelegenheit nutzte Daniel.
»Das klingt nach einem schönen Plan, Frau Wolter«, erwiderte er. »Allerdings gibt es ein Problem.«
Anna musterte ihn argwöhnisch.
»Hat dieser Jakob mich etwa angelogen? Ist es doch schlimmer, als er mir gesagt hat?«
»Nein.«
»Was ist es dann?«
Wenn möglich, wurde Daniels Herz noch schwerer.
»Im Augenblick wissen wir leider nicht, wo Ihr Enkel steckt.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Anna mit schief gelegtem Kopf. Ihr Verstand weigerte sich, den Arzt zu verstehen.
»Er war mit Dési im Garten, als meine Frau nach Hause gekommen ist. Fee brauchte Dési kurz, um die Tür zu öffnen und ihr beim Tragen zu helfen. Diese Gelegenheit hat Paul sofort genutzt. Er war wirklich nur ein paar Minuten allein draußen.«
»Oh, mein Gott!« Anna schlug die Hand vor den Mund.
»Selbstverständlich hat meine Frau sofort die Polizei angerufen. Dési ist mit ihren Freunden unterwegs, um Paul zu suchen. Im Anschluss an den Besuch bei Ihnen werde ich mich auch an der Suche beteiligen«, versprach Daniel Norden hoch und heilig. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid es mir tut.«
Zu seiner Verwunderung winkte Anna ab.
»Sie können doch nichts dafür. Paul ist ein schrecklicher Draufgänger und schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe. Daran ist auch meine Tochter schuld. Sie lässt ihm viel zu viel durchgehen.«
»Dann sind Sie uns also nicht böse?«
»Wie könnte ich?« Energisch schüttelte Anna den Kopf. »Weit wird der kleine Satansbraten mit seinen kurzen Beinchen ja nicht gekommen sein.« Ihre Stimme sprach von Angst und Hoffnung. Sie streckte die Hand aus und legte sie auf Daniel Nordens Arm. »Bitte gehen Sie ihn suchen. Ich habe erst wieder Ruhe, wenn er wieder da ist.«
*
So einfach, wie Felicitas sich das vorgestellt hatte, war es nicht. Vergeblich wählte Dési eine Nummer nach der anderen. Doch keiner ihrer Freunde hatte Zeit. Entweder waren sie im Urlaub oder verbrachten den herrlichen Tag am See und hatten das Handy ausgeschaltet. In ihrer Not blieb ihr nur ein Ausweg. Mit klopfendem Herzen schwang sie sich auf das Fahrrad.
»Dési!« Joshuas Miene leuchtete auf, als seine Freundin so unvermutet vor der Tür stand.
»Koffer schon gepackt?«, fragte sie spitz.
»Deshalb bist du doch sicher nicht hier.«
»Stimmt auffallend. Ich brauche deine Hilfe.« Niemals hätte sie zugegeben, dass sein Anblick ihr trauriges Herz in schreckliche Aufruhr versetzte. Um sich wenigstens den Anschein von Stärke zu geben, stemmte sie die Hände in die Hüften. »Stehst du wenigstens dafür noch zur Verfügung?«
Cool aussehen, das konnte Joshua auch. Er steckte die Hände in die Hosentaschen.
»Kommt darauf an, worum es geht.«
»Erinnerst du dich an Paul?«
»Der Kleine, der bei eurer Nachbarin zu Besuch ist?« Joshua hatte ihn vor ein paar Tagen gesehen, wie er wie ein Wirbelwind mit ausgestreckten Armen durch den Garten gesaust war und Flugzeuggeräusche gemacht hatte.
Dési nickte.
»Ich sollte heute auf ihn aufpassen. Als Mum von der Arbeit nach Hause kam, ist er dummerweise in einem unbeobachteten Moment aus dem Garten entwischt.« Alle Lässigkeit fiel von ihr ab. »Mum hat schon die Polizei gerufen. Ich habe versprochen, mich mit dem Fahrrad auf die Suche zu machen. Kommst du mit?«
»Na klar«, sagte Joshua ohne Zögern zu. »Ich bin mit Dési unterwegs«, rief er seinem Vater zu.
Kurz darauf machten sich die beiden auf den Weg. Mit den Fahrrädern durchkämmten sie jede Ecke in der Umgebung. Sie suchten Parks und das nahe Einkaufszentrum ab, fuhren an jedem Spielplatz in der Nähe vorbei und sahen in jedem Hausflur nach. Vergeblich. An einer Parkbank machten sie schließlich Halt. Ihre Wangen leuchteten vor Anstrengung.
»Nichts. Keine Spur«, stellte Joshua deprimiert fest.
»Er kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben.« Dési war der Verzweiflung nahe.
Ihr Anblick schnitt Joshua so sehr ins Herz, dass er nicht anders konnte, als sie in die Arme zu nehmen.
Sie legte den Kopf an seine Schulter und genoss die tröstliche Wärme seiner Haut, atmete tief seinen vertrauten Duft. Für einen Moment war der Gedanke an Paul wie fortgewischt.
»Ich weiß, dass es blöd von mir ist«, murmelte sie. »Wir sind noch so jung und sollten nicht auf etwas verzichten, was uns wichtig ist.« Das waren die Worte ihrer Mutter gewesen, als sie ihr von Joshuas Plänen erzählt hatte. »Allein schon wegen der Verantwortung. Trotzdem finde ich es blöd, dass du mit deiner Mutter nach Zürich gehst. Was soll denn dann aus uns werden?«
Joshua legte die Wange in ihr seidenweiches Haar.
»Hmmm.«
»Ich verstehe es einfach nicht!«, fuhr Dési fort. Jetzt, da das Schweigen gebrochen war, gab es kein Halten mehr. »Vor acht Jahren hat Paola dich und deinen Vater einfach so sitzen gelassen. Seitdem hattet ihr kaum Kontakt. Ihre Karriere war ihr wichtiger als ihre Familie. Und jetzt muss sie nur ein Mal mit dem Finger schnippen, und schon hast du ihr alles verziehen.«
»So ist das nicht«, widersprach Joshua. »Ich habe ihr nicht alles verziehen. Aber es ist schön mit ihr. Wir sind uns so ähnlich. Ich habe das Gefühl, dass sie mich versteht. Außerdem haben wir viel Spaß zusammen.«
Dési schob ihn ein Stück von sich und sah ihn forschend an.
»Ist das genug?«
Joshua biss sich auf die Lippe. Tief in seinem Inneren wusste er, dass sie recht hatte.
»Bevor wir hier Schicksalsfragen erörtern, sollten wir uns lieber wieder auf die Suche nach Paul machen«, lenkte er schnell vom Thema ab. »Wo würdest du hingehen, wenn du so klein wärst und Heimweh hättest?«
Sein Plan ging auf. Dési legte den Kopf schief und dachte nach.
»Er wollte zu seiner Mami.«
»Und wie sind er und seine Mami nach München gekommen?«
»Mit dem Auto.« Désirée hatte keine Ahnung, worauf ihr Freund hinaus wollte.
Blitzschnell zählte Joshua eins und eins zusammen. »Deine Mum ist auch mit dem Auto nach Hause gekommen, oder?«
Endlich ging ihr ein Licht auf.
»Du meinst, er ist in Mums Wagen?«
»Kann doch sein, oder? Ich war selbst mal so ein Knirps und ich kann mir vorstellen, was in seinem Kopf vorgeht.« Joshua drückte seiner Freundin einen Kuss auf die Wange. Im nächsten Moment schwang er sich aufs Fahrrad. »Los, komm schon, alte Oma! Oder soll ich den Triumph allein auskosten?«
»Das könnte dir so passen.« Erfüllt von neuer Hoffnung trat auch Dési in die Pedale.
Es war nicht weit bis nach Hause. Dort angekommen, sprang sie ab und lehnte das Rad an den Gartenzaun. Fees Wagen parkte noch immer vor dem Haus. Ein Blick durch die Scheibe genügte, und Dési brach in Tränen aus.
»Was ist? Jetzt sag schon!«, verlangte Joshua, der erst jetzt ankam.
»Er schläft.« Dési deutete auf Paul.
Wie eine Katze hatte er sich auf der Rückbank zusammengerollt und schlief tief und fest.
In diesem Moment kam Felicitas aus dem Haus gelaufen. Durch das Fenster hatte sie gesehen, wie die beiden gekommen waren.
»Und? Habt ihr eine Spur?«, rief sie atemlos.
Joshua legte den Arm um Dési und drückte sie an sich. Dabei lachte er Fee an.
»Du hast schon wieder vergessen, deinen Wagen abzuschließen.«
»Wirklich? Bei der Aufregung kann das schon …« Mitten im Satz hielt sie inne. Erst jetzt verstand sie, was er ihr damit sagen wollte. In Windeseile lief sie den Gartenweg hinunter.
»Sag bloß, Paul ist im Auto?«
Joshua grinste von einem Ohr bis zum anderen.
»Und schläft wie ein Murmeltier.« Er zog Dési zur Seite, um den Blick freizugeben auf das schlafende Kind.
*
»Klar sage ich Frau Wolter Bescheid. Mache ich doch gern«, versprach der Pfleger Jakob. »Sie wird sich sehr freuen, dass der kleine Räuber wieder da ist. Die ganze Zeit hat sie von nichts anderem geredet.« Er tauschte noch ein paar Worte mit dem Klinikchef, ehe er auflegte und das Mobiltelefon in die Kitteltasche zurücksteckte. Es gab noch viel zu tun an diesem Tag. Nicht nur, dass es noch Verbände zu wechseln und Medikamente zu verabreichen galt. Darüber hinaus musste er Pflegemaßnahmen dokumentieren und Pflegepläne für neue Patienten erarbeiten. Bevor er Dr. Nordens Auftrag ausführte, wollte er noch schnell die restlichen Tabletten für seine Patienten zusammenstellen. Auf keinen Fall durfte er durcheinander kommen. Er saß am Tisch, diverse Packungen vor sich, die er nach einer Liste akribisch in die Medikamentenboxen einsortierte.
»Wo war ich stehen geblieben?« Jakob suchte den Namen auf der Liste. Doch es war wie verhext. Die Buchstaben tanzten vor seinen Augen und wollten einfach nicht stillstehen. »Das kann doch nicht sein«, schimpfte er leise vor sich hin. Er fuhr sich über die Augen. Der Boden unter seinem Stuhl begann zu schwanken. Wie ein Schwert fuhr ein stechender Schmerz durch seinen Kopf, sodass er meinte, er würde jeden Moment platzen. Jakob presste die Hände an die Schläfen und stöhnte auf.
Dr. Sophie Petzold stand auf dem Flur und stritt wieder einmal mit ihrem Kollegen Matthias Weigand. Wie so oft ging es um die – wie sie meinte – antiquierten Behandlungsmethoden des Kollegen. Der dumpfe Knall aus dem Schwesternzimmer ließ sie mitten im Satz innehalten.
»Ich werde Ihnen beweisen, dass ich recht habe«, drohte sie noch, ehe sie ihren Vorgesetzten stehenließ und in die Richtung davonlief, aus der das beunruhigende Geräusch gekommen war. »Was ist …« Die Antwort erübrigte sich.
Die Hände an den Kopf gepresst, wand sich Jakob stöhnend auf dem Boden. Schnell kniete Sophie neben ihm nieder.
»Was ist los?« Sie zerrte an seinem Oberkörper, richtete ihn auf und lehnte seinen Oberkörper an einen Schrank.
»Mein Kopf!«, jammerte Jakob, außer sich vor Schmerzen. Hektisch atmete er ein und aus. »Mir ist schwindlig geworden, Frau Doktor … Doktor …« Vergeblich versuchte er, sich an ihren Namen zu erinnern.
»Petzold. Ich bin Sophie Petzold.«
Jakob rang sich ein Lächeln ab.
»Tut mir leid. Natürlich. Frau Dr. Norden.«
»SOPHIE. Mein Name ist Sophie«, wiederholte sie mit Nachdruck. Die eine Hand stützend auf seiner Brust, zog sie mit der anderen das Handy aus der Tasche. »Diesmal kommen Sie mir nicht aus.« Sie wählte eine Nummer und hielt das Gerät ans Ohr. »Dr. Weigand? Haben Sie kurz Zeit, mir mit einem Patienten zu helfen? Und bringen Sie bitte eine Liege mit.«
*
»Wer hat denn da angerufen?«, erkundigte sich Dr. Christine Lekutat bei ihrer Mutter, mit der sie sich eine Wohnung teilte. Sie wuselte zwischen den Zimmern hin und her, suchte in dem einen nach einem Buch, das sie in der Klinik brauchte, holte aus dem anderen die frisch gewaschene Sommerbluse, die sie an diesem Tag anziehen wollte.
Gekrümmt schlurfte Petra in die Küche zurück und setzte sich wieder an den Tisch.
»Das war meine Freundin Anna. Sie ist im Garten ausgerutscht und hat sich am Steißbein verletzt. Ihr Nachbar hat sie in die Klinik gebracht. Wusstest du übrigens, dass er dein Chef ist?«
Doch wie so oft war Christine mit den Gedanken schon wieder woanders.
»Beeil dich, Mama! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit«, befahl sie, als sie in der Küche auftauchte. »Wenn du nicht gleich etwas isst, musst du den Tisch selbst abräumen. Ich muss zum Dienst.«
Trotz des frühen Morgens waren ihre Wangen gerötet, feine Schweißperlen standen auf ihrer Oberlippe.
Wie eine Aureole umrahmten die kurzen Locken ihr Gesicht und ließen es noch runder erscheinen.
»Ich habe keinen Hunger«, murmelte die alte Dame.
»Nicht so schlimm. Ein paar Kilo weniger auf den Rippen schaden dir nicht.«
Petra zog eine Augenbraue hoch.
»Das sagt die Richtige.«
Erbost stemmte Christine die Hände in die fülligen Hüften.
»Soll das heißen, ich bin zu dick?«
Doch Petra hatte weder Kraft noch Nerven für diese unsinnige Diskussion.
»Mir ist schon seit gestern schlecht«, murrte sie. »Aber das interessiert dich ja nicht.«
Christine überlegte nicht lange und stellte ihrer Mutter einen Teller mit zwei Scheiben Zwieback hin.
»Das nächste Mal solltest du eben nicht die ganze Schachtel Pralinen aufessen.«
»Ich habe gestern gar nichts gegessen. Und schon gar keine Süßigkeiten.«
»Und wer war das hier?« Christine fischte die leere Packung aus dem Mülleimer und wedelte damit durch die Luft.
»Ich jedenfalls nicht.« Petra zuckte mit den Schultern. »Als Mutter einer Ärztin hatte ich mir etwas mehr Fürsorge erwartet.« Sie saß mit dem Rücken zu den Schränken. Geschirr klapperte, schmatzend öffnete sich die Kühlschranktür und fiel mit einem Rumms! wieder ins Schloss.
»Tut mir leid. Ich muss jetzt zur Arbeit, um Geld zu verdienen, damit du deine Rente bekommst, von der du dir einen Arzt leisten kannst.« Christine verschwand wieder im Flur.
Petra hörte sie dort rumoren. Der Gedanke daran, in diesem Zustand den ganzen Tag allein in der Wohnung zu verbringen, machte ihr Angst. Mühsam stemmte sie sich vom Tisch hoch und ging zur Tür.
»Kannst du mich in die Klinik mitnehmen? Ich will Anna besuchen.« Das war nur die halbe Wahrheit.
Überrascht fuhr Christine herum.
»Hast du mir nicht vor fünf Minuten erzählst, du seist krank?«
»So krank nun auch wieder nicht. Außerdem geht es Anna schlechter als mir.« Petra schlüpfte in ihre Schuhe. »Sie hat ihren kleinen Enkel zu Besuch, um den sie sich jetzt nicht kümmern kann.«
Christine griff nach dem Autoschlüssel am Schlüsselbrett.
»Deshalb habt ihr beiden beschlossen, eine Kindertagesstätte in der Klinik aufzumachen. Herrlich!« Das Lachen ihrer Tochter erinnerte Petra an das Schnauben eines Pferdes.
»Irgendjemand muss sich ja um die zukünftigen Rentenzahler kümmern«, konterte sie, ehe sie, eine Hand auf den Bauch gepresst, hinaus in den Hausflur trat.
»Da hast du auch wieder recht«, erwiderte Christine vollkommen ernst. Wie vielen intelligenten Menschen mangelte es auch ihr an Einfühlungsvermögen. Mit ihren taktlosen Bemerkungen eckte sie häufig an, verstand aber den Grund dafür nicht. Aus diesem Grund kabbelten sich Petra und Christine zwar oft im Alltag, vertrugen sich aber genauso schnell wieder. Wie an diesem Morgen, an dem Christine ihre Mutter trotz Eile direkt vor Frau Wolters Zimmer ablieferte.
*
»Was hast du dir nur dabei gedacht?« Fee Norden saß draußen am Tisch und sah Paul dabei zu, wie er an dem Strohhalm nuckelte, der in einem Glas ihrer berühmten selbstgemachten Limonade steckte.
Joshua und Dési waren bei ihr, Daniel dagegen rumorte irgendwo im Haus.
»Ich wollte zu meiner Mami«, erwiderte Paul mit unschuldigem Augenaufschlag.
»Joshua hat es gewusst.« Bewundernd sah Dési zu ihrem Freund hinüber. Sie streckte die Hand aus und streichelte ihm durch das verwuschelte Haar.
»Stimmt doch gar nicht. Es war nur so eine Idee«, wehrte der sich verlegen. »Ich bin so froh, dass du mich geholt hast.« Er legte den Zeigefinger unter Désis Kinn und küsste sie zärtlich.
Die beiden waren so versunken ineinander, dass sie ihre Umwelt vergaßen.
»Und ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Weißt du, wie viel Angst ich hatte, du könntest Nein sagen?«
»Dann kennst du mich aber schlecht.«
Schlagartig verschwand das Lächeln von Désis Lippen.
»Das wird sich in der nächsten Zeit auch kaum ändern.«
Lächelnd und ein wenig melancholisch lauschte Fee dem verliebten Geplänkel.
Schwer vorstellbar, dass Daniel und sie auch einmal so gewesen waren.
Es war Désis Feststellung, die sie wieder an Joshuas schicksalhafte Entscheidung erinnerte. Obwohl sie ihrer Tochter ins Gewissen geredet hatte, empfand auch sie mit einem Mal ein vages Bedauern. Schade um das schöne Paar!, ging es ihr durch den Sinn.
Um der Melancholie nicht zu viel Raum zu lassen, wandte sie sich schnell wieder an Paul, der die Beine baumeln ließ und selbstvergessen ein Lied vor sich hin sang.
»Was hältst du davon, wenn wir mit Daniel zu deiner Omi in die Klinik fahren? Bestimmt ist sie sehr froh, dass du wieder da bist.«
Erstaunt blickte Paul auf und fuchtelte unbeholfen mit der Hand durch die Luft, um eine lästige Fliege zu vertreiben.
»Aber ich war doch gar nicht lange weg.«
»Lange genug, um uns einen gehörigen Schrecken einzujagen.« Joshua wuschelte dem Kleinen durch das Haar. Fee erhob sich vom Tisch.
»Dann machen wir uns mal auf den Weg.«
Das war auch das Signal für Joshua.
»Ich muss auch wieder heim. Wahrscheinlich ist Paola schon wütend, weil ich immer noch nicht fertig bin.«
Dési sah ihn fragend an.
»Kann ich mitkommen?«
»Ja klar, ich würde mich freuen.« Joshua streckte die Arme aus und zog sie hoch.
Zufrieden klatschte Fee in die Hände.
»Dann fehlt eigentlich nur noch Dan.« Sie sah sich suchend um. »Wo steckt er denn schon wieder?«
»Irgendwo im Haus.«
Ein erstickter Schrei, gefolgt von Rumpeln und Krachen, bestätigte Désis Vermutung. Im nächsten Moment stapfte Daniel aus dem Keller. Über das ganze Gesicht strahlend präsentierte er seine Beute.
»Ich wusste doch, dass wir das Krocketspiel noch irgendwo haben. Das können wir später zusammen spielen.« Triumphierend deutete er auf den Wagen mit den bunten Holzschlägern und -kugeln.
Fee überlegte noch, ob das so eine gute Idee war, als Dési und Joshua zum Aufbruch drängten.
»Vielleicht lohnt es sich mehr, wenn ihr den Klinikbesuch auf später verschiebt«, unkte Dési und wog einen der Holzschläger in der Hand. »Wegen der blauen Zehen und so.«
»Wir haben langjährige Übung im Flöhehüten«, erwiderte Daniel. Er klopfte sich den Staub von Hose und Händen und lächelte Paul an, der sich schon an dem Krocket zu schaffen machen wollte. Mit einem Luftballon vom letzten Geburtstag vertröstete Fee ihn schnell auf später, und zu fünft machten sie sich schließlich auf den Weg.
*
Zum Aufbruch bereit wanderte Paola Wiesenstein durch die Wohnung ihres Ex-Mannes.
»Warum hast du ihn nicht aufgehalten? Du weißt doch genau, dass der Flug heute Nachmittag geht. Ich habe extra umgebucht, damit ich gemeinsam mit Joshua fliegen kann.«
»Nur zur Erinnerung: Dein Sohn ist sechzehn Jahre alt. Ich bin doch nicht sein Babysitter«, erwiderte Adrian unwillig.
Kurz nach Paolas Rückkehr hatte er die Hoffnung gehegt, sie könnten wieder zusammenfinden. Doch seine Ex-Frau hatte sich nicht geändert. Mit einem Schlag hatte Paola nicht nur seine Hoffnungen auf einen Neuanfang zerstört, sondern wollte ihm nun auch noch den Sohn entreißen, um den er sich acht Jahre aufopfernd gekümmert hatte. Dass sie – eiskalt und skrupellos – sein Leben ein zweites Mal zerstörte, konnte und wollte er ihr nicht verzeihen.
Abwehrend hob Paola die Hände. »Schon gut. Warum bist du so aggressiv? Ich habe dir doch nichts getan.«
Adrian lachte auf.
»Richtig. Du machst nur ein zweites Mal alles kaputt, was ich mir mühsam aufgebaut habe. Sonst hast du mir wirklich nichts getan.«
Über diese Anschuldigung konnte Paola nur den Kopf schütteln.
»Was hast du denn von Joshua erwartet?«, fragte sie spitz. »Dass er er aus lauter Dankbarkeit nie mehr von deiner Seite weichen und dein Händchen halten wird?«
In ihre Worte hinein drehte sich ein Schlüssel im Schloss. Adrian atmete erleichtert auf, als Joshua und Dési hereinkamen. Es hätte nicht viel gefehlt, und er wäre seiner Ex-Frau an die Gurgel gegangen.
»Hallo, ihr zwei. Da seid ihr ja«, begrüßte er die beiden. »War die Suche erfolgreich?«
»Zum Glück. Stell dir vor, Paul hat …«
»Wir haben jetzt keine Zeit mehr für Smalltalk«, ging Paola ungeduldig dazwischen. »Hast du deine Sachen fertig gepackt?«
Sie wandte sich ab und ging zur Tür.
»Da gibt es nichts zu packen.« Joshuas Stimme war fest. Dési sah ihren Freund überrascht an. Genauso wie Paola.
»Wie bitte? Ich dachte, wir hätten alles besprochen.«
»Das dachte ich auch. Aber ich habe mich geirrt. Ich komme doch nicht mit nach Zürich.«
Dési schlug die Hand vor den Mund, um nicht laut aufzuschreien vor Glück.
Adrian stand da wie zur Salzsäule erstarrt. Paolas Augen feuerten wütende Blitze auf ihren Sohn ab.
»Willst du mich auf den Arm nehmen?« Mit einem Schlag war all das aus ihrem Wesen verschwunden, was Joshua so gefallen hatte. Ihre Liebenswürdigkeit. Der Charme und Witz, mit denen sie ihre Umgebung zu verzaubern verstand. Alles wie weggeblasen. Statt dessen erinnerte ihn ihr Gesicht an das einer Hexe. Genau wie ihre Stimme. »Du holst jetzt sofort deine Sachen! Der Flug ist gebucht, das Taxi muss jeden Moment hier sein.« Wie auf Kommando ertönte auf der Straße ein Hupen.
Langsam schüttelte Joshua den Kopf.
»Nein, Paola. Ich komme nicht mit. Mein Zuhause ist hier. Bei Adrian. Und bei Dési.« Wie zum Beweis legte er den Arm um ihre Schultern und zog sie an sich. Sein liebevoller Blick streichelte das Gesicht seiner Freundin.
Adrian dagegen verschränkte die Arme und lehnte sich an die Wand. Nie zuvor hatte er das Gefühl der Genugtuung so sehr genossen wie in diesem Augenblick. Doch da war noch etwas anderes. Verwundert stellte er fest, dass ihm Paola fast leidtat, wie sie mit hängenden Schultern dastand und zu verstehen versuchte, was da eben passierte. Niederlagen waren ihr fremd. Das stand deutlich in ihrem Gesicht geschrieben.
»Sag du doch auch mal was dazu!«, verlangte sie von ihrem Ex-Mann. Ihre Stimme bebte vor Zorn.
»Ausgerechnet ich? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt?«
In diesem Moment mischte sich Joshua ein.
»Mensch, Paola! Jetzt sei nicht so sauer. Du hast doch alles, was du willst. Dein Engagement in Zürich. Den geheimnisvollen Pierre. Wahrscheinlich jede Menge Verehrer. Gönn’ Papa doch auch mal ein Stück vom Kuchen«, bat er mit sanfter Stimme.
Paola drehte sich um und musterte ihren Sohn eingehend.
»Dir ist schon klar, dass du damit deine Chance verspielst, Schauspieler zu werden«, fragte sie nach einer gefühlten Ewigkeit.
»Und wenn schon.« Joshua zuckte mit den Schultern. »Mir ist mein Abi erst einmal wichtiger. Egal, wie schlecht es ausfällt. Danach kann ich immer noch Theaterwissenschaften studieren. Es geht doch nichts über eine solide Ausbildung.«
»Du klingst schon wie dein Vater.« Verächtlich verzog Paola das Gesicht. Das Taxi hupte erneut. Sie gab sich einen Ruck. »Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir Glück zu wünschen.« Sie gab sich einen Ruck, trat auf Joshua zu und küsste ihn links und rechts auf die Wange. »Leb wohl, mein Sohn.« Dési und Adrian dagegen strafte sie mit Missachtung, als sie ihre Vergangenheit hinter sich ließ und durch die Tür ging, ohne sich noch einmal umzudrehen.
*
Seit einer Weile saß Petra Lekutat nun schon am Bett ihrer Freundin Anna. Trotzdem hatte sie bisher kaum ein Wort gesagt. Ganz im Gegenteil war sie dankbar dafür, dass ihre Freundin plauderte wie ein Wasserfall. Doch irgendwann versiegte der Redestrom und Anna fiel auf, wie still ihre Freundin war. »Stimmt was nicht mit dir?«, erkundigte sie sich besorgt.
Auf der einen Seite freute sich Petra, endlich auch einmal im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Auf der anderen schämte sie sich.
»Ach, seit gestern ist mir ein bisschen schlecht. Aber das ist halb so wild.« Ihr Stöhnen strafte sie Lügen.
Anna Wolter runzelte die Stirn.
»Deiner Tochter kannst du vielleicht etwas vormachen. Aber mir nicht«, erklärte sie energisch. »Raus mit der Sprache. Was ist los?«
»Ach … na ja … weißt du … «, druckste Petra herum, bis sie es nicht länger aushielt. »Ehrlich gesagt geht es mir schon seit Tagen schlecht. Ich muss mich dauernd übergeben und habe schreckliche Bauchschmerzen.«
Schlagartig zerplatzte Annas Hoffnung, in Sachen Kinderbetreuung auf die Hilfe ihrer Freundin zählen zu können. Doch das war jetzt nicht so wichtig.
»Und was sagt Christine dazu?«
Petra verdrehte die Augen.
»Es gibt nichts Schlimmeres als eine Ärztin als Tochter.«
»Da hast du auch wieder recht.« Anna schüttelte den Kopf. »Ist ja auch egal. Zum Glück gibt es noch mehr Ärzte auf der Welt. Ich würde sagen, du bist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort.«
Trotz ihrer Beschwerden konnte sich Petra ein Lächeln nicht verkneifen.
»Ehrlich gesagt ist das einer der Gründe, warum ich hier bin.«
»Worauf wartest du dann noch?« Im Überschwang wollte sich Anna aufrichten. Der Schmerz, der ihr durch das Hinterteil fuhr, erinnerte sie auf unbarmherzige Art und Weise daran, warum sie in der Klinik gelandet war. Stöhnend sank sie in die Kissen zurück. »Zwei richtige alte Schachteln sind wir!«, seufzte sie deprimiert.
»Zum Glück gibt es Recycling«, platzte Petra heraus und streckte sich nach der Fernbedienung, um eine Schwester zu rufen.
*
Unter dem Schein der Taschenlampe zogen sich Jakobs Pupillen zusammen und weiteten sich wieder.
»Sie können aufhören. Auch wenn Sie mich blenden wollten, weiß ich, wer Sie sind, Dr. Weigand«, sagte der Pfleger Jakob.
»Freut mich außerordentlich. Vorhin hat das nicht so gut geklappt.« Matthias steckte die kleine Taschenlampe ein und richtete sich auf. Er wandte sich an seine Kollegin Sophie Petzold, die an einem fahrbaren Stehpult stand. »Augen normale Reaktion auf Licht und Konvergenz.«
Sie wusste, was er von ihr erwartete und machte eine entsprechende Notiz in die Patientenakte.
»Notiert.«
»Ach!« Matthias hatte eine Idee. »Bei dieser Gelegenheit können Sie mir gleich erklären, was Sie über den Begriff Konvergenz wissen.«
»Nicht Ihr Ernst.« Sophie rollte mit den Augen. »Als Konvergenzreaktion wird eine über einen Nerv vermittelte reflektorische Reaktion von Bulbus und Pupille bei Fixierung naher Objekte bezeichnet.«
»Sie bombardieren mich ja geradezu mit Fachbegriffen. Wie sollen unsere Patienten verstehen, wovon Sie sprechen?« Er wandte sich an Jakob. »Oder wissen Sie, was ein Bulbus ist?«
»Bulbus oculi, der Augapfel«, antwortete der Pfleger wie aus der Pistole geschossen. Als ihn der tadelnde Blick des Arztes traf, zuckte er mit den Schultern. »Tut mir leid. Ich bin vom Fach.«
Sophie gluckste vor unterdrücktem Lachen. Ärgerlich drehte sich Matthias zu ihr um.
»Ja, lachen Sie nur! Aber vergessen Sie diese Lektion nicht. Der Chef legt allergrößten Wert auf Transparenz. Die Patienten sollen verstehen, wovon wir sprechen.«
»Aye, aye Captain«, gab Sophie frech zurück.
»Darf ich wieder gehen, wenn die Schulstunde zu Ende ist?«, fragte Jakob.
Kopfschüttelnd konzentrierte sich Dr. Weigand wieder auf seinen Patienten.
»Ganz im Gegenteil, mein lieber Jakob.« Er zog sich einen Hocker heran und setzte sich. »Mit Ihnen fange ich gerade erst an. Die Kollegin Petzold hat mir verraten, dass Sie vorhin Anzeichen von Verwirrung zeigten und Namen verwechselt haben.«
»Kommt Petzold von Petze?«, scherzte Jakob.
Sophie lachte.
»Noment est omen.«
Allmählich wurde Matthias die Sache zu bunt.
»Können wir uns jetzt wieder auf unsere Arbeit konzentrieren?«, fragte er so scharf, dass sie erschrocken die Augen senkte.
»Natürlich. Es tut mir leid.«
Zufrieden mit der Wirkung seiner Worte drehte sich Matthias wieder um.
»Passiert Ihnen das öfter?«, fragte er Jakob.
»Nein. Das war das erste Mal.«
»Und die Probleme mit Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit?«
Jakob rutschte auf der Liege herum. Die Befragung war ihm sichtlich unangenehm.
»Manchmal. Aber das kommt von der vielen Arbeit. Das habe ich Frau Dr. Petzold auch schon gesagt. Typisch Frau, dass sie ausgerechnet das für sich behalten hat.«
Sophie schnitt eine Grimasse, sagte aber nichts. Dr. Weigand dagegen blieb ernst. Er hatte sich inzwischen ganz eigene Gedanken gemacht. Und die waren alles andere als erheiternd.
»Ihre Symptome könnten ein Hinweis auf einen erhöhten Hirndruck sein.« Er sah hinüber zu Sophie. »Wie finden wir das heraus, Kollegin Dr. Petzold?«
»Mit Hilfe einer MRT. Zu Ihrer Erklärung: Magnetresonanztomographie. Und um einer weiteren blöden Frage zuvorzukommen: Dabei handelt es sich um ein bildgebendes Verfahren, das in der medizinischen Diagnostik zur Darstellung von Struktur und Funktion der Organe und Gewebe im Körper eingesetzt wird.«
Dr. Weigand nickte zufrieden.
»Die ›blöde Frage‹ gibt einen Punkt Abzug. Daher verdient Ihre Leistung nur ein ›gut‹. Kümmern Sie sich bitte um die MRT. Und checken Sie die Nierenwerte.«
Jakob hatte dem Gespräch der beiden Ärzte mit wachsender Unruhe gelauscht.
»Augenblick mal. Könnten wir das alles nicht auf morgen verschieben? Ich habe noch jede Menge zu tun heute.«
»Tut mir leid. Daraus wird nichts.« Bedauernd schüttelte Matthias den Kopf und stand auf. »Den Rest schaffen Sie ja sicher selbst, Frau Dr. Petzold. Falls Sie mich brauchen, finden Sie mich auf Station. Also hopp, hopp. An die Arbeit, junge Frau.« Er nickte Jakob zu und verließ das Zimmer.
Die Tür hatte sich noch nicht hinter ihm geschlossen, als Sophie ihm eine lange Nase drehte.
»Hopp, hopp, junge Frau«, schimpfte sie. »Na warte, der alte Mann kann sich warm anziehen.«
Jakob lachte, und sie fuhr zu ihm herum. »Was denn? Finden Sie das etwa komisch?«
Schnell versuchte er, ernst zu werden. Vergeblich.
»Überhaupt nicht. Es ist Ihre Schuld, dass ich lachen muss. Sie sind einfach zu nett, wenn Sie wütend sind. Wahrscheinlich versucht Weigand deshalb, Sie ständig auf die Palme zu bringen.«
Einen Moment lang dachte Sophie über diese Begründung nach. Langsam entspannte sich ihre Miene.
»Wenn das so ist, dann kann er sich noch wärmer anziehen.« Sie zwinkerte Jakob verschwörerisch zu, ehe sie die Bremse der Liege löste und sich mit ihm auf den Weg in die Radiologie machte.
*
»Paulchen, Gott sei Dank. Da bist du ja wieder!« Anna Wolters erleichterter Ausruf hallte bis hinaus auf den Klinikflur. Schnell schloss Daniel die Tür.
»Hat dieser Pfleger Ihnen denn nicht ausgerichtet, dass er wieder aufgetaucht ist?«
Anna wiegte ihren Enkel in den Armen. Sie schüttelte den Kopf.
»Der nette, junge Mann war schon länger nicht mehr hier. Aber Sie dürfen ihm genauso wenig böse sein wie ich Ihnen.« Sie blinzelte Daniel zu. »Er hat furchtbar viel Arbeit.«
Dr. Norden ärgerte sich trotzdem über diese Unzuverlässigkeit. Nur Anna zuliebe ließ er Gnade vor Recht ergehen.
»Paul hat es sich übrigens im Wagen meiner Frau gemütlich gemacht. Deshalb konnten wir ihn nicht finden.«
»Ich wollte zu Mama fahren. Aber dann ist keiner gekommen, und ich bin eingeschlafen«, informiert der Knirps seine Großmutter.
»Keine Angst, die Schlüssel hatte ich abgezogen«, versicherte Felicitas schnell, um nur ja keine Missverständnisse aufkommen zu lassen.
»Diesem Räuber hätte ich zugetraut, dass er sich auf die Suche danach macht«, gestand Anna Wolter. »Wenn ich Ihnen erzähle, was er schon alles angestellt hat …« Paulchen zappelte in ihren Armen, und sie ließ ihn frei. Er rutschte vom Bett, um sich mit seinem Luftballon zu beschäftigen. »Einmal hat er mit Australien telefoniert. Meine Tochter ist fast in Ohnmacht gefallen, als sie die Rechnung präsentiert bekam. Ein anderes Mal hat sich Paul mit einer ganzen Dose Creme beschmiert. Und gefährlich wurde es, als er den Rasierer seiner Mutter benutzte, um sich die Beine zu rasieren, wie er es bei Carina gesehen hatte. Sie können sich nicht vorstellen, wie das geblutet hat.«
»O doch!«, erwiderte Fee und verzog das Gesicht. »Sogar aus eigener Erfahrung.«
Daniel musterte Frau Wolter mit zweifelnder Miene.
»Und Sie wollen wirklich in diesem Zustand die Verantwortung für den kleinen Satansbraten übernehmen?«, fragte er.
Anna seufzte.
»Ich habe ja keine Wahl. Carina ist noch eine Woche in Zürich. Leider kann mir meine Freundin Petra offenbar auch nicht helfen. Ihr ist schon seit Tagen schlecht, und sie wird gerade von einem Kollegen untersucht.« Sie schickte Daniel Norden einen schüchternen Blick. »Vielleicht kann mir ja Dési hin und wieder ein bisschen unter die Arme greifen.«
»Machen Sie sich keine Sorgen«, versicherte Felicitas, ehe ihr Mann überhaupt den Mund öffnen konnte. »Wir werden das Kind schon schaukeln.«
Ein ohrenbetäubender Knall ließ die Erwachsenen zusammenzucken. Paul stand in der Ecke, die Fetzen des Luftballons lagen vor ihm auf dem Boden. Er presste die Hände auf die kleinen Ohren und wollte sich ausschütten vor Lachen.
Daniel und Fee tauschten vielsagende Blicke. Schon jetzt war klar, dass die Familie Norden eine aufregende Zeit vor sich hatte, bis Carina Wolter ihren kleinen Wirbelwind wieder abholen würde.
*
Mit Blaulicht fuhr der Notarztwagen vor der Notaufnahme der Behnisch-Klinik vor. Ein normaler PKW folgte ihm. Seine Bremsen quietschten, als er ein Stück hinter dem Rettungswagen zum Stehen kam. Blitzschnell öffneten sich die Türen, ein Fotograf und eine Reporterin stiegen aus und stürmten zum Rettungsarzt Erwin Huber. Er war im Begriff, die Liege mit der Verletzten aus dem Wagen zu ziehen. »Können Sie schon etwas zum Zustand von Frau Wiesenstein sagen?«, rief die Reporterin und wollte Erwin Huber das Mikrofon vor den Mund halten.
Er hatte keine Hand frei, um sich gegen den Überfall zu wehren. Zum Glück war ein Kollege zur Stelle.
»Kein Kommentar. Sehen Sie nicht, dass Sie die Arbeiten behindern?« Unwirsch schob er die Reporterin zur Seite, konnte aber nicht verhindern, dass der Fotograf ein paar Bilder schoss.
»Jetzt reicht es aber!«, rief Huber und war froh, als sich die Glastüren hinter ihnen schlossen.
Der Notarzt Dr. Weigand wartete schon. Er nahm die Patientin in Empfang.
»Verkehrsunfall auf dem Weg zum Flughafen. Die Patientin heißt Paola Wiesenstein, 35 Jahre alt. Stumpfes Bauchtrauma, mögliche innere Verletzungen. Offener Schienbeinbruch. Prellungen im Brustbereich.«
»Ab in den Schockraum«, befahl Matthias, als der Klinikchef über den Flur eilte.
Auf dem Weg nach draußen war Dr. Norden der Tumult aufgefallen. Kurzerhand hatte er Felicitas und Paul allein nach Hause geschickt. Er selbst war in die Notaufnahme geeilt, um nach dem Rechten zu sehen.
»Was ist denn hier los?«, erkundigte sich Daniel beim Anblick der Gruppe Reporter, die sich inzwischen vor den Glastüren versammelt hatten.
»Diese Bande ist wie ein Schwarm Wespen«, stöhnte Erwin Huber. »Wenn eine etwas zu fressen findet, wissen gleich alle anderen Bescheid.«
»Sind sie hinter dir her?«, fragte Daniel schmunzelnd.
»Gott bewahre!« Energisch schüttelte Huber den Kopf. »Wir haben gerade eine Schauspielerin gebracht. Paola Wiesenstein. Sie wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Der Taxifahrer wurde in eine andere Klinik gebracht.«
»Wiesenstein?« Daniel horchte auf. »Etwa die Frau unseres neuen Kollegen?«
»Das musst du ihn schon selbst fragen. Ich hatte noch nicht das Vergnügen mit einem Herrn Wiesenstein.« Erwin hob die Hand zum Gruß. »Dann werde ich mich mal ins Wespennest wagen.« Bewaffnet mit seiner Krankenliege verließ er die Klinik.
Daniel sah ihm kurz nach. Ruckzuck wurde Erwin von den Reportern umringt. Bedauernd machte sich Dr. Norden auf den Weg in den Schockraum. Unterwegs zückte er das Handy und wählte Adrian Wiesensteins Nummer.
*
Auch Dr. Wiesenstein hatte inzwischen seinen Dienst angetreten. Ausnehmend gut gelaunt begrüßte er die Kollegen im Aufenthaltsraum, wie auch die Chirurgin Christine Lekutat sofort feststellte.
»Na, Sie sehen ja ganz aus, als hätte eine glückliche Wiedervereinigung stattgefunden.« Eine Tasse Kaffee in der Hand sah sie ihm dabei zu, wie er den Raum durchquerte und seine Sachen im Spind in der Ecke einschloss. Alle anwesenden Kollegen spitzten die Ohren. Es versprach, ein interessantes Gespräch zu werden.
Während Adrian, geschützt vor neugierigen Blicken, in seine Amtstracht stieg, rief er sich das Gespräch in Erinnerung, das vor ein paar Tagen stattgefunden hatte. Warum nur hatte er der Kollegin Lekutat sein Herz ausgeschüttet und von Paola erzählt? Doch es war zu spät für Reue. Jetzt galt es, sich ohne Gesichtsverlust aus der Affäre zu ziehen.
»Ganz im Gegenteil!« Er tauchte aus der Umkleide auf und schlug den Kragen des Kittels nach unten. »Paola und ich haben eine glückliche, endgültige Trennung vollzogen.«
Christines Gesicht leuchtete auf.
»Oh, wenn das so ist, dürfen Sie mich zur Feier des Tages zum Essen einladen.«
Unterdrücktes Lachen war zu hören.
»Ach ja?« Hilfesuchend sah sich Adrian nach seinen Kollegen um. Die beugten schnell über Fachzeitschriften, Handys und Kaffeetassen. Von dieser Seite war also keine Unterstützung zu erwarten.
Christine frohlockte.
»Ja. Meine Mutter braucht mich heute nämlich nicht. Eine ihrer Freundinnen ist hier in der Klinik.« Sie nippte an ihrem Kaffee. »Dafür hat Mama, o Wunder, genug Kraft. Aber wehe, sie hat nichts vor. Dann ist sie plötzlich hilflos wie ein Baby und drangsaliert mich nach Strich und Faden.«
Obwohl Adrian bereits das eine oder andere Mal Bekanntschaft mit Christines taktloser Art gemacht hatte, wollte er nicht in dasselbe Horn stoßen.
»Das erinnert mich an meinen Sohn, als er noch klein war«, erwiderte er. Im nächsten Moment bereute er seine Freundlichkeit.
»Ist das nicht schön, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben?«, säuselte die Chirurgin. »Deshalb nehme ich Ihre Einladung liebend gern an. Sie dürfen mich um halb sieben bei mir zu Hause abholen.«
Zum Glück klingelte in diesem Moment Adrians Telefon und ersparte ihm eine Antwort.
»Wiesenstein«, meldete er sich. Schlagartig verschwand das Lächeln auf seinem Gesicht. »Ich komme sofort.« Er beendete das Gespräch und stürmte ohne eine Erklärung aus dem Zimmer.
Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, begannen die Kollegen zu johlen.
Christine Lekutat warf den Kopf in den Nacken und sah triumphierend in die Runde.
»Seht ihr, sogar ein Adrian Wiesenstein liegt mir zu Füßen.« Mit einem Schwung ihrer fülligen Hüften drehte sie sich um und machte sich in dem ihr eigenen, watschelnden Gang auf den Weg zu ihren Patienten.
*
Inzwischen hatten ein paar findige Reporter einen anderen Weg in die Klinik gefunden und bestürmten Dr. Daniel Norden mit Fragen.
»Hat sich der Verdacht bestätigt, dass sich Frau Wiesenstein einen Milzriss zugezogen hat?«
»Wird sie je wieder laufen können?«
»Stimmt es, dass der Ex-Mann von Frau Wiesenstein als Arzt hier arbeitet?«
Abwehrend und sichtlich genervt hob der Klinikchef die Hände.
»Im Augenblick wird Frau Wiesenstein untersucht. Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, kann ich mehr sagen.« Aus den Augenwinkeln sah er, dass der Verwaltungschef in die Ambulanz kam.
Der Besuch des hohen Gastes war bereits bis zu ihm vorgedrungen. Für Dieter Fuchs war Prominenz die beste Werbung für die Klinik. Um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, klatschte er in die Hände.
»Meine sehr verehrten Herrschaften! Mein Name ist Dieter Fuchs.« Er rieb sich die Hände. »Ich bin der Verwaltungsdirektor dieser Klinik und stehe Ihnen jederzeit für Auskünfte zur Verfügung.« Blitzlichter flammten auf, Kameras klickten. Fuchs lächelte geschmeichelt. »Der Klinikchef Dr. Daniel Norden wird sich jetzt um die Patientin kümmern. In einer halben Stunde wissen wir sicherlich mehr. Inzwischen darf ich Sie bitten, unseren Klinikkiosk aufzusuchen, wo Sie neben Artikeln des täglichen Bedarfs auch Kaffeespezialitäten und den besten Kuchen der Stadt kaufen können. Wenn Sie mir bitte folgen wollen.«
Er machte eine einladende Handbewegung.
Daniel Norden sah dem Tross nach, der dem Verwaltungsdirektor wie eine Herde Schafe folgte. Es kam selten vor, dass er Dieter Fuchs dankbar war. Bevor er allerdings Gelegenheit hatte, ein Dankgebet in den Himmel zu schicken, stürmte Adrian Wiesenstein in die Ambulanz.
»Was ist mit Paola?« Keuchend blieb er vor dem Chef stehen.
»Ganz ruhig. Der Kollege Weigand kümmert sich um sie«, beschwichtigte Daniel den aufgeregten Kollegen. Im Grunde genommen war ihm der neue Kollege ein Dorn im Auge. Daniel wusste nämlich um Adrians heimliche Schwärmerei für seine Frau Felicitas. Durch Zufall hatten sich die beiden in einem Hotel auf der Fraueninsel kennengelernt. Aus Zeitgründen hatte Daniel nicht mitfahren können, worüber er sich heute noch ärgerte. Doch diese Ressentiments hatten am Arbeitsplatz nichts verloren, zumal Dr. Wiesenstein die allerbesten Referenzen vorweisen konnte. »Paolas Taxi war offenbar auf dem Weg zum Flughafen und wurde in einen Unfall verwickelt.«
»Gott sei Dank!«, entfuhr es Adrian. Er bemerkte Daniels befremdeten Blick. »Tut mir leid. So meine ich das natürlich nicht. Ich meinte, Gott sei Dank, dass Joshua sich entschlossen hat, nicht mit nach Zürich zu gehen. Sonst wäre er mit im Taxi gesessen.«
Diese Neuigkeit war auch für Daniel Norden überraschend. Und überaus erfreulich.
»Ein Glück, dass er sich anders entschieden hat«, sagte er auf dem Weg in den Schockraum. »Ich bin ja selten zu Hause. Aber sogar mir hat Désis schlechte Laune in den vergangenen Tagen zu schaffen gemacht.« Er schob die Tür auf und ließ Adrian den Vortritt.
»Daniel, da bist du ja!« Als die beiden Männer hereinkamen, blickte Matthias vom Monitor des Ultraschallgeräts hoch. »Zum Glück hat sich Erwins Verdacht nicht bestätigt. Keine inneren Blutungen. Aber das Bein, das sieht gar nicht schön aus.«
Als er die gute Nachricht hörte, atmete Adrian auf. Er trat zu Paola und nahm ihre Hand.
»Was machst du denn für Sachen?«
Unwirsch zog sie die Hand zurück.
»Das solltest du lieber mal den Taxifahrer fragen«, erwiderte sie schroff.
Daniel, der am Ende der Liege stand und das Bein untersuchte, tauschte vielsagende Blicke mit Matthias.
»Wir werden den Bruch provisorisch versorgen. Im Anschluss kümmere ich mich um einen freien Operationssaal.«
»Das wäre mir sehr recht.« Paolas Stimme war unverändert unfreundlich. »Je eher die Sache erledigt ist, umso besser.« Sie griff sich in die unordentlichen Haare. »Schlimm genug, dass ich den Beginn meines Engagements verschieben muss.« Sie sah Daniel Norden fragend an. »Was meinen Sie? Habe ich bleibende Schäden zu befürchten?«
»Eine offene Fraktur birgt immer die Gefahr, dass offenliegende Nervenbahnen beschädigt wurden.« Es war Adrian, der die Antwort anstelle des Klinikchefs gab.
Paola feuerte funkelnde Blicke auf ihn ab.
»Dich habe ich nicht gefragt. Wir beide sind fertig miteinander.«
»Nichtsdestoweniger hat der Kollege Wiesenstein recht«, kam Dr. Norden dem Kollegen zu Hilfe. »Ich verspreche Ihnen, dass wir unser Bestes geben werden. Wenn alles gut verläuft, werden Sie in ein paar Monaten wieder ganz normal laufen können.«
Paola verzog das Gesicht.
»Was soll das heißen? In ein paar Monaten?«
»Vielleicht geht es auch schneller. Das kommt ganz darauf an, wie gut Sie bei den Rehabilitationsmaßnahmen mitarbeiten.«
»Und davon, wie gut Sie Ihre Arbeit machen«, schoss Paola zurück. »Wer wird mich operieren?«
»Ich werde ein exzellentes Team zusammenstellen, da können Sie ganz beruhigt sein«, versuchte Daniel, ihr den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sein Plan schien aufzugehen.
Erschöpft von den Strapazen und Schmerzen legte sie den Kopf auf die Liege zurück.
»Ganz beruhigt? Sie haben wirklich Humor«, seufzte sie und schloss die Augen.
Unwillkürlich musste Adrian an Joshuas Absage denken. Der Unfall war schon die zweite Niederlage für seine erfolgsverwöhnte Ex-Frau. Er wusste, dass es albern war. Doch anders als bei Joshua fühlte sich Adrian diesmal schuldig. Wahrscheinlich hatte Paola ihre Wut an dem armen Taxifahrer ausgelassen und so den Unfall mitverursacht.
Auf der Suche nach ein paar tröstenden Worten stand er vor der Liege, als er das sanfte Zupfen am Ärmel spürte.
Dr. Norden gab ihm zu verstehen, mit ihm gemeinsam den Schockraum zu verlassen. Nach kurzem Zögern sah Adrian Wiesenstein ein, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als der stummen Aufforderung des Klinikchefs Folge zu leisten.
*
»Ich will eine Pizza!«, verlangte der kleine Paul energisch.
Mit dieser Bemerkung brachte er Fee an den Rand des Wahnsinns.
»Zuerst wolltest du Grießbrei.« Sie deutete auf die unangetastete Schale, die vor ihrem kleinen Gast auf dem Tisch stand. »Dann sollten es Nudeln mit Tomatensauce sein.« Dési und Joshua würden sich freuen. »Und jetzt Pizza? Nein, tut mir leid. Das geht entschieden zu weit.« Fees anfängliches Mitleid mit dem Kleinen war inzwischen in Ärger umgeschlagen. »Entweder, du isst das, was ich dir gekocht habe. Oder du lässt es blei …«
Der Rest des Satzes ging in ohrenbetäubendem Geschrei unter.
Felicitas stand vor dem tobenden Kind und versuchte zu verstehen, was sich hier gerade abspielte. Hatte sie alles vergessen, was sie in den Jahren mit ihren fünf Kindern gelernt hatte? Und was war mit ihrer Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychologin? Selten zuvor in ihrem Leben hatte sie sich so hilflos gefühlt.
»Was hältst du davon, wenn wir in den Garten gehen und Krocket spielen?«, versuchte sie, Pauls Kreischen zu übertönen. »Hallo, Paul, ich rede mit dir!« Sie ging neben seinem Stuhl in die Knie. »Wenn du mit dem Lärm aufhörst, können wir uns unterhalten.«
Tatsächlich hielt der Kleine kurz inne, aber nur, um die Ärmchen auszustrecken und Fee einen Schubs zu verpassen. Derart überrumpelt, landete sie auf dem Hinterteil. Der Knirps lachte mit tränenüberströmten Gesicht.
Von draußen hatten Dési und Joshua das Geschrei gehört und kamen angerannt. Im Türrahmen blieben sie stehen und starrten auf die Szene, die sich ihnen bot. Die beiden Besucher lenkten Paul so sehr ab, dass auch er plötzlich still war.
»Was ist denn hier los?« Dési sah von einem zum anderen.
Selbst den Tränen nahe, saß Fee noch immer auf dem Boden im Esszimmer.
»Ich fürchte, kleine Kinder sind nichts mehr für mich.« Dankbar ergriff sie die Hand, die Joshua ihr hinhielt, und ließ sich hochziehen.
»Das ist jetzt wirklich blöd.« Dési schickte ihrem Freund einen ebenso schnellen wie frechen Seitenblick. »Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du auf unser Baby aufpassen würdest.«
Einen Moment lang herrschte gespenstische Stille im Esszimmer der Familie Norden.
»Du bist schwanger? Bleibt Joshua etwa deshalb …« In diesem Moment entdeckte Felicitas das vergnügte Funkeln in Désis Augen. »Na warte, du Frechdachs. Das wirst du mir büßen.«
»Nicht nötig. Joshua und ich übernehmen freiwillig die Kinderbetreuung. Nicht wahr?«
»Ja, klar. Immerhin schulde ich dir etwas für den Schrecken, den ich dir eingejagt habe.«
»Richtig erkannt.« Dési lächelte. »Du bist ein kluger Mann.«
Das zärtliche Geplänkel wurde unterbrochen von einem grellen Knall, gefolgt von klirrendem, rieselnden Regen. Die drei Erwachsenen zuckten erschrocken zusammen.
»Wo ist Paul?«, fragte Fee und lief im nächsten Moment los.
Dési und Joshua tauschten vielsagende Blicke.
»Ich weiß nicht, ob das mit dem Babysitting so eine gute Idee war«, gab er zu bedenken.
Doch für solche Zweifel war es jetzt zu spät.
*
Matthias Weigand hatte kaum den Schockraum verlassen, als er einen Anruf bekam.
»Sie müssen schnell kommen!« Sophie Petzolds Atem ging schnell.
»Ich hoffe, Sie hatten einen guten Grund, es so dringend zu machen«, keuchte er, als er kurz darauf ins Büro stürmte.
Wortlos hielt sie ihm das Tablet hin.
»Die Aufnahmen von Jakob Sperling?«, fragte er nach einem kurzen Blick auf den Bildschirm.
Sophie schluckte und nickte. Ihre Augen glänzten verdächtig. Sie hielt es nicht mehr auf ihrem Stuhl aus und stand auf.
»Sehen Sie auch, was ich sehe?«
Matthias konzentrierte sich. Er klickte sich durch jedes Bild und betrachtete es eingehend. Schließlich lehnte er sich zurück.
»Sieht nach einem Abszess aus. Wir müssen so schnell wie möglich operieren.«
Sophie schniefte. Mit der linken Hand fuhr sie sich über das Gesicht.
Matthias drehte sich zu der Assistenzärztin um.
»Was ist das denn jetzt? Haben Sie im Medizinstudium nicht gelernt, dass professionelle Distanz überlebenswichtig für den Patienten ist?«, fragte er streng. »Mal abgesehen davon, dass ein Hirnabszess zwar lebensbedrohlich sein kann, aber nicht zwingend in einer Katastrophe enden muss.«
Es war eines der seltenen Male, in denen die Assistenzärztin nicht widersprach.
»Ja, ich weiß«, erwiderte sie kläglich und nahm das Taschentuch, das er ihr hinhielt.
»Schön. Dann sparen Sie sich die Tränen für das Happy-End und kommen Sie mit!«
Matthias ärgerte sich über den weichen Unterton in seiner Stimme, der viel zu viel über seine Gefühle verriet.
Doch Sophie Petzold war zu aufgewühlt, um irgendetwas zu bemerken.
»Alles klar.« Sie putzte sich die Nase, straffte die Schultern und gab sich einen Ruck.
Als sie ein paar Minuten später an der Seite von Dr. Weigand Jakobs Krankenzimmer betrat, war jede Spur der Trauer aus ihrer Miene getilgt.
Jakob hatte es sich im Bett bequem gemacht und blätterte in einer Zeitschrift. Sein erwartungsvoller Blick flog hinüber zu den beiden Ärzten.
»Heute ist Ihr Glückstag! Sie sind die ersten Besucher und haben eine Flasche Wasser gewonnen.«
Normalerweise liebte Sophie den Humor des Pflegers. Doch an diesem Nachmittag verzogen sich ihre Lippen nur zu einem dünnen Lächeln.
Matthias lachte pflichtschuldig und zog sich einen Stuhl heran. Er warf einen Blick auf die Unterlagen in seinen Händen.
»Herr Sperling … oder darf ich Jakob sagen?«
Diese Frage war eine zu viel. Plötzlich lächelte auch Jakob nicht mehr.
»Was ist los?«, fragte er tonlos. »Sagen Sie mir die Wahrheit!«
»Also schön.« Matthias nahm ihn ins Visier. »Sie haben einen Abszess im Gehirn.«
Jakob zog eine Augenbraue hoch.
»Einen Abszess? Bei Ihrem Gesicht hatte ich eher an einen Tumor gedacht. Irgendwas Fieses. Aber ein Abszess?«
Nun musste Sophie doch lächeln. Genauso wie Matthias.
»Vielen Dank für die Blumen. Nichtsdestotrotz ist es nicht so harmlos, wie es klingen mag. Ich will Ihnen nichts vormachen: Ein Hirnabszess kommt zwar nur selten vor, kann aber durchaus lebensbedrohlich werden.«
»Ich weiß, wovon Sie sprechen«, winkte Jakob ab. »Wenn Krankheitserreger in das Hirn gelangen, können Sie eine örtliche Entzündung hervorrufen. Dabei kann sich Eiter in einer Art Kapsel ansammeln und einen neuen Hohlraum bilden, der die Hirnmasse verdrängt, den Fluss des Hirnwassers stört und ein paar andere Kalamitäten mehr.«
Dr. Weigand verdrehte die Augen.
»Meine Güte. Noch einen Besserwisser mehr halte ich nicht aus«, stöhnte er.
»Keine Sorge, die Behandlung überlasse ich Ihnen«, versicherte Jakob. Trotz der gravierenden Diagnose war ihm ein Stein vom Herzen gefallen.
»Sehr freundlich von Ihnen.« Matthias war noch nicht fertig. »In Ihrem Fall hat der Abszess übrigens die Größe eines Wachteleis. Er liegt zentral im Gehirn in einer Tiefe von zwei bis drei Zentimetern«, las er von seinem Tablet ab. »Wir werden noch während der Operation den Bakterienstamm und ein geeignetes Antibiotikum zu seiner Bekämpfung ermitteln. Mit diesem Antibiotikum werden Sie über einen längeren Zeitraum behandelt werden. Nur so kann … «
»… verhindert werden, dass sich ein neuer Abszess bildet«, vollendete Jakob den Satz.
Matthias Weigand räusperte sich.
»Richtig. Ich habe den OP-Termin für heute Nachmittag festgesetzt. Mit etwas Glück haben Sie keine bleibenden Schäden zu befürchten.« Matthias stand auf und blickte auf seinen Patienten hinab. »Nach dem Eingriff werden Sie innerhalb kürzester Zeit wieder ansprechbar sein. Die Frage nach einem Tumor können wir leider erst danach beantworten.« Von seiner Seite aus war für den Moment alles gesagt. »Haben Sie noch Fragen?«
»Kann Frau Petzold noch bleiben?«
Matthias Weigand sah hinüber zu seiner Kollegin. Wie angewurzelt stand sie vor Jakobs Bett und kämpfte schon wieder mit den Tränen.
»Es tut mir so leid«, flüsterte sie. Es war offensichtlich, dass sie ihren Chef völlig vergessen hatte.
Matthias zögerte kurz, bevor er sich entschied zu schweigen und das Zimmer ohne ein weiteres Wort verließ.
*
Adrian Wiesenstein ging neben Dr. Daniel Norden über den Flur.
»Wer wird an der Operation teilnehmen?«
Darüber hatte auch der Klinikchef schon nachgedacht.
»Dieser Eingriff wird durch die ganze Presse gehen. Die Klinik wird im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen. Deshalb werde ich persönlich die Leitung übernehmen.«
»Ich würde Ihnen gern assistieren.«
Abrupt blieb Daniel stehen und drehte sich zu dem Chirurgen um.
»Sie?« Ein Lächeln zuckte in seinen Mundwinkeln. »Tut mir leid, Kollege Wiesenstein. Nichts gegen Ihre Fähigkeiten als Chirurg. Aber selbst wenn keine emotionale Bindung mehr besteht, glaube ich nicht, dass das eine gute Idee wäre. Ihre Ex-Frau scheint nicht gerade gut auf Sie zu sprechen zu sein …«
»Ich weiß«, winkte Adrian ab. »Das liegt aber nicht an meiner Person. Ich bin Paola völlig egal. Es geht einzig und allein um Joshua. Sie denkt, dass ich ihn beeinflusst habe. Aber das ist nicht richtig.«
»Trotzdem denke ich, dass Sie bei dem Eingriff nicht dabei sein sollten«, beharrte Daniel auf seiner Entscheidung.
Die beiden Männer standen sich auf dem Flur gegenüber. Fieberhaft suchte Adrian nach einem Argument, mit dem er seinen Chef überzeugen konnte.
»Bitte überdenken Sie Ihre Entscheidung noch einmal«, bat er schließlich. »Ich fühle mich verpflichtet, alles für Paola zu tun, was in meiner Macht liegt.«
Daniel musterte seinen Mitarbeiter.
»Schuldgefühle sind ein ganz schlechter Ratgeber«, bemerkte er. »Ich werde Ihnen meine Entscheidung rechtzeitig mitteilen.« Er lauschte auf das Stimmengewirr im Hintergrund. »Und jetzt werde ich mich wohl oder übel der Presse stellen müssen.« Er nickte Adrian Wiesenstein noch einmal zu, ehe er sich abwandte und durch die Glastür trat, hinter der bereits eine Menge Reporter und Fotografen auf ihn wartete. Es war nur dem Verwaltungsdirektor zu verdanken, dass sie die Klinik nicht längst gestürmt hatten.
*
Allmählich wurde es Jakob Sperling doch mulmig zumute. Schwester Elena bereitete ihn auf den bevorstehenden Eingriff vor. Mit einem Ohrthermometer maß sie Fieber.
»Sie sind in Bestform«, lobte sie ihn und notierte den Wert im Patientenblatt.
»Dann kann ich ja an die Arbeit gehen.« Jakob schlug die Bettdecke zurück und gab vor, aufstehen zu wollen.
»Daraus wird leider nichts.« Lächelnd deckte Elena ihn wieder zu. »Weglaufen gilt nicht!« Sie hatte ihre Vorbereitungen beendet. »Dr. Petzold holt Sie gleich ab. Ah, da ist sie schon.«
Doch es war Dr. Daniel Norden, der ins Zimmer kam. Die Klinikpost funktionierte wieder einmal einwandfrei. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit hatte ihm eine Schwester von Jakobs Erkrankung erzählt. Als der Krankenpfleger seinen Chef erblickte, schlug er sich mit der Hand gegen die Stirn.
»Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich sollte der netten Frau Wolter Bescheid sagen wegen ihres Enkels.«
Leise verließ Schwester Elena das Zimmer. Daniel ließ sich nicht davon stören.
»In Anbetracht der Umstände verzeihe ich Ihnen noch einmal«, scherzte er. Er griff nach der Akte und studierte den Befund. Das Lächeln auf seinen Lippen versickerte. »Was machen Sie denn für Sachen?«
Jakob seufzte. Je näher der Termin rückte, umso schlechter fühlte er sich. »Am Anfang war ich froh, dass es kein Tumor ist. Aber jetzt bekomme ich es doch mit der Angst zu tun.«
»Das müssen Sie nicht«, versicherte Daniel und klappte die Akte wieder zu. »Mit Dr. Weigand, dem Neurologen Merizani und unserer engagierten Frau Dr. Petzold haben Sie herausragende Kollegen um sich geschart.«
Jakob schnitt eine Grimasse.
»Nur das Beste ist eben gut genug.«
»Das ist die richtige Einstellung.« Daniel griff nach dem kleinen Becher und der Tablette, die Elena auf dem Nachttisch bereit gestellt hatte. Beides reichte er dem Pfleger. »Und jetzt sollten Sie sich noch ein wenig ausruhen. Die Operation wird kein Spaziergang.«
Jakob schluckte die Pille und spülte mit Wasser nach. Sinnend starrte er auf den Becher in seiner Hand, ehe er zu Dr. Norden aufblickte.
»Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hergekommen sind«, sagte er leise. »Ich weiß, wie viel Sie um die Ohren haben. Da ist es schon eine Auszeichnung für einen kleinen Pfleger wie mich …«
»Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt! Ohne Menschen wie Sie würde das ganze System hier nicht funktionieren. Jeder Kollege, ob Pfleger, Schwester oder Arzt, ja, sogar das Reinigungspersonal, ist überlebenswichtig für die Klinik. Jeder Einzelne trägt seinen Teil zum Erfolg des Ganzen bei. Deshalb sind Sie genauso wichtig wie ein Herzspezialist«, erklärte Dr. Norden leidenschaftlich. Er griff nach Jakobs Hand und drückte sie. »Das sollten Sie nie vergessen. Und jetzt bringen Sie diesen Eingriff hinter sich, damit Sie uns bald wieder mit ganzer Kraft zur Verfügung stehen.«
»Das mache ich.« Jakobs Stimme war heiser. Er legte sich im Bett zurück und sah Dr. Norden nach, wie er zur Tür ging.
Daniel war schon zur Tür hinaus, als er den Kopf noch einmal ins Zimmer steckte.
»Übrigens werden Doppelschichten in Zukunft nicht mehr vorkommen. Darum kümmere ich mich persönlich«, versprach er noch, ehe er endgültig ging.
*
Das Chaos war unbeschreiblich. Im ganzen Wohnzimmer glitzerte und funkelte es wie an Weihnachten. Das Licht der Sonne brach sich in den großen und kleinen Scherben. Dazwischen lagen zwei bunte Holzkugeln. Draußen vor der Terrassentür stand Klein-Paulchen. Mit großen Augen und zitternder Unterlippe starrte er auf das, was vom Wohnzimmerfenster übrig geblieben war.
»Das war ich nicht«, erklärte er mit piepsiger Stimme.
Doch das interessierte im Augenblick niemanden.
»Tu ein Mal das, was man dir sagt, und rühr dich nicht vom Fleck«, bat Fee. »Nur ein einziges Mal.«
Joshua überlegte nicht lange und machte sich auf den Weg.
»Aber ich will zu meiner Mama.«
»Glaubst du nicht, dass deine Mama dich fürchterlich schimpfen wird?«, fragte Dési. Sie wusste, was ihr Freund vorhatte, und wollte ihm Zeit verschaffen.
Entschieden schüttelte Paul den Kopf.
»Meine Mama schimpft mich nie.«
»Das erklärt so einiges«, raunte Fee ihrer Tochter zu und beobachtete Joshua dabei, wie er durch den Garten schlich. Wie ein Löwe an seine Beute pirschte er sich an den Jungen heran.
Paul hatte ganze Arbeit geleistet. Nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch auf der Terrasse lag zerbrochenes Glas. Es grenzte an ein Wunder, dass ihn keine umherfliegenden Splitter getroffen hatten. Doch selbst jetzt war die Gefahr noch nicht gebannt. Ein wackeliger Kinderschritt, ein Sturz, und die Katastrophe wäre perfekt.
Damit Paul das Knirschen hinter sich nicht hörte, stimmte Dési ein Kinderlied an. Sie stieß ihre Mutter in die Seite. Fee verstand und setzte mit ein. Paul starrte die beiden Frauen an. Es war ihm anzusehen, dass er an ihrem Verstand zweifelte. Diese günstige Gelegenheit ergriff Joshua. Er setzte zu einem beherzten Sprung an, packte den Jungen und riss ihn in seine Arme. Bei der Landung geriet er in Schieflage und schwankte wie eine Tanne im Wind.
»O mein Gott!« Fee hielt die Luft an. Bruchteile von Sekunden dehnten sich in die Länge wie Kaugummi. Endlich fand Joshua das Gleichgewicht wieder. Er brachte Paul in Sicherheit und stellte ihn auf die Wiese. Strahlend lächelnd drehte er sich um und empfing den Applaus seines Publikums.
»Bravo! Bravissimo!«, riefen Mutter und Tochter durcheinander.
»Zur Feier des Tages schicke ich euch beide jetzt in die Eisdiele«, erklärte Fee ein paar Minuten später im Garten und drückte Dési einen Geldschein in die Hand.
»Und was ist mit dir?«
»Einer muss ja die Scherben aufräumen.«
»Dann bleibe ich auch hier«, beschloss Dési ohne Zögern.
»Und wir zwei Hübschen holen Eis und sehen den Frauen dann bei der Arbeit zu. Was hältst du davon?«, machte Joshua dem Jungen einen Vorschlag.
Ein paar Minuten später hielt er einen Besen in der Hand und kehrte die Scherben auf der Terrasse auf, während Dési mit Paul Richtung Eisdiele spazierte.
*
Dr. Daniel Norden saß am Schreibtisch und ließ seinen Blick über die Kollegen wandern, die er zu dieser Besprechung eingeladen hatte.
»Wie sich sicherlich inzwischen herumgesprochen hat, haben wir eine prominente Patientin mit einer erheblichen Verletzung im Haus. Frau Wiesenstein hat sich bei einem Verkehrsunfall eine offene Unterschenkelfraktur zugezogen. Es handelt sich also um einen anspruchsvollen Eingriff.«
»Ein Traum!« Der Orthopäde Bernhard Kohler meinte es ernst.
Daniel lächelte ihm zu.
»Schön, dass Sie derselben Ansicht sind wie die Herrschaften von der schreibenden Zunft. Für sie ist der Unfall ein gefundenes Fressen. Der Fall wird durch die Presse gehen.« Dr. Norden wurde wieder ernst. »Umso wichtiger ist es, dass die Operation reibungslos verläuft.« Er lehnte sich vor und legte die Fingerspitzen aneinander. »Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, neben Ihnen, Kollege Kohler, Frau Lekutat um Unterstützung zu bitten.«
Adrian Wiesenstein schoss hoch.
»Wieso? Ich dachte, es wäre mir gelungen …«
»Ich habe mir die Sache reiflich überlegt«, fiel Daniel Norden ihm mit strenger Stimme ins Wort. »Glücklicherweise kann ich über eine ansehnliche Schar ausgezeichneter Chirurgen verfügen. In Anbetracht Ihrer unstreitbaren emotionalen Bindung zu Ihrer Ex-Frau ist mir dieses Risiko zu hoch. Außerdem verfügt Frau Lekutat«, er nickte der Kollegin zu, »über ein ansehnliches Wissen auf dem Gebiet der Osteosynthese. Daher möchte ich ihr diese Aufgabe anvertrauen.
»Wirklich schade, dass Sie die falschen Lehrgänge besucht haben.« Die Chirurgin lächelte ihrem Kollegen zu. »Knochenchirurgie ist ein sehr interessantes Feld. Übrigens noch ein Thema, das wir heute Abend besprechen können.«
In diesem Moment wäre Adrian am liebsten über den Tisch gesprungen. Allein seine gute Erziehung hielt ihn davon ab. Dr. Norden dagegen ignorierte diese Bemerkung wohlweislich.
»Ein weiterer Grund für meine Entscheidung ist die Tatsache, dass bei diesem Eingriff – wie das immer der Fall ist – etwas schief gehen kann. Unter keinen Umständen möchte ich mich fragen lassen, warum ich den Eingriff nicht in die Hände eines Spezialisten gelegt habe.« Er schickte einen vielsagenden Blick in die Runde. »Gibt es sonst noch Fragen, Wünsche, Anregungen?«
Schwester Elena hob die Hand und stellte eine Frage zu den eingeplanten Operationsschwestern. Nach ein paar weiteren Wortmeldungen löste sich die Versammlung auf.
»Das ist eine wahnsinnig spannende Sache!« Auf dem Rückweg in die Abteilung war Christine richtig aufgeregt. »An Ihrer Stelle würde ich mich auch ärgern.« Sie klopfte Adrian auf die Schulter. »Aber das Trostpflaster wartet schon heute Abend auf Sie. In welches schicke Restaurant wollen Sie mich denn entführen?«
Adrian traute seinen Ohren nicht.
»Tut mir leid. Aber dieses Vergnügen kann ich mir wirklich sparen«, herrschte er sie an, ehe er türenknallend im nächsten Zimmer verschwand.
*
Der Eingriff bei Jakob Sperling stand kurz bevor. Der Zugang war gelegt, die Beruhigungstablette tat ihre Wirkung. Eine Schwester schob seine Liege in den Operationssaal, wo sie ihn den kundigen Händen der Anästhesistin überließ.
»Dann wollen wir mal!« Dr. Ramona Räther nickte Jakob zu und steckte eine Spritze mit einer durchsichtigen Flüssigkeit in den Zugang.
»Wenn ihr Lächeln das Letzte ist, das ich sehe, bin ich zufrieden«, murmelte er.
Es fiel ihr leicht, seinen Wunsch zu erfüllen. Ihr Lachen war Musik in seinen Ohren. Langsam spritzte sie das Narkosemittel in die Vene.
»Zählen Sie bis zehn«, forderte sie ihn auf.
»Machen Sie Witze? So schnell kriegen Sie mich nich …« Die Augen fielen dem Pfleger zu, und im nächsten Moment schlief er tief und fest. Dr. Räther kontrollierte Atmung und Temperatur. Die Geräte zur Überwachung der Vitalfunktionen piepten gleichmäßig.
Ramona sah hinüber zur Glasscheibe, die den OP vom Vorraum trennte. Das Operationsteam hatte sich versammelt. Letzte Vorbereitungen wurden getroffen. Nur zu gut kannte die Anästhesistin diese Minuten kurz vor Beginn einer OP. Sie fühlte sich wie in einer Raumkapsel. Abgeschnitten von der Außenwelt, schienen sich selbst die Zeiger der Uhr langsamer zu bewegen. Dr. Räther konnte nicht verstehen, was draußen gesprochen wurde. An den Lippenbewegungen erkannte sie nur, dass sich Dr. Merizani mit dem Kollegen Weigand unterhielt. Die Assistenzärztin Sophie Petzold stand schweigend daneben. Normalerweise das Selbstbewusstsein in Person, erinnerte sie Ramona in diesem Moment an ein scheues Reh. Immer wieder wanderte Sophies Blick durch die Scheibe hinüber zum Operationstisch. Ihre Lippen öffneten sich, als wollte sie Jakob etwas zurufen. Doch sie holte nur kurz Luft – Ramona bemerkte es an ihrer Brust, die sich hob und senkte – und schloss den Mund wieder. Als Dr. Weigand sich zu Sophie umdrehte und sie ansprach, reagierte sie nicht. Erst, als er die Hand auf ihre Schulter legte, zuckte sie zusammen und fuhr zu ihm herum. Er sagte ein paar Worte. Sie presste die Lippen aufeinander und nickte. Die Ärzte machten sich auf den Weg. Im nächsten Atemzug öffneten sich die Türen zur Raumkapsel. Wie ein Schwall Wasser spülten die Geräusche herein. Die Wirklichkeit hatte Ramona wieder. Sie sah auf die Uhr. Seit sie Jakob in den Schlaf geschickt hatte, war nur eine Minute vergangen. Die Anästhesistin nickte den Kollegen zu.
»Meinetwegen können wir anfangen.«
*
Auch die Vorbereitungen für den Eingriff bei Paola Wiesenstein waren in vollem Gang. Nachdem der Anästhesist die Patientin über die Risiken der Narkose aufgeklärt hatte, kam Dr. Norden noch einmal ins Zimmer. Aufklärung wurde in seiner Klinik großgeschrieben. Und das nicht nur aus rechtlichen Gründen. Schon in seiner Praxis hatte Daniel die Erfahrung gemacht, dass eine gelungene Aufklärung das Verständnis und die Behandlungszufriedenheit der Patienten unterstützte. Nicht zuletzt gab ein gutes Arzt-Patient-Verhältnis den Betroffenen Sicherheit und trug zu einer schnellen Genesung bei.
»Wie fühlen Sie sich?«, erkundigte er sich bei Paola, die ihm erwartungsvoll entgegensah.
»Fragen Sie nicht! Ich bin froh, wenn das hier vorbei ist.«
»Bald haben Sie es geschafft«, versprach der Klinikchef und zog sich einen Stuhl heran. »Ich habe die neuesten Aufnahmen aus der Radiologie bekommen.« Er schaltete das Tablet ein und zeigte Paola die Aufnahmen. »Das hier ist Ihr Schienbein, wie es derzeit aussieht. Der Bruch hat zwei ziemlich spitze Knochenenden hinterlassen. Das untere Stück«, er deutete auf die entsprechende Stelle auf dem Bildschirm, »bohrt sich hier ins Gewebe.«
»Schon gut. Ersparen Sie mir die Details.« Paola winkte ab. »Mich interessiert nur, wann ich wieder Theater spielen kann.«
Es klopfte, und Dieter Fuchs trat ein.
»Störe ich?«
Daniel Norden stand auf. Die Ernüchterung stand ihm ins Gesicht geschrieben.
»Kommen Sie nur. Wir waren sowieso fertig.«
»Das sehe ich anders«, begehrte Paola auf. »Wann kann ich wieder auftreten?«
Doch Daniel zog es vor, dem Verwaltungsdirektor das Feld zu überlassen.
»Nach der OP kann ich Ihnen mehr dazu sagen«, versicherte er und verließ das Zimmer.
Dieter Fuchs trat ans Bett der berühmten Patientin.
»Ich hoffe, Sie fühlen sich gut aufgehoben in unserem Haus.«
Mit verschränkten Armen saß Paola im Bett und kochte vor sich hin.
»Sparen Sie sich das Geplänkel. Was wollen Sie von mir?«
Die Miene des Verwaltungsdirektors gefror zu Eis. Was konnte er dafür, dass sie nicht die gewünschte Auskunft erhalten hatte?
»Wann wollen Sie wieder Interviews geben? Ich muss den Leuten von der Presse irgendwas sagen. Die stürmen mir sonst die Bude«, erklärte er schroff. »Sie haben ja keine Ahnung, was hier los ist.«
»Ach, denken Sie?« Paola lächelte herablassend. »Da täuschen Sie sich gewaltig, mein Lieber. Ich erlebe diesen Tumult bei jedem meiner Auftritte. Aber mir ist schon klar, dass ein Mann wie Sie von so viel Aufmerksamkeit nur träumen kann«, fuhr sie mitleidig fort. »Sagen Sie der Meute da draußen, dass ich für Interviews zur Verfügung stehe, sobald mich die Herrschaften hier wieder zusammengeflickt haben.«
Dieter Fuchs kochte innerlich vor Wut. Doch zur Not verfügte auch er über beachtliche Schauspielerqualitäten.
»Wann soll die Operation stattfinden?«
»Wenn ich Herrn Dr. Norden richtig verstanden habe, in einer Stunde.«
»Gut.« Dieter nickte. »Dann weiß ich Bescheid.« Er ging zur Tür. »Ich wünsche gutes Gelingen.« Eigentlich hatte er vorgehabt, die berühmte Schauspielerin um ein Autogramm zu bitten, um es im Internet zu Geld zu machen. Doch nach ihrer ruppigen Abfuhr verbot ihm schon sein Stolz dieses Vorhaben.
*
Der Klinikkiosk hatte sich in einen Bienenstock verwandelt. Stimmen summten und brummten unablässig. Hier und da war ein Lachen zu hören. Als der Verwaltungsdirektor vor die Presse trat, erstarben die Stimmen. Erwartungsvolle Blicke richteten sich auf ihn. Das Klicken der Kameras ging wie ein Platzregen über ihm hernieder. Dieter warf sich in die Brust.
»Der Zustand von Frau Wiesenstein ist unter den gegebenen Umständen zufriedenstellend«, erklärte er in das Blitzlichtgewitter. »Wir sind optimistisch, dass wir ihre Verletzungen optimal versorgen können.«
»Es ist durchgesickert, dass Frau Wiesenstein einen offenen Bruch erlitten hat. Werden Sie diese Verletzung selbst behandeln oder sie in eine orthopädische Spezialklinik verlegen?«, fragte eine Journalistin.
»Über Art und Umfang der Verletzung kann nur Frau Wiesenstein selbst Auskunft geben«, klärte der Verwaltungschef die Reporter auf und beglückwünschte sich insgeheim für seine Professionalität.
»Wird sie wieder laufen können?«
»Was sagt Ihr Freund Pierre dazu?«
»Wann kann sie die Klinik verlassen?« So und anders tönten die Fragen durcheinander.
Dieter Fuchs rieb sich die Hände. Sein großer Moment war gekommen.
»Ich bedaure es selbst außerordentlich, aber leider hat Frau Wiesenstein kein Interesse daran, Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Sie lässt Ihnen ausrichten, sie hätte schon in normalen Zeiten genug mit der ›Meute‹ zu tun. Jetzt will sie Ihre Ruhe haben.«
Ein Raunen und Schimpfen ging durch die Runde.
Mit einer Verbeugung beendete Dieter Fuchs die Fragestunde und kehrte zufrieden in sein Büro zurück.
Selbst Paola Wiesenstein würde einsehen müssen, dass man sich einen Dieter Fuchs nicht ungestraft zum Feind machte.
*
Mit einem schnalzenden Geräusch zog Dr. Maria Maurer die Latexhandschuhe von den Händen.
»Das wurde ja allerhöchste Zeit.« Sie maß die Patientin auf der Liege mit ernstem Blick. »Ihr Blinddarm ist hochgradig entzündet. Wir müssen Sie so schnell wie möglich operieren.« Sie erhob sich vom Hocker und ging zum Telefon.
»Der Blinddarm?«, wiederholte Petra Lekutat matt. Auf ihren Wangen prangten rote Flecken, die Augen waren glasig. »Ich dachte, den wäre ich längst los.« Sie räusperte sich. »Aber dann war das wohl doch die Gallenblase.«
Dr. Maurer wählte eine Nummer und wartete.
»In Ihrem Alter kann man schon einmal den Überblick verlieren«, tröstete sie ihre Patientin. Endlich wurde das Gespräch angenommen. »Regina? Gut, dass ich Sie gleich erwische. Ich brauche einen OP. Am besten so schnell wie möglich. Und ein paar Kollegen. Ist jemand frei?« Sie lauschte in den Hörer und nickte. »Gut. Wir sind in fünf Minuten da.« Sie legte auf, um Petra Lekutat die frohe Botschaft zu überbringen.
Der Kopf der Patientin lag auf der Seite, ihr Mund stand halb offen.
»Frau Lekutat?«
Doch Petra antwortete nicht. Dann ging alles ganz schnell. Dr. Maurer überprüfte die Vitalfunktionen der Patientin und stülpte ihr eine Atemmaske über. Gemeinsam mit einer herbeigerufenen Schwester machten sie sich auf den Weg zum OP.
Auf halbem Weg kam ihnen Dr. Wiesenstein im Laufschritt entgegen.
»Ist das die Patientin mit dem Appendix?«, rief er schon von Weitem.
»Wahrscheinlich ist er inzwischen perforiert. Frau Lektutat ist ohnmächtig geworden. Sie hat hohes Fieber. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren.«
Adrian schloss sich dem Transport an.
»Frau Lekutat?«
»Ganz recht. Das ist die Mutter unserer Chirurgin.«
Sie hatten ihr Ziel erreicht. Die automatischen Schiebetüren öffneten sich.
Im Vorraum des Operationssaals stand Christine Lekutat mit dem Orthopäden Kohler zusammen und unterhielt sich über die gelungene Operation von Paola Wiesenstein. Beim Eintreffen der neuen Patientin drehten sich beide um.
Im nächsten Moment schnappte Christine nach Luft. Das Blut sackte ihr in die Beine. Sie schwankte kurz.
»Mama! Was ist mit ihr?«
»Blinddarmperforation«, gab Dr. Maurer die gewünschte Auskunft. »Wir müssen uns beeilen, sonst schafft sie es nicht.«
Christine überlegte nicht lange.
»Ich übernehme das.« Sie eilte zum Waschbecken und drehte den Wasserhahn auf.
»Was soll das werden, wenn es fertig ist?«, fragte Adrian scharf.
»Seit wann verstehen Sie kein Deutsch? Ich habe gesagt, dass ich operiere.«
Christine stellte den Wasserhahn ab und griff nach einem der Handtücher auf dem Stapel. Sie musste zwei Mal nachfassen, ehe sie es erwischte.
»Das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie waren über drei Stunden im OP. Sie müssen sich ausruhen.«
»Das ist meine Mutter«, schluchzte Dr. Lekutat auf.
Wenn Adrian eines nicht leiden konnte, dann waren es Frauentränen.
»Sie werden Ihre Mutter umbringen, wenn Sie jetzt da reingehen. Das werde ich nicht zulassen.« Er packte sie an den Schultern und drehte sie zu sich herum. »Nehmen Sie doch Vernunft an.«
Christine sah aus, als wollte sie sich losreißen und an ihm vorbei in den Operationssaal stürmen. Doch plötzlich sackte sie in sich zusammen. Ihr Kinn fiel auf die Brust und sie begann, bitterlich zu weinen.
»Also … also gut«, schluchzte sie. »Aber ich werde assistieren.«
Adrian rollte mit den Augen und ließ sie los.
»Nein, verdammt! Ich brauche Leute, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Wenn Sie wirklich etwas für Ihre Mutter tun wollen, dann verschwinden Sie jetzt von hier.«
Christine hob den Kopf. Ihre Tränen hatten die Kontaktlinsen weggespült, und ihr Blick war verschwommen.
»Das wird ein Nachspiel haben. Ich verspreche es«, drohte sie dem Kittel, der an einem Haken an der Wand hing.
Adrian war längst im OP verschwunden, um seine Pflicht zu tun und Petra Lekutats Leben zu retten.
*
Die Sorgen um ihre Mutter hielten Christine Lekutat davon ab, an ihre Arbeit zurückzukehren. Händeringend lief sie vor dem Operationssaal auf und ab. Sie war so vertieft in ihre Schuldgefühle, dass sie Schwester Elena nicht bemerkte. Daniel Norden hatte sie geschickt.
»Hier stecken Sie! Der Chef sucht sie schon überall. Er will die Operation von Frau Wiesenstein besprechen.«
»Ich kann jetzt nicht!«
»Wie bitte?« Die Ablehnung kam einer Arbeitsverweigerung gleich. »Aber …«
Trotz der Brille, die sie aufgesetzt hatte, verschwamm Christines Blick schon wieder.
»Meine Mutter … Sie ist da drin. Appendixperforation.« Mit zitternder Hand deutete sie auf die Tür des OPs. »Seit Tagen klagt Mama über Bauchschmerzen und Übelkeit. Aber ich habe sie einfach nicht beachtet. Ich dachte, sie heischt wieder einmal um Aufmerksamkeit.«
Elena musterte die Chirurgin, eine steile Falte zwischen den Augen. So hatte sie Christine nie zuvor gesehen.
»Bitte machen Sie sich keine Vorwürfe. Wer denkt denn bei Bauchschmerzen gleich an so etwas?«
»Ich bin Ärztin. Ich hätte es wissen müssen«, begehrte Christine auf. »Wissen Sie, Mama schimpft ständig, dass ich zu viel arbeite und zu wenig Zeit für sie habe. Da wird man schon mal betriebsblind. Und jetzt, jetzt ist es vielleicht zu spät. Dieser Gedanke … Der macht mich wahnsinnig. Mama …« Ihre Stimme erstickte in Tränen.
Schwester Elena konnte nicht anders. Sie beugte sich hinab und drückte Christine an sich.
»Alles wird gut«, versprach sie. »Und beim nächsten Mal machen Sie es einfach besser.«
Irritiert schob Christine sie von sich.
»Wie soll das gehen? Haben Sie in Anatomie nicht aufgepasst? Meine Mutter hat nur einen Blinddarm. Wie jeder andere Mensch auch.«
Schwester Elena rang noch mit der Fassung, als sich die Türen zum OP öffneten und zwei Schwestern herauskamen. Adrian Wiesenstein folgte ihnen. Er lächelte.
»Alles in Ordnung. Ihre Mutter kommt durch.«
Einen Moment lang sah Christine Lekutat so aus, als wollte sie ihm um den Hals fallen. Zu seiner Erleichterung tat sie es nicht. Nachdem sie die Tränen getrocknet hatte, sah sie zu ihm auf.
»Unter den gegebenen Umständen werden Sie verstehen, dass ich Ihre Einladung heute Abend leider ausschlagen muss.«
Schwester Elena, die hinter ihr stand, sah Adrian fragend an. Der schnitt eine Grimasse.
»Ihre Mutter braucht Sie jetzt«, sagte er zu Christine.
»Das haben Sie völlig richtig erkannt. Und sie sollten sich besser mal um Ihren Sohn kümmern. In diesem Alter kommen Kinder auf die dümmsten Gedanken. Da unterscheiden sie sich kaum von alten Leuten.« Christine nickte ihm zu, ehe sie sich abwandte und den Raum verließ.
Noch immer ruhte Elenas Blick auf Adrian.
»Sagen Sie jetzt nichts«, bat er sie und machte sich ebenfalls auf den Weg.
*
Nach und nach tauchte Jakob aus den Tiefen seines Unterbewusstseins auf. Schuld daran war auch der Schmerz, der wie ein Presslufthammer in seinem Kopf hämmerte. O Mann, ich trinke nie mehr!, schoss es ihm durch den Kopf. Sein Hals war trocken, alles tat ihm weh. Seine Kehle fühlte sich an wie Sandpapier. Wo war ich gestern Abend?, fragte er sich im Geiste. Was ist bloß los in meinem Kopf? Dieses Pfeifen und Piepen macht mich noch wahnsinnig!
»Ich trinke nie mehr einen Schluck Alkohol«, stöhnte er. Passend zur Sandpapierkehle klang seine Stimme wie ein Reibeisen.
»Wie bitte?«, fragte ein Mann dicht neben ihm.
Jakob wollte die Augen aufreißen. Doch seine Lider gehorchten ihm nicht. Alles, was er zustande brachte, war ein mageres Blinzeln. Ein grelles Licht blendete ihn so sehr, dass ihm das Wasser in die Augen schoss und er erst recht nichts mehr erkennen konnte.
»Alkohol. Nie mehr«, wiederholte er krächzend.
Der Mann lachte. In das Lachen mischte sich eine weibliche Stimme.
»Willkommen zurück, Jakob«, begrüßte Sophie Petzold ihn. Ihre Stimme schwankte vor Erleichterung. »Wirklich schade, das mit dem Alkohol. Zur Feier der überstandenen Operation wollte ich eigentlich eine Flasche Schampus springen lassen.«
Jakob wagte einen zweiten Versuch. Unter ungeheuren Anstrengungen öffnete er die Augen. Es dauerte eine Weile, doch nach und nach wurde das Bild klarer. Zwei Menschen standen vor seinem Bett. Er war sicher, dass er sie kannte.
»Sophie … ich meine Frau Dr. Petzold. Herr Dr. Weigand«, begrüßte er sie.
Matthias schmunzelte.
»Ich hätte schon erwartet, dass Sie mich als Erstes begrüßen. Immerhin haben Sie es mir zu verdanken, dass Sie den Abszess in Ihrem Kopf losgeworden sind.«
»Jeder, der in dieser Klinik arbeitet, ist ein wichtiges Rädchen, das nicht fehlen darf.« Jakob durchforstete seinen Kopf. »Oder so ähnlich. Das hat jedenfalls Dr. Norden gesagt.«
»Ein kluger Mann«, erwiderte Sophie und sah Matthias triumphierend an. Sie wippte auf den Fußsohlen vor und zurück.
»Schon gut, ich habe verstanden«, erwiderte er verschnupft und holte den kleinen Computer heraus, auf dem sämtliche Informationen über den Patienten gesammelt waren. Zeit, das Thema zu wechseln.
»Um zu den wichtigen Themen zu kommen: Die Operation ist sehr gut verlaufen.«
»Sie haben auch keinen Tumor, wie wir zunächst gefürchtet haben«, platzte Sophie heraus und handelte sich einen tadelnden Blick ihres Vorgesetzten ein.
»Wie schon vor der Operation besprochen, bekommen Sie eine Antibiotika-Therapie, bis wir die Ursache für den Abszess herausgefunden haben«, fuhr Matthias Weigand fort.
Jakob nickte langsam und versuchte, die Gedanken in seinem Kopf zu sortieren. Zugegebenermaßen war das nicht ganz einfach.
»Wann kann ich wieder aufstehen?«, erkundigte er sich schließlich.
»Sobald Sie das Gefühl haben, stark genug zu sein. Aber bitte keine Alleingänge. Wenn Sie ins Bad müssen, rufen Sie bitte eine Schwester.«
»Oh, schön, ich bekomme einen Babysitter.« Jakob versuchte ein Lächeln.
»Keine Sorge. Nur so lange, bis wir sicher sind, dass Sie wieder mobil sind.« Matthias Weigand schaltete das Tablet aus. »Sicher wollen Sie sich noch kurz allein mit Frau Dr. Petzold unterhalten.«
»Haben Sie bei der Operation einen Blick in meine Gedanken geworfen?«, scherzte Jakob. Der Versuch zu lachen endete in einem Hustenanfall.
»Runter vom Gas, junger Mann!«, mahnte Matthias Weigand, als sein Patient sich endlich wieder beruhigt hatte und matt in den Kissen lag. »Sie haben noch ein gutes Stück Weg vor sich. Sparen Sie Ihre Kräfte.« Matthias schickte Sophie einen Blick, den sie schwer deuten konnte, es in diesem Moment aber auch nicht wollte.
Sie wartete, bis die Tür mit einem leisen Klacken ins Schloss gefallen war. Dann setzte sie sich auf die Bettkante und griff nach Jakobs Hand.
»Sie dürfen nicht erschrecken, wenn Sie beim Laufen anfangs noch ein bisschen unsicher sind«, sagte sie, ehe das Schweigen peinlich wurde. »Das darf Sie nicht beunruhigen. Jeder Schritt bringt Sie in die richtige Richtung und macht Sie sicherer.« Ihre Stimme klang wohlig wie das Schnurren einer Katze. Seine Hand in der ihren schloss Jakob die Augen. »Wenn Sie wollen, helfe ich Ihnen, so oft ich kann.« Sophies fragender Blick ruhte auf Jakob, bis ihr schließlich klar wurde, dass er sie nicht mehr hörte. Sein regelmäßiger Atem verriet, dass er seiner Genesung entgegen schlief. Eine Weile saß sie noch am Bett. Sie genoss die Gelegenheit, ihn ausgiebig ansehen zu können. Jede Kleinigkeit seiner Gesichtszüge sog sie auf wie ein Schwamm, entdeckte das Muttermal auf seiner linken Wange und die feine Narbe über dem Auge. Dabei flatterte ihr Herz wie ein aufgeregter, kleiner Vogel in ihrer Brust. Sie hätte den Rest des Tages dort sitzen und den Pfleger anhimmeln können. Er war so anders als die Männer, die sie bisher kennengelernt hatte. Ein grelles Scheppern – wahrscheinlich eine Nierenschale, die auf den Boden gefallen war – riss sie aus ihren Gedanken.
Ohne lange darüber nachzudenken, streckte Sophie die Hand aus und streichelte Jakobs Wange. Dann musste sie sich wohl oder übel wieder an die Arbeit machen, nichtahnend, dass sie Jakobs Lächeln hinausbegleitete.
*
Allmählich neigte sich auch dieser lange, ereignisreiche Tag seinem Ende entgegen. Die Luft war schwer vom Blütenduft, ein warmer Windhauch bewegte die Zweige von Sträuchern und Bäumen. Die Folie in Fees Hand blähte sich und knisterte.
»Ein Glück, dass Sommer ist.« Felicitas Norden stand auf der Leiter. Mit einer Hand hielt sie die Plastikplane fest, die andere streckte sie zu Dési aus. Die reichte ihr einen Streifen Klebeband, mit dem Fee die Folie am verbliebenen Glas befestigte. »Sonst würden wir heute Nacht glatt erfrieren.«
»Wann kommt der Glaser?«
»Am Montagvormittag. Dummerweise habe ich Frühdienst.« Fee befestigte ein weiteres Stück Klebeband, diesmal etwas weiter unten.
Dési trat einen Schritt zurück und betrachtete das Kunstwerk.
»Gar nicht mal so schlecht. Das könnte ein neuer Trend werden.«
Mutter und Tochter lachten noch, als Joshua mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf die Treppe hinunter schlich.
»Keine Kinder! Niemals«, verkündete er. Er ließ sich in den Sessel fallen, um gleich darauf mit einem spitzen Schrei wieder aufzuspringen. Eine übrig gebliebene Scherbe steckte in seinem Allerwertesten.
Mit spitzen Fingern erlöste seine Freundin ihn von der Pein. Bevor sich Joshua ein zweites Mal setzte, untersuchte Dési die Polstermöbel noch einmal genau.
Endlich konnte er alle Glieder von sich strecken. Dési stand vor ihm und betrachtete ihn mit gerunzelter Stirn.
»So schlimm?«
»Drei Mal musste ich Paul Kasperl und das Krokodil vorspielen. Danach wollte er unbedingt Balu sehen. Du weißt schon, das ist der Bär aus dem Dschungelbuch.
Natürlich erinnerte sich Dési. Doch es war Fees Stimme, die aus dem Hintergrund erklang. »Probier’s mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit …«, trällerte sie gut gelaunt vor sich und legte ein paar Tanzschritte auf’s Parkett.
Dési lachte. Doch Joshua entkam noch nicht einmal ein Lächeln.
»Am Ende habe ich Paul gefühlt eure gesamte Kinderbuchsammlung vorgelesen. Darüber ist er endlich eingeschlafen.« Sein Seufzen kam aus tiefster Seele.
»Selbst schuld, wenn du ein so begnadeter Schauspieler und Vorleser bist«, spottete Dési gutmütig und sprang ihrer Mutter zu Hilfe, die die Leiter zusammenklappte. »Bei mir flehen die Kinder meistens schon nach fünf Minuten um Gnade.«
In ihre Worte hinein klingelte ein Handy. Joshua verdrehte die Augen.
»Bitte, bitte geh du ran. Ich kann nicht mehr.«
Dési tat ihm den Gefallen und meldete sich.
»Hallo, Herr Wiesenstein«, begrüßte sie Joshuas Vater. »Joshua lässt sich entschuldigen. Er liegt im Kinderkoma.« Es hatte ein Scherz sein sollen.
Doch Adrian ging nicht darauf ein.
»Kannst du ihm bitte ausrichten, dass seine Mutter in der Klinik liegt.
»Waaas?«
»Keine Panik. Es ist alles in Ordnung. Ich hatte nur keine Gelegenheit, früher anzurufen.« In knappen Worten erklärte Adrian, was passiert war. »Mich will Paola nicht sehen. Aber ich denke, es wäre eine gute Idee, wenn sich Joshua bei ihr blicken ließe, um sich mit ihr auszusprechen.« Er machte eine kleine Pause. »Zwischen den beiden hat lange genug Eiszeit geherrscht«, fuhr er heiser fort.
Désis Herz wurde weich wie Watte.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Wiesenstein. Joshua weiß genau, wo er hingehört«, erklärte sie feierlich und versprach, Joshua die Botschaft auszurichten.
Der hing noch immer wie ein Vogel mit gebrochenen Schwingen im Sofa.
»Wenn du Kinder willst, bin ich auf jeden Fall der falsche Mann«, erklärte er mit geschlossenen Augen. »Was wollte Papa?«
Dési lachte leise.
»Keine Panik. Die Papa-Nummer hat noch Zeit. Zuerst einmal musst du ein guter Sohn sein und dich um deine Mum kümmern. Sie liegt mit einem gebrochenen Bein in der Klinik. Aber keine Sorge, es ist alles okay.«
Schlagartig kam wieder Leben in Joshua.
»Meine Eltern sind auch nicht viel besser als Kinder«, sagte er kopfschüttelnd zu Fee, als er sich zum Aufbruch rüstete. »Ständig muss man aufpassen, dass sie keine Dummheiten machen.« Er umarmte sie kurz.
Dési begleitete ihn zur Tür.
»Soll ich mitkommen?«, fragte sie.
Joshua legte die Arme um ihre Schultern. Sein Blick streichelte ihr Gesicht.
»Nein, das muss ich allein erledigen«, sagte er leise. »Aber ich bin wahnsinnig froh, dass es dich noch in meinem Leben gibt und du in Gedanken bei mir bist.« Er küsste sie, ehe er sich im schwindenden Tageslicht aufs Fahrrad schwang, um in die Klinik zu fahren.
*
Bevor sich Dr. Daniel Norden an diesem Abend auf den Nachhauseweg machte, sah er noch einmal bei seiner Nachbarin Anna Wolter vorbei.
Sie saß aufrecht im Bett, der Fernseher lief. Wann immer draußen Schritte zur hören waren, huschte ihr Blick zur Tür. Den ganzen Nachmittag waren sie nur an ihrer Tür vorbeigeeilt. Doch diesmal erfüllte sich ihre Hoffnung.
»Herr Dr. Norden, endlich!«
Daniel lachte.
»Das ist ja mal eine schöne Begrüßung!«, freute er sich und setzte sich auf die Bettkante.
»Nicht so bescheiden!«, neckte Anna ihn. »Ich bin sicher, Ihre Patienten liegen Ihnen zu Füßen.«
»Weit gefehlt.« Schnell schob Daniel den Gedanken an Paola Wiesenstein weg. »Aber Ihre Herzlichkeit entschädigt mich für vieles. Geht es Ihnen so gut, wie Sie aussehen?«
Annas Wangen färbten sich zartrosa.
»Leider nicht«, gestand sie. »Ich wüsste zu gern, was aus meiner Freundin Petra geworden ist. Sie hat mich heute besucht. Wegen ihrer Übelkeit wollte sie sich von einem Arzt untersuchen lassen und danach zurückkommen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gesehen. Telefonisch kann ich sie auch nicht erreichen. Dabei habe ich extra den Anschluss anmelden lassen.« Sie deutete auf das Telefon auf dem Nachtkästchen. »Wissen Sie vielleicht, was aus ihr geworden ist?«
An diesem Tag hatte Daniel den Namen Petra nur in einem Zusammenhang gehört.
»Meinen Sie zufällig Petra Lekutat, die Mutter unserer Chirurgin?«
Anna Wolters Miene erhellte sich.
»Genau die! Was ist mit ihr?«
Daniel Norden dachte kurz darüber nach, wie viel er verraten durfte, ohne sein Schweigegelübde zu brechen.
»Frau Lekutat wurde operiert.« Anna schlug die Hand vor den Mund, und Daniel fuhr schnell fort. »Keine Sorge! Soweit ich weiß, ist sie inzwischen aus der Narkose erwacht. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut.«
»Meine Güte. Was für ein Tag!« Anna schüttelte den Kopf. »Ein Glück, dass man vorher nicht weiß, was einen alles erwartet.«
»Das können Sie laut sagen.« Wohlweislich verschwieg Daniel die neueste Heldentat von Paul. Anna Wolters würde früh genug erfahren, was der kleine Räuber wieder angestellt hatte.
»Wie geht es übrigens meinem Enkel?« Anna schien seine Gedanken lesen zu können. »Ich hoffe, er hat Ihrer Frau und Dési nicht zu viel Arbeit gemacht.«
»Alles bestens. Machen Sie sich keine Sorgen«, versicherte er. »Im Übrigen denke ich, es wäre das Beste, wenn Sie noch ein paar Tage in der Klinik blieben. In dieser Verfassung werden Sie mit dem Bengel auf keinen Fall fertig.«
»Ein großes Wort gelassen ausgesprochen.« Anna Wolter zwinkerte ihm zu. »Ich gebe zu, dass mich diese Sorge auch umtreibt. Petra fällt ja jetzt als Hilfe aus. Auf der anderen Seite will ich Ihnen und Ihrer Familie nicht zur Last fallen.«
»Keine Sorge.« Daniel nickte ihr aufmunternd zu und erhob sich. Allmählich wurde es Zeit, nach Hause zu gehen. »Gemeinsam werden wir das Kind schon schaukeln.«
In Anna Wolters Augen glitzerte es verdächtig, als er sich von ihr verabschiedete.
»Das nennt man wohl Glück im Unglück, einen Engel wie Sie zu kennen«, sagte sie heiser und wischte schnell die Träne fort, die über ihre Wange lief.
*
Schon auf dem Weg zu seiner Mutter hörte Joshua Paolas Stimme.
»›Je höher du wirst aufwärts gehn, dein Blick wird immer allgemeiner‹«, rezitierte sie eine Zeile aus ihrer Rolle aus einem Schauspiel von Shakespeare.
Joshua war vor der Tür angekommen.
Er grub die Fingernägel in die Handfläche. Sein Herz hämmerte in seiner Brust.
Endlich gab er sich einen Ruck und trat ein. Paola bemerkte ihn nicht. Mit geschlossenen Augen saß sie halb aufrecht im Bett und vollführte große Gesten. Ihre Stimme klang dramatisch.
»›Stets einen größeren Teil wirst du vom Ganzen sehn …‹«
»Mama!«
Paola schien die Welt um sich vergessen zu haben.
»›Doch alles Einzelne wird immer kleiner …‹«
»Hallo, Mama!«, wiederholte Joshua energisch.
Endlich öffnete Paola die Augen. Sie sah ihn an, als hätte sie ihn nie zuvor gesehen. Es dauerte einen Moment, bis sie aus anderen Sphären zurückgekehrt war.
»Joshua?« Im ersten Moment huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Bis sie sich daran erinnerte, dass sie wütend auf ihn war. »Was willst du?« Demonstrativ griff sie nach ihrem Schminkbeutel auf dem Nachtkästchen. Sie nahm Puderdose und Quaste heraus und vertiefte sich in ihr Spiegelbild.
Joshua stand noch immer in der Tür. Hatte er es nötig, sich so behandeln zu lassen? Schließlich beschloss er, Gnade vor Recht ergehen zu lassen.
»Wie geht es dir?«
Paola stutzte.
»Sehr gut. Danke der Nachfrage«, erwiderte sie leichthin. »Die Operation ist gut verlaufen. Jetzt muss ich ungefähr vier Wochen auf Krücken gehen. Danach folgt das Muskelaufbautraining. Das dauert etwa zehn bis zwölf Wochen. Wenn ich darauf achte, das Bein nicht zu sehr zu belasten, darf ich in dieser Zeit wieder auf die Bühne.« Sie winkte lächelnd ab. »Also alles halb so wild.«
»Das freut mich.«
»Willst du dich nicht setzen? Dein Gezappel macht mich ganz nervös.« Paola klappte die Puderdose zu und packte sie wieder weg.
»Klar.« Joshua sah sich um und holte einen Stuhl vom Tisch in der Ecke.
»Ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten.«
Paolas Miene wurde abweisend.
»Ich wüsste nicht, worüber.«
»Mensch, Mama. Jetzt tu doch nicht so!«, brauste Joshua auf. Er hatte genug von dem Theater. »Findest du das nicht selbst alles ein bisschen seltsam?«
»Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst.«
»Gib dir keine Mühe.« Joshua verzog den Mund. »Du bist zwar eine glänzende Schauspielerin. Aber die Unschuld vom Lande nimmt dir keiner ab.«
Ihre Blicke schossen wütende Blitze auf ihn ab.
»Ich glaube nicht, dass ich es nötig habe, so mit mir reden zu lassen.«
Joshua atmete tief durch.
»Tut mir leid. Du hast recht. Fangen wir noch einmal von vorn an. Warum bist du nach all den Jahren nach München gekommen?«
»Um dich zu sehen. Du bist mein Sohn.«
Unwillkürlich musste Joshua Gespräch mit Dési denken. »Daran dachtest du offenbar nicht, als du Papa und mich vor acht Jahren verlassen hast. Seitdem hatten wir kaum Kontakt. Erinnerst du dich?«, fragte er ernst. »Ich dachte immer, deine Karriere wäre dir wichtiger als deine Familie. Und dann stehst du plötzlich vor der Tür und tust so, als wäre nichts geschehen. Als hätte es die Jahre nicht gegeben.«
Paola zuckte mit den Schultern.
»Na und? Was ist daran verkehrt? Ich weiß wirklich nicht, worauf du hinaus willst.« Das war die Wahrheit. Joshua spürte es. Er konnte es in ihrem Gesicht lesen. »Warum kannst du dich nicht einfach darüber freuen, dass ich wieder da bin? Dir darüber hinaus die Chance biete, eine hervorragende Schauspielausbildung zu bekommen?«
In diesem Moment wusste Joshua, dass es vergebliche Liebesmüh war.
»Weil wir zu verschieden sind«, gestand er endlich sich selbst und auch seiner Mutter ein. »Wir leben in unterschiedlichen Welten. Vielleicht sogar in verschiedenen Universen. Du bist Äonen weit weg von mir.«
»Diesen Unsinn hat dir sicher dein Vater eingeredet«, schnaubte Paola.
»Nein. Papa hat auch nicht von mir verlangt, hier in München zu bleiben. Das war meine Entscheidung allein.« Wieder musste er an seine Erlebnisse mit Dési denken. An die Verbundenheit mit ihr, die er während der Suche nach Paul empfunden hatte. An die überschäumende Freude, die sie geteilt hatten. »Bitte versteh mich nicht falsch. Ich will nicht so sein wie du. Kein schillernder Schmetterling, der von Blüte zu Blüte taumelt. Der nur im Hier und Jetzt lebt und weiter flattert, wenn eine andere Blume lockt.« Die Gedanken an Dési und ihre Familie, an Adrian, seine Freunde und sogar an Paul wärmten Joshuas Herz. Er wusste, dass er auf dem richtigen Weg war. Ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen. »Im Gegensatz zu dir gefällt es mir, Bindungen einzugehen. Ich mag es, zu jemandem zu gehören. Eine Familie, eine Freundin zu haben. Das fühlt sich gut und sicher an.«
»Du bist ein Romantiker«, konterte Paola. »Es gibt keine Sicherheit im Leben.«
»Das sehe ich anders. Bei Papa fühle ich mich sicher. Und bei Dési und ihrer Familie auch.« Joshua stand auf und beugte sich über seine Mutter. »Aber weißt du was? Wir können trotzdem Freunde sein. Auch wenn wir so verschieden sind.«
Als er Paola einen Kuss auf die Wange drückte, gelang es ihr nicht länger, die kühle Fassade aufrecht zu erhalten.
»Du bist der beste Sohn, den eine Mutter sich wünschen kann«, raunte sie ihm ins Ohr. Sie nahm das Taschentuch, das Joshua für sie aus dem Spender auf dem Nachtkästchen zupfte, und betupfte sich die Augen.
»Das finde ich, ehrlich gesagt, auch«, witzelte er und ging zur Tür. »Ich komme morgen wieder vorbei.« Joshua winkte, ehe er das Krankenzimmer verließ. Walzertanzend schwebte er über den Flur Richtung Ausgang.
*
Auch Christine Lekutat konnte endlich in den wohlverdienten Feierabend gehen. An diesem Abend führte sie ihr Weg allerdings nicht nach Hause. Sie hielt ihr Versprechen und betrat das Krankenzimmer ihrer Mutter.
»Blumen? Aber das wäre doch nicht nötig gewesen.« Petras Strahlen strafte ihre Worte Lügen.
»Ich muss mich bei dir entschuldigen«, nuschelte Christine. Sie ging hinüber zum Schrank, um eine Vase zu holen, und füllte sie im Bad mit Wasser. »Ich dachte nicht …«
»Schon vergeben und vergessen«, winkte Petra ab. »Ich bin froh, dass ich noch lebe. Der Arzt, dieser Dr. Wiesental, war vorhin bei mir. Er hat mir erzählt, wie knapp es war und dass du dir große Sorgen gemacht hast.« Sie drückte die Hand ihrer Tochter. »Ein reizender Mann übrigens. Und so einfühlsam.«
Christine rollte mit den Augen.
»Ich finde ihn ziemlich aufdringlich. Er bettelt schon die ganze Zeit, dass ich mit ihm ausgehen soll. Sogar heute wollte er mich zum Essen einladen. Er dachte allen Ernstes, ich lasse dich im Stich.«
»Ich hätte nichts dagegen gehabt.«
»Du lässt dich auch von jedem freundlichen Mann um den Finger wickeln.«
Unwillig schnalzte Christine mit der Zunge. »Weißt du eigentlich, dass du dich wie eine einsame, alte Frau benimmst?«
»Das stimmt doch auch. Wenn du nicht so viel arbeiten würdest, wäre ich nicht so einsam«, hielt Petra dagegen.
»Auch das ist übrigens ein Grund, warum ich auf eine nähere Bekanntschaft mit dem Kollegen Wiesenstein verzichte«, schwindelte Christine. »Dann hätte ich nämlich gar keine Zeit mehr für dich.«
Diesem Argument hatte Petra Lekutat nichts entgegenzusetzen.
»Du bist ein gutes Kind«, murmelte sie. »Es tut mir leid, dass ich dir solchen Kummer mache.« Die Operation steckte der alten Dame noch in den Knochen. Vergeblich versuchte sie, das Gähnen zu unterdrücken.
»Schon gut, Mama.« Christine Lekutat lächelte. »Hauptsache, du kommst schnell wieder auf die Beine.« Sie blieb so lange am Bett sitzen, bis ihrer Mutter die Augen zufielen.
Dann hatte sie es plötzlich eilig. Mit fliegenden Fahnen verließ sie das Krankenzimmer und eilte über den Klinikflur Richtung Aufenthaltsraum der Ärzte. Dort hatte sie den Kollegen Wiesenstein zuletzt gesehen.
Adrian hatte längst nach Hause gehen wollen. In Straßenkleidung stand er noch mit Schwester Elena zusammen und unterhielt sich mit ihr über den aufregenden Tag, als er aufhorchte.
In der ganzen Klinik gab es nur einen Menschen, der beim Gehen solche Geräusche machte. Adrenalin schoss ihm ins Blut und bereitete ihn auf die Flucht vor. Panisch sah er sich um.
»Haben Sie eine Idee, wo ich mich verstecken könnte?«
Elena sah sich um.
»Unter der Spüle?«
»Zu klein. Da passe ich nie und nimmer rein.« Er überlegte noch, ob er sich hinter der Tür verstecken sollte, als Christine hereinkam. In seiner Verzweiflung tat Adrian das einzige, was ihm einfiel. Blitzschnell zog er Elena an sich und presste seine Lippen auf die ihren.
Christine erstarrte.
»So ist das also!«, schnaubte sie zutiefst verletzt, drehte sich um und stürmte aus dem Aufenthaltsraum.
»Puh, das war knapp.« Adrian ließ Elena los und atmete auf. »Vielen Dank. Sie haben mir gerade das Leben …«
Ein Klatschen übertönte den Rest seines Satzes. Im nächsten Moment sah er Sternchen.
»Das hat gesessen.« Er öffnete die Augen wieder.
Zu seiner Verwunderung lächelte Elena.
»Ich bin eine glücklich verheiratete Frau und möchte es auch bleiben«, erklärte sie. »Aber bitteschön, ich habe Ihnen gern das Leben gerettet. Solange es bei diesem einen Mal bleibt.«
»Versprochen.« Adrian hob die Hand zum Schwur. »Ob Sie es glauben oder nicht: Im Augenblick habe ich die Nase gestrichen voll von Frauen.« Er ging zur Tür und lugte hinaus. Die Luft war rein. Von Christine Lekutat war keine Spur mehr zu sehen, und Adrian zögerte nicht länger, seinen Plan, nach Hause zu gehen, endlich in die Tat umsetzen.
*
Im Gegensatz zu seinen Kollegen hatte Dr. Matthias Weigand in dieser Nacht Bereitschaft. Um sich die Zeit bis zum nächsten Notfall sinnvoll zu vertreiben, stattete er seinem Patienten Jakob Sperling einen Abendbesuch ab.
»Das sieht ja schon wieder ganz gut aus«, bemerkte er mit einem Blick auf die Geräte, die Jakobs Vitalfunktionen aufzeichneten.
»Ich fühle mich auch wie neugeboren.«
»Dafür ist wohl eher die Kollegin Petzold verantwortlich.« Matthias hatte noch nicht ausgesprochen, als er sich am liebsten selbst geohrfeigt hätte.
Welcher Teufel ritt ihn nur? Er verspürte doch sonst keinen Hang zur Bosheit. Es musste an Sophie liegen, dass er sich nicht zurückhalten konnte.
Jakob schienen ähnliche Gedanken durch den Kopf zu gehen.
»Was ist eigentlich mit Ihnen los, Dr. Weigand?«, fragte er. »Sie sind doch sonst ein ganz umgänglicher Typ. Was haben Sie gegen Frau Petzold?«
Matthias räusperte sich und vertiefte sich in die Aufzeichnungen im Patientenblatt.
»Bestimmt haben Sie schon mitbekommen, dass Frau Dr. Petzold denkt, wir eingesessen Kollegen wären in der Steinzeit stehengeblieben.«
»Ich persönlich habe davon noch nichts gemerkt. Zu mir ist sie immer sehr nett.« Jakob grinste. »Sie hat viel Mitgefühl.«
»Zu viel Mitgefühl ist in unserem Beruf nicht hilfreich. Das sollten Sie als Pfleger doch am besten wissen.« Er zückte einen Kugelschreiber, um die neuen Werte in die Karte einzutragen.
Jakob sah ihm dabei zu.
»Ich sehe das anders. Meiner Ansicht nach muss man immer offen sein für neue Ideen. Keine Erkenntnis der Welt ist in Stein gemeißelt. Außer vielleicht, dass wir alle sterben müssen.« Das Lächeln auf seinem Gesicht wurde tiefer. »Aber das hat noch viel Zeit.«
»Vielen Dank für die Belehrung.« Auch Matthias Weigand rang sich ein Lächeln ab. »Aber ehrlich gesagt bin ich nicht gekommen, um mich mit Ihnen über die Kollegin Petzold zu unterhalten.«
»Sie haben angefangen, Doktor.«
»Ich? Ähm … nun ja …« Schnell nahm Matthias das Tablet zur Hand, auf dem sich die neuesten Untersuchungsergebnisse befanden. »Wie dem auch sei, die Untersuchungen haben keinen Aufschluss über die Ursache des Abszesses gegeben. Deshalb werden wir die Antibiotika-Behandlung bis zur Ihrer Entlassung fortführen. Sonst laufen Sie Gefahr, dass sich das gesamte Krankheitsbild in ein paar Monaten wieder genauso ereignet.« Er sah von dem kleinen Bildschirm auf. »Sonst noch Fragen?«
»Kann es sein, dass Sie Angst davor haben, dass Frau Petzold eines Tages die bessere Ärztin von Ihnen beiden sein wird?«
»So einen Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört.« Kopfschüttelnd ging Matthias zur Tür. »Sie sollten eine Runde schlafen, damit Sie wieder klarer denken können.« Mit diesen Worten verließ er das Zimmer.
Jakobs Lachen folgte ihm. Im Gegensatz zu dem Pfleger ahnte er, warum er so wütend auf Sophie war. Doch genauer darüber nachdenken wollte er lieber nicht. Deshalb schob er diesen Gedanken schnell wieder weg.
*
»Was für ein Tag!« Seufzend ließ sich Dr. Daniel Norden neben seine Frau auf die Couch fallen. Er lehnte den Kopf an Fees Schulter und musterte das mit Folie verklebte Fenster. »Hat was Futuristisches. Vielleicht wird das ein neuer Trend.«
Felicitas lachte und fischte eine Olive aus einem der Schälchen auf dem Tisch.
»Das hat Dési heute auch schon gemeint.«
»Kein Wunder. Wir sind ja auch verwandt.« Daniel richtete sich auf und unterzog den Imbiss, den Felicitas vorbereitet hatte, einer eingehenden Musterung.
»Paul ist aber auch mit Frau Wolter verwandt, und die beiden haben keinerlei Ähnlichkeit. Zum Glück«, schob Fee hinterher.
»Apropos Paul.« Das Stichwort erinnerte Daniel an etwas. Besser, er brachte es gleich hinter sich. »Leider habe ich eine schlechte Nachricht.«
Fee zog eine Augenbraue hoch.
»Und die wäre?«
»Anna Wolter muss mindestens noch zwei, drei Tage in der Klinik bleiben. Und auch danach wird sie kaum in der Lage sein, sich um ihren Enkel zu kümmern.«
»Die arme Dési!«, seufzte Fee aus tiefstem Herzen. »Bis Carina Wolter ihren Sohn wieder abholt, sind die Ferien auch vorbei. Dabei würde Dési ein bisschen Zeit mit Joshua gut tun.«
Daniel legte den Arm um die Schultern seiner Frau und zog sie an sich.
»Wieso? Jetzt, da er hierbleibt, haben die beiden doch noch alle Zeit der Welt. Solange sie auf dieses ungezogene Kind aufpassen, kommen sie wenigstens nicht auf dumme Gedanken«, murmelte er an ihren Lippen. »Ganz im Gegensatz zu mir.«
Fee lachte leise und wollte in seinen Armen dahinschmelzen, als sie von Scheinwerferlicht durch die Folie fiel, über die Couch wanderte und wieder verschwand.
»Wer mag das sein?« Fee lauschte auf das Motorengeräusch, das gleich darauf verstummte. »Erwartest du noch Besuch?«
Daniel dachte kurz nach.
»Nein. Und ehrlich gesagt kann ich nach diesem Tag auch gut und gern darauf verzichten.«
Sein Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen. Er hatte noch nicht ausgesprochen, als es klingelte.
»Ich gehe schon.« Fee erhob sich, und Daniel sah ihr nach, wie sie das Zimmer durchquerte. In all den Jahren hatte ihr Gang nichts von seiner Geschmeidigkeit verloren. Er lehnte sich zurück und ließ die Gedanken zurückwandern in die Zeit, als die Zukunft noch vor ihnen gelegen hatte. Bilder blitzten in ihm auf. Fee mitten auf einer Sommerwiese, wie sie ihm Löwenzahnschirmchen ins Gesicht pustete. Bei einem großen Teller Spaghetti im ersten gemeinsamen Urlaub. Vor einem Schloss in der Pose der Schlossherrin persönlich.
»Dan!« Fees leise Stimme weckte ihn. Er musste kurz eingeschlafen sein. »Dan! Wir haben Besuch. Frau Wolter ist hier« raunte sie ihm zu.
Daniel zuckte zusammen. Es dauerte einen Moment, bis er zu sich kam.
»Aber die ist doch in der Klinik.« Er rieb sich die Augen und gähnte herzhaft.
»Ich meine ihre Tochter, Carina Wolter.«
Plötzlich kam Leben in ihn. Daniel folgte seiner Frau in den Flur.
»Frau Wolter, das ist ja eine Überraschung. Wir haben erst in ein paar Tagen mit Ihnen gerechnet.« Er nahm Carinas Hand. Sie war eiskalt.
»Mein Auftrag in Zürich ist überraschend geplatzt. Wissen Sie, ich bin Journalistin für die ›Kultur heute‹ und sollte die Premiere der großartigen Paola Wiesenstein für unsere Leser mitverfolgen«, erzählte Carina mit großer Geste. »Leider wurde die Ärmste bei einem Autounfall verletzt. Stellen Sie sich vor: Paola ist so geschockt von den Ereignissen, dass sie noch nicht einmal mit der Presse sprechen will. Sie hat ihre Fans sogar als ›Meute‹ bezeichnet.« Ihr Mitgefühl war echt. »Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, wie schlecht es ihr gehen muss.«
Nur mit Mühe konnte sich Daniel ein Lachen verkneifen. Es war ihm zu Ohren gekommen, was Dieter Fuchs zu den Journalisten gesagt hatte. Er kannte den Verwaltungsdirektor gut genug, um wissen, dass nur ein perfider Plan hinter dieser Aktion stecken konnte. Carina Wolters Worte bewiesen, dass Fuchs ein weiteres Mal gescheitert war.
»Kein Wunder, dass Frau Wiesenstein nach diesem Schrecken durcheinander ist. Zum Glück geht es ihr zumindest körperlich den Umständen entsprechend gut«, teilte er Carina mit. »Wie Ihrer Mutter im Übrigen auch.«
»Ach ja, meine Mutter!« An Anna erinnert, presste Carina die Hände auf das Herz. »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Den ganzen Tag habe ich versucht, Mama zu erreichen.«
»Anna ist gestürzt und liegt mit einer Steißbeinverletzung in der Klinik.«
»Ich weiß. Ihre Frau hat mir gerade davon erzählt. Gleich morgen früh werde ich in die Klinik fahren. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie sich um Paulchen gekümmert haben. Ach, ich bin noch ganz aufgeregt.«
Daniel überlegte nicht lange.
»Kommen Sie.« Er fasste Carina sanft am Ellbogen und führte sie ins Wohnzimmer. »Bitte, setzen Sie sich.«
Carina wollte seiner Aufforderung gerade folgen, als ihr Blick an dem verklebten Fenster hängenblieb.
»Du liebe Zeit. Ihre Scheibe ist ja kaputt. Wie ist denn das passiert?«
»Wir haben einen Moment lang nicht aufgepasst«, erwiderte Fee, die mit einem dritten Weinglas ins Wohnzimmer kam. »Diese Gelegenheit hat Paul genutzt und mit zwei Krocketkugeln Weitwurf geübt.«
Carina sank in den Sessel. Ihr ungläubiger Blick ruhte auf dem Ehepaar.
»Sie müssen sich irren.« Entschieden schüttelte sie den Kopf. »So etwas würde Paulchen nie tun. Der Kleine ist ein wahrer Engel. Er hat noch nie etwas angestellt. Fragen Sie meine Mutter.«
»Aber … «, wollte Felicitas aufbegehren. In diesem Moment spürte sie die Hand ihres Mannes auf ihrem Arm.
»Schon möglich«, lenkte Daniel um des lieben Friedens willen ein. »Es war ein langer, anstrengender Tag. Da bringt man schon einmal etwas durcheinander.« Er hob sein Glas. »Und ein Gutes hatte der Unfall von Frau Wiesenstein ja: Jetzt können Sie sich selbst um ihren Engel kümmern.« Hell klangen die Gläser aneinander.
Carina trank einen Schluck, ehe sie ihren Wein auf den Tisch zurückstellte.
»Wo ist mein Süßer denn?«
»Oben im Gästezimmer. Wenn Sie wollen, bringe ich Sie rauf«, bot Fee an und war schon aufgestanden, bevor Carina Gelegenheit zu einer Antwort hatte.
Gemeinsam verließen die beiden das Zimmer.
Nach ein paar Augenblicken kehrte Fee zurück. Sie ließ sich neben ihren Mann auf das Sofa fallen und atmete auf.
»Ist es nicht tröstlich zu wissen, dass sich manche Probleme von selbst lösen?« Ihre Frage wurde von einem schrillen Schrei zerrissen.
»Paul, du kleiner Satansbraten«, kreischte Carina. »Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du keine Zahnpasta unter Türklinken schmieren sollst!«
Daniel und Fee sahen sich an und lachten los.
»Was haben wir doch für ein Glück, dass unsere Sprösslinge niemals Engel, sondern immer ganz normale Kinder waren!«, seufzte Daniel und zog seine Frau an sich.