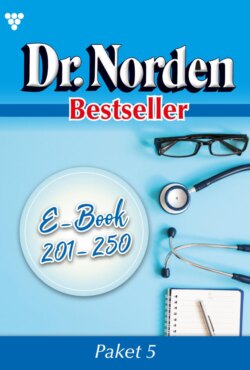Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 5 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBarbara Heinickes Beine konnten sich sehen lassen, doch dafür hatte Dr. Daniel Norden keine Augen. Sie stand auf nackten Füßen in seinem Sprechzimmer vor ihm, aber sein Blick war schnell wieder zu ihrem schmerzverzerrten Gesicht gewandert.
»Wie lange haben Sie diese Schmerzen schon, Frau Heinicke?«, fragte er.
»Ich habe sie schon öfter gehabt, aber noch nie so schlimm«, gab sie zu. »Im Urlaub wurde es dann ganz blöd. Ich konnte nicht mal mehr barfuß am Strand laufen. Aber Sie können ruhig Fräulein zu mir sagen, Herr Doktor, mir macht es nichts aus, wenn ich auch langsam ein altes Mädchen werde.«
»Na, na, na«, lächelte er, »nur nicht übertreiben.«
»Das sind doch sicher schon Verschleißerscheinungen«, sagte sie.
»Mir scheint es eher, dass Sie Einlagen tragen müssten, aber das muss ein Orthopäde entscheiden, und zum Glück haben wir doch einen recht guten in der Nähe.«
»Was, doch nicht den Schnabel? Zu dem geh’ ich nimmer.«
»Der hat seine Praxis doch aufgegeben, wissen Sie das noch nicht?«
»Nein, ich habe mich darum nicht mehr gekümmert. Der hatte doch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Erinnern Sie sich nicht, dass ich mit meinem geschwollenen Bein dann zu Ihnen gekommen bin?«
»Aber sicher erinnere ich mich. Es stellte sich heraus, dass Sie sich einen Dorn eingetreten hatten.«
»Und Schnabel hatte behauptet, ich hätte mir den Fuß verstaucht«, seufzte sie. »Ob dieser Dorn schuld an den Schmerzen ist?«
»Bestimmt nicht«, widersprach Dr. Norden. »Aber ich werde Sie zu Dr. Rosen schicken. Er hat mich bereits überzeugt, dass er ein ausgezeichneter Orthopäde ist.«
»Wenn Sie es sagen. Mir wäre es lieber, Sie könnten mir helfen.«
»Das Übel muss an der Wurzel gepackt werden, und dafür gibt es in solchem Fall eben Orthopäden. Natürlich nicht solche, die sich selbst dazu ernennen. Es hat sich herausgestellt, dass besagter Schnabel Masseur war, der sich zum Facharzt berufen fühlte. Schwamm drüber. Dr. Rosen ist ein wirklicher Facharzt.«
Er war froh, dass er das sagen konnte. Er hatte Dr. Rosen zu einem guten Start verholfen, da er es vermittelt hatte, dass der junge Arzt bis zur Eröffnung seiner Praxis in der Behnisch-Klinik arbeiten konnte, und auch Dr. Behnisch war so angetan von ihm gewesen, dass er ihn am liebsten behalten hätte. Aber inzwischen gab es so viel Bewegungsgeschädigte, dass sie recht froh waren, einen Facharzt mit einer so modern eingerichteten Praxis in der Nähe zu haben. So konnte Dr. Norden der hübschen Barbara Heinicke auch ganz unbesorgt die Überweisung schreiben. Es nützte ihr nichts, wenn er ihr schmerzstillende Mittel verschrieb.
»Am besten suchen Sie Dr. Rosen gleich auf«, sagte er. »Es ist nicht weit zur Buchenstraße.«
»Gleich bei mir um die Ecke«, sagte Barbara. »Und ich hatte keine Ahnung. Da sehen Sie mal, wie wenig Zeit ich habe, mich um die Nachbarschaft zu kümmern.«
Sie war als Reiseleiterin fast ständig unterwegs. Es hatte ihr auch mächtigen Spaß gemacht, überall herumzureisen, aber in letzter Zeit waren die Schmerzanfälle immer häufiger geworden und hatten es ihr fast verleidet, beinahe jede Nacht in einem anderen Bett zu schlafen. Andererseits brauchte sie den Verdienst, denn in der recht schwierigen Wirtschaftslage war es nicht so einfach, eine Stellung zu finden, bei der sie ähnlich viel verdienen konnte, und ihre Wohnung war nicht gerade billig.
Barbara war achtundzwanzig, und es war lange her, dass sie mal von einem Familienleben geträumt hatte. Zwei Enttäuschungen hatten ihr gelangt, um sich fortan nur auf sich selbst zu verlassen.
Sie hatte aber auch so manchen anderen Schicksalsschlag hinnehmen müssen, und es nun doch mit der Angst bekommen, was werden sollte, wenn diese Schmerzen immer stärker wurden.
Jetzt strengte sie sogar das Autofahren an, und kalter Schweiß bedeckte ihren Körper, als sie vor dem Haus in der Buchenstraße hielt, in dem sich jetzt Dr. Rosens Praxis befand.
Die Sprechstundenhilfe, noch ziemlich jung, aber unscheinbar, musterte sie recht aufdringlich. So jedenfalls empfand es Barbara, aber dann erschien schon Dr. Rosen, der gerade den Anruf von Dr. Norden bekommen hatte, sich diese Patientin recht genau anzuschauen.
Dr. Rosen machte auf Barbara, die über eine gute Menschenkenntnis verfügte, die sie ja auch in ihrem Beruf brauchte, einen vertrauenerweckenden Eindruck. Er sah, dass sie sehr bemüht war, ihre Schmerzen zu unterdrücken.
»Wir werden zuerst ein paar Röntgenaufnahmen machen«, erklärte er, »dann werden wir uns unterhalten.«
Im Augenblick war Barbara alles gleich, weil es ihr richtig übel war von den Schmerzen.
Sie legte sich in dem dunklen Raum auf den Röntgentisch, dann musste sie sich auch hinstellen, aber sie konnte sich nur mit Mühe auf den Beinen halten.
Dr. Rosen merkte es. »So, jetzt ist das überstanden«, sagte er und stützte sie, als er sie in den Nebenraum führte.
»Legen Sie sich bitte nieder«, sagte er ruhig. »Sie können sich entspannen. Bitte zuerst auf den Bauch.«
»Es tut aber weh«, stöhnte sie auf.
»Es wird gleich besser werden«, erklärte er ruhig. Sie merkte es fast nicht, wie er ihr die Injektion gab. Es war nur ein ganz feiner Stich, aber manchmal war es ihr schon so gewesen, als würden Hunderte solcher Stiche in ihre Haut dringen. Das sagte sie dann auch.
»Das sind die Nerven«, erklärte er. »Sie haben sich anscheinend zu viel Stress zugemutet.«
»Ich habe gerade drei Wochen Urlaub hinter mir«, sagte sie.
»Wo?«, fragte er.
»Auf den Malediven.«
»Dann war es wohl nicht der richtige Urlaub.«
»Jedenfalls war es kein Stress«, sagte sie bockig.
»Vielleicht zu heiß«, erklärte er gelassen. »Bei einer akuten Nervenentzündung ist Hitze nicht gerade das Beste.«
»Ich dachte, das wäre gerade gut«, sagte Barbara.
»Sie sind Reiseleiterin, wie mir Dr. Norden sagte, also sehr viel unterwegs.«
»Nicht immer in heißen Zonen«, erklärte sie, da sie jetzt schon nicht mehr diese starken Schmerzen hatte mit fester Stimme.
»Mal hier, mal dort, auch mit Bussen?«
»Überwiegend innerhalb Europas.«
»Und jede Nacht in einem anderer Bett«, sagte er mit einem flüchtigen Lächeln.
»Aber allein«, erwiderte sie aggressiv.
Sein Lächeln vertiefte sich.
»Ich meine es so, mal hart, mal weich.«
»Meistens weich«, gab sie zu, »man kann es sich ja nicht aussuchen, und wenn auch die Bettwäsche gewechselt wird, die Matratzen nicht.«
»So ist es«, sagte er. »Und das macht viel aus. Haben Sie wenigsten daheim eine Bandscheibenmatratze?«
»Jedenfalls eine harte, aber wann bin ich schon mal zu Hause. Ich fühl mich schon bedeutend wohler.«
»Und nun möchten Sie am liebsten aufhüpfen und davonlaufen, neuen Abenteuern entgegen. Aber das dürfen Sie jetzt nicht. Ich werde mir nun die Röntgenaufnahmen anschauen.«
Sie war impulsiv und voller Widerspruchsgeist, aber er hatte eine Art, die ihr die Lippen verschloss. Ihr konnte sie so wenig widersprechen wie Dr. Norden.
Sie spürte, dass er seinen Beruf sehr ernst nahm.
Jetzt lag sie ruhig da und fühlte sich wirklich entspannt.
Zum ersten Mal seit langer Zeit war auch nicht das Kribbeln auf ihrer Haut, das taube Gefühl in den Händen und Füßen.
Dr. Rosen kam zurück. »Wie fühlen Sie sich?«, fragte er.
»Sehr gut.«
»Nun, dann werde ich Ihnen zeigen, welches die Ursache Ihrer Beschwerden ist und wie Sie behandelt werden müssen.«
»Aber jetzt spüre ich doch kaum noch was«, sagte Barbara.
»Das wird aber nicht von Dauer sein, Frau Heinicke. Schauen Sie sich die Röntgenaufnahmen an. Es wird eine ganz gezielte Therapie nötig sein.«
»Nächste Woche muss ich aber wieder auf Reisen gehen.«
»Ich werde Sie krankschreiben müssen.«
Sie sah ihn entsetzt an. »Das geht doch nicht, dann verliere ich meine Stellung.«
»Das ist kein Grund zur Kündigung.«
»Bei solchem Job finden sie schon einen Grund«, sagte sie ironisch.
»Ich würde Ihnen sowieso empfehlen, sich eine andere Stellung zu suchen, die es Ihnen ermöglicht, so oft wie nur möglich im eigenen Bett zu schlafen, das allerdings auch eine Bandscheibenmatratze haben sollte.«
»Man findet jetzt aber nicht so rasch einen gut bezahlten Job«, sagte sie leise.
»Versuchen kann man es, und ich wüsste nicht, warum Ihnen das nicht gelingen sollte. Sie sprechen doch sicher mehrere Sprachen.«
»Sie wissen anscheinend nicht, wie viele mit ebensolchen Kenntnissen auf der Straße sitzen«, sagte sie abweisend.
»Ihre Gesundheit sollte Ihnen dennoch wichtiger sein«, sagte er betont. »Es könnte passieren, dass Sie während einer Reise einen Bandscheibenvorfall bekommen, und dann können Sie sich nicht mehr rühren.«
»Guter Gott, das doch nicht«, murmelte sie.
»Hatten Sie nicht vorhin schon einmal das Gefühl zusammenzubrechen?«
»Aber jetzt geht es doch wieder.«
»Weil der Schmerz betäubt ist. Vorerst muss ja auch etwas getan werden, damit die akute Entzündung zurückgeht.« Er machte eine kleine Pause und deutete dann wieder auf ein Röntgenbild. »Da sehen Sie, es besteht auch ein Halswirbelsyndrom. Das muss auch behandelt werden.«
»Also doch schon Alterserscheinungen«, sagte sie resigniert.
»Aber nein, das bekommen auch junge Menschen. Leistungssport, Verkrampfungen, auch Zugwind spielt da eine Rolle, und auch schlechte Betten. Aber wenn Sie mir nicht trauen, fragen Sie auch Dr. Norden.«
»Ich traue Ihnen ja«, erwiderte Barbara leise, »und Dr. Norden hätte mich nicht zu Ihnen geschickt, wenn er Ihnen nicht auch vertrauen würde. Aber mit meinen Füßen ist doch auch was.«
»Mit den Beinen«, sagte er. »Sie müssten Einlagen tragen.«
»Aber ich kann doch nicht in solchen Latschen herumlaufen«, begehrte sie auf.
»Dafür gibt es auch sehr ansehnliche Schuhe«, erklärte er. »Man hat sich den eitlen Damen bereits angepasst. Vor allem dürfen Sie nicht so hohe Absätze bevorzugen. Und wenn Sie alle Ratschläge befolgen, werden Sie sehen, dass es auch ohne Operation geht.«
»Operation? Das kommt überhaupt nicht infrage!«, widersprach sie heftig.
»Sie könnte eines Tages unvermeidbar werden«, sagte er warnend. »Ich muss Ihnen das ganz eindringlich sagen, Frau Heinicke. Jetzt ist noch Zeit für eine Behandlung. Ich gebe Ihnen jetzt zwei Tabletten mit, damit Sie eine möglichst schmerzfreie, ruhige Nacht haben, und morgen kommen Sie wieder. Aber kommen Sie nicht auf den Gedanken, heute noch tanzen zu gehen.«
»Danach steht mir der Sinn wahrhaftig nicht«, sagte sie. »Überhaupt nicht! Sehe ich etwa so aus?«
Er wurde leicht verlegen.
»Jedenfalls nicht so, als würden Sie sich der Einsamkeit ergeben«, erwiderte er.
»Ich bin so viel mit brabbelnden und vergnügungssüchtigen Leuten zusammen, dass ich sehr gern allein bin«, sagte Barbara. »Und wenn ich eine Chance bekäme, im stillen Kämmerlein eine einigermaßen lukrative Arbeit zu verrichten, würde ich es liebend gern tun, aber meine Miete ist teuer.«
Sie war geradeheraus und gewiss nicht wehleidig. Dr. Rosen wusste, wie arg solche Schmerzen werden konnten, und da legte sich manch starker Mann lieber ins Bett und ließ den Arzt rufen.
»Jetzt sollten Sie nicht Auto fahren«, sagte er.
»Ich wohne ja gleich um die Ecke«, erwiderte sie.
»Um so besser, wenn etwas ist, rufen Sie an.«
Er verabschiedete sich höflich, und als Barbara das Haus verließ, begegnete sie einer bildhübschen jungen Dame, die elastischen Schrittes und sehr gesund aussehend auf das Haus zuging.
Und sie vernahm Dr. Rosens Stimme. »Britta, da bist du ja schon. Gut schaust du aus.«
Wär’ ja auch kaum denkbar, wenn er nicht eine schicke Frau hätte, ging es Barbara durch den Sinn.
»Wer war sie?«, fragte Britta Rosen ihren Bruder.
»Wer?«, fragte er gedankenlos zurück.
»Diese attraktive junge Frau, die eben ging.«
»Attraktiv? Eine Patientin.«
»Dennoch attraktiv, lieber Bruder«, meinte Britta lächelnd. »Tu nicht so!«
»Ich habe mir schon lange abgewöhnt, Patientinnen attraktiv zu finden, Britta, und ebenso auch Kolleginnen, dich ausgenommen.«
»Das wäre allerdings sehr gut, damit du nicht noch mal auf Mona hereinfällst.«
»Na, sie ist doch wohl bestens versorgt«, stellte er gleichmütig fest.
»Anscheinend doch nicht so, wie sie dachte. Der gute Herr Professor Billing scheint die Abwechslung zu lieben.«
»Wie kommst du darauf?«
»Mein lieber Jörg, ich bin an einer großen Klinik tätig, und Billing ist ein bekannter Mann, und da wird so manches gemunkelt. Außerdem zeigte er sich heute Arm in Arm mit einer sehr reizvollen Patientin, die er ganz privat besuchte und um deren Wohlergehen er sehr besorgt schien.«
»Worauf willst du hinaus, Britta?«, fragte Jörg nachdenklich.
»Dass Mona sich wieder in Erinnerung bringen könnte, wenn sie erfährt, dass du eine gut gehende Praxis hast.«
»Sie hat andere Statusvorstellungen, und außerdem ist sie für mich erledigt«, erwiderte Jörg ruhig. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Hoffentlich denkst du ebenso über Horst.«
Ihr reizvolles Gesicht überschattete sich. »Eine Diskussion erübrigt sich«, sagte sie.
Er akzeptierte es, obgleich es ihm lieber gewesen wäre, wenn sich Britta mit ihm ausgesprochen hätte. Ihre Verlobung mit dem Assistenzarzt Horst Mehlsen war auseinandergegangen, als sie festgestellt hatte, dass er sich mit einer obskuren Gesellschaft eingelassen hatte, die zur Drogenszene gezählt wurde. Es waren einige recht bekannte Schauspielerinnen dabei, und zuerst hatte Jörg angenommen, dass bei Britta Eifersucht mitspielte. Horst Mehlsen war ein blendend aussehender junger Mann aus bester Familie.
Sie hatten beide kein Glück gehabt mit den Partnern, dafür nun aber im Beruf.
»Ich habe mir übrigens ein paar Tage Urlaub genommen«, sagte Britta beim Abendessen beiläufig.
»Willst du wegfahren?«, fragte Jörg.
»Nein, ich will am Internistenkongress teilnehmen. Es sind ein paar interessante Vorträge zu erwarten.«
»Du solltest lieber wandern«, sagte Jörg.
»Ich bin nicht so gleichgültig wie manche Kollegen«, erklärte Britta. »Es ist manchmal deprimierend, Jörg.«
»Du kannst ja auch eine eigene Praxis aufmachen«, schlug er vor.
»So weit bin ich noch nicht, aber ich behalte es im Auge.«
*
Barbara Heinicke schlief zu dieser Zeit schon, endlich einmal wieder ganz tief und ohne quälende Schmerzen. Dafür aber träumte sie so lebhaft wie schon lange nicht mehr. Und als sie am Morgen erwachte, dachte sie darüber nach, dass sie ihrem Leben vielleicht doch noch eine Wendung geben könnte. Gereist war sie doch wahrhaftig genug. Warum sollte sie nicht all das, was sie gesehen und erlebt hatte, anderweitig verwerten können? Vielleicht in einem Reisebüro?
Es war Samstag, und sie konnte in aller Ruhe die Zeitung lesen und die Stellenangebote studieren. Aber sie hasste es, Bewerbungen zu schreiben, und so meinte sie, dass sie wohl besser selbst eine Anzeige aufgeben sollte.
Sie überlegte, wie sie diese abfassen sollte, aber als sie sich erheben wollte, durchzuckte sie ein stechender Schmerz.
Momentan bekam sie kaum noch Luft und empfand plötzlich Todesangst. In Blitzesschnelle ging es ihr durch den Sinn, dass so etwas auch auf einer Reise hätte geschehen können, im Flugzeug oder im Bus, aber es war nur ein Gedanke, dem der andere folgte, dass sie nicht sterben wollte.
Dr. Rosen hatte sie gewarnt.
Das Telefon war nicht weit entfernt, aber es dauerte Minuten, bis sie sich dorthin geschleppt hatte, mit letzter Kraft und unter peinigenden Schmerzen. Sie hatte sich seine Nummer auf dem Memory notiert, aber sie konnte kaum den Hörer halten. Ihr Wille siegte. Sie konnte die Nummerntasten drücken. Waren es die richtigen? Vor ihren Augen tanzten Nebelschleier.
Eine weibliche Stimme meldete sich, wie aus weiter Ferne. »Praxis Dr. Rosen.«
»Hilfe«, stammelte Barbara, »Heinicke, ich kann nicht …« Und dann sackte sie zusammen.
»Jörg!«, rief Britta erregt. »Hilferuf Heinicke, weißt du Bescheid?«
Er stürzte fast, so schnell kam er aus der Küche. »Kannst du mitkommen?«, fragte er, »es ist gleich um die Ecke.«
Britta fragte nicht erst. Sie lief nur noch in die Küche und zog die Pfanne vom Herd, in der schon die Eier mit Schinken brutzelten.
Sie liefen zu ihrem Wagen. »Lärchenstraße 4, gleich rechts«, sagte er hastig.
Sie waren gleich dort, aber sie konnten doch nicht in die Wohnung hinein. Zum Glück war die Hausmeisterin da, die einen Schlüssel hatte.
Barbara lag am Boden. Sie war nicht bewusstlos, konnte sich aber nicht rühren und sah Dr. Rosen mit schreckensvollen Augen an.
»Hilf mir, Britta«, sagte Dr. Rosen. »Mach die Hüfte frei.«
Er zog eine Injektion auf. Britta griff nach Barbaras Händen, die blutleer waren und eiskalt.
»Es wird gleich besser«, sagte sie tröstend.
Von der Spritze spürte Barbara nichts, dann aber holte Dr. Rosen ein Kissen und schob es unter ihren Nacken.
Barbara hatte die Augen geschlossen. Die schreckliche beklemmende Spannung wich. Sie konnte wieder durchatmen.
»Es tut mir leid«, murmelte sie.
»Was?«, fragte Britta.
»Dass ich Sie gestört habe.«
»Liebe Güte, denken Sie doch nicht so etwas. Dafür ist doch mein Bruder da.«
»Und die Schmerzen haben Sie«, warf Jörg ein. »Aber ich hatte Sie gewarnt. Ist es besser?«
»Ja, und ich hatte so gut geschlafen.«
Britta sah ihren Bruder fragend an.
»Hexenschuss«, sagte er kurz. »Ich habe Frau Heinicke schon empfohlen, sich nach einer Tätigkeit umzuschauen, die die Wirbelsäule weniger belastet, und bei der sie nicht ständig wechselnden klimatischen Verhältnissen ausgesetzt ist. Sie ist Reiseleiterin«, fügte er erklärend hinzu.
»Ich habe gerade Zeitung gelesen«, sagte Barbara stockend, »und als ich aufstehen wollte, ging plötzlich nichts mehr.«
»Immerhin erstaunlich, dass Sie noch zum Telefon gelangten.« Jörg betrachtete sie nachdenklich.
Sie versuchte ein Lächeln. »Aber wie«, murmelte sie.
»Jetzt müssen Sie liegen«, erklärte er. »Wo ist Ihr Bett?«
Sie deutete zum Nebenraum. Er ging hinein und kontrollierte die Matratze.
»In Ordnung«, stellte er fest. »Kann jemand Sie versorgen?«
»Ich brauche nichts«, sagte Barbara.
»Ich kann nach Frau Heinicke sehen«, erklärte Britta. »Jetzt bringen wir sie erst mal zu Bett.«
Barbara gab sich zwar die erdenklichste Mühe, ihre beiden Helfer so wenig wie möglich zu belasten, aber das Gehen fiel ihr sehr schwer.
»Ich mache Ihnen viel Mühe«, sagte sie kläglich.
»Ist doch schon geschafft«, meinte Dr. Rosen nachsichtig, als sie mit unterdrücktem Stöhnen auf ihr Bett sank.
»Haben Sie eine Höhensonne?«
Barbara nickte.
»Ich bleibe hier«, bot sich Britta an. »Du musst doch noch zwei Hausbesuche machen, Jörg.«
Er wandte sich an Britta. »Warte bitte noch, bis die Injektion wirkt. Ich komme dann wieder vorbei.«
»Tut mir wirklich sehr leid«, murmelte Barbara wieder.
»Es ist unser Beruf«, erwiderte Jörg mit einem flüchtigen Lächeln. »Meine Schwester ist Internistin. Es wäre nett, wenn Sie ihr ehrlich erzählen würden, ob Sie sonst noch Beschwerden haben.«
Dann verließ er die Wohnung. Britta setzte sich in den kleinen Sessel, der nahe beim Fenster stand.
»Eine hübsche Wohnung«, stellte sie fest.
»Dafür habe ich mich auch abgestrampelt«, erwiderte Barbara mühsam.
»Sie brauchen nicht zu sprechen. Ich weiß, dass das Mühe macht«, sagte Britta. »Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen. Sie brauchen nur ja oder nein zu sagen. Sie waren kürzlich in den Tropen?«
»Malediven.«
»Es war sehr heiß?«
»Ja.«
»Und Ungeziefer, ich sehe noch Stiche an Ihrem Körper.«
»Es war trotzdem schön, endlich mal Ruhe«, murmelte Barbara, und dann schlief sie ein. Die Spritze wirkte.
Dr. Rosen hatte die beiden Hausbesuche gemacht. Es handelte sich um Patienten, die er in der Behnisch-Klinik betreut hatte. Eine alte Dame, die eine Hüftgelenkoperation hatte und eine andere mit einem Oberschenkelhalsbruch. Dass alte Damen ein besonderes Faible für ihn hatten, hatte Dr. Behnisch schon neckend bemerkt. Jörg nahm es lächelnd hin. Er mochte alte Damen auch lieber als die jungen, die gar zu gern Flirtversuche machten.
Auf dem Weg zu Barbara fiel ihm ein, dass es besser wäre, den Lichtkasten aus der Praxis zu holen, den er am Wochenende dort nicht brauchte. Das war besser als Höhensonne.
Als er dann aber aus seinem Wagen stieg, bereute er es, gerade jetzt zu kommen, denn vor der Tür stand Horst Mehlsen.
Blass und sehr nervös wirkte er. »Was willst du hier?«, fragte Jörg barsch.
»Ich muss Britta sprechen, unbedingt!«, stieß Horst hervor.
»Sie ist nicht da.«
»Ich weiß aber, dass sie frei hat.«
»Und trotzdem ist sie nicht hier«, erwiderte Jörg abweisend.
»Wann kommt sie? Du weißt es doch«, drängte Horst.
»Nein, ich weiß es nicht.«
»Ich brauche sie, ich kann ohne sie nicht leben, sag es ihr – und schau mich nicht so an!« Dann drehte er sich um und lief zu seinem Wagen.
Plötzlich regte sich in Jörg das Gewissen des Arztes. »Horst!«, rief er, da dieser einen so verwirrten Eindruck gemacht hatte, aber Horst fuhr schon davon.
Jörg holte den Lichtkasten und nahm sich vor, doch einmal mit Britta darüber zu sprechen, warum es zu dieser abrupten Trennung von Horst gekommen war, die er allem Anschein nach nicht gewollt hatte.
*
Barbara war wieder erwacht, als Jörg kam.
Die Wärme unter dem Lichtkasten tat ihr gut. Inzwischen war auch die Hausmeisterin, die Anni genannt wurde, gekommen und fragte, was sie für Barbara tun könne.
Essen wollte Barbara nichts. Tee wurde aufgebrüht, und Jörg sagte, dass er am Abend nochmals nach ihr sehen wolle.
»Und morgen schaue ich auch wieder nach Ihnen«, sagte Britta. »Ein paar Tage werden Sie schon liegen müssen.«
»Keine Extratouren«, sagte Jörg streng.
»Danach steht mir nicht der Sinn«, sagte Barbara leise. »Vielen Dank für die Hilfe. Ihnen auch, Frau Dr. Rosen.«
»Britta genügt«, bekam sie zur Antwort. »Schön brav sein, Barbara.«
»Schon so vertraut?«, fragte Jörg überrascht, als sie zum Wagen gingen.
»Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ein tüchtiges Mädchen und sehr intelligent«, sagte Britta.
»Auf Kosten der Wirbelsäule«, meinte Jörg sarkastisch.
»Das ist doch schon eine Zivilisationskrankheit«, sagte Britta.
»In diesem Fall eine Berufskrankheit. Immer auf der Achse, immer schicke Schuhe, einmal hier, einmal da, und stets in miesen Betten. Wenn sich die Leute doch nur mal überlegen würden, wie viel andere schon in diesen Betten geschlafen haben, auch Schwergewichtige!«
»Man kann ja schließlich nicht mit dem eigenen Bett auf Reisen gehen«, sagte Britta ironisch. »Du hast auch schon in fremden Betten geschlafen.«
»Aber nicht das ganze Jahr über«, konterte er, »und wenn das anzüglich gemeint sein sollte, muss ich doch sehr bitten.«
»Sei nicht gleich beleidigt, Bruderherz«, meinte sie neckend.
»Ich muss sowieso mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Vorhin stand Horst vor der Tür. Er wollte dich dringendst sprechen. Er sagte, dass er ohne dich nicht leben könne.«
Brittas Gesicht verdüsterte sich. »Dann war er entweder high oder wollte wieder mal mein Mitgefühl strapazieren«, sagte sie kühl. »Ohne mich.«
»Er ist süchtig?«, fragte Jörg erregt.
»Du weißt doch, in welcher Gesellschaft er sich befindet«, erklärte sie gleichmütig. »Es ist sein Bier, wie er da herauskommt. Ich habe dafür gesorgt, dass er eine Entziehungskur macht, aber das ist das Letzte, was ich für ihn getan habe. So, nun weißt du Bescheid. Es ist sein Leben, und ich lasse mir meins nicht verderben.«
»Du hättest früher mit mir darüber reden sollen, Britta«, sagte er stockend.
»Wozu? Du hättest ihm auch nicht helfen können und mich ekelt das an. Wenn er mich so geliebt hat, wie er jetzt jammert, warum dann Weiber, Alkohol und schließlich Drogen? Nach dem Motto etwa, dass man alles mal probieren muss, um dann der alles verstehende Arzt zu sein? Das war seine Masche, aber hätte es dir gefallen, wenn ich die mitgemacht hätte?«
»Nein, da sei Gott vor«, sagte Jörg heiser. »Ich kann das nicht verstehen.«
»Ich auch nicht, Jörg. Er hatte alles. Geld und alle Chancen, sogar die Begabung, ein guter Arzt zu werden. Nur an Charakterstärke hat es ihm gemangelt.«
»Und er hatte dich«, sagte Jörg leise.
»Aber nicht so, wie er wollte. Ich bin kein Versuchskaninchen. Ich bin eben die kühle Blonde, die man nicht so leicht herumkriegt.«
Britta war eine selbstbewusste junge Frau, das beruhigte Jörg. Kühle Blonde war sie öfter genannt worden, aber Jörg wusste, dass es nur Selbstschutz war, wenn sie sich kühl und unnahbar zeigte. Sie war sensibel und einfühlsam und eine Ärztin, die der Ethik des Arztberufes gerecht werden wollte.
»Man kann ihm ärztliche Hilfe nicht versagen, wenn er sie braucht«, sagte Jörg gedankenvoll.
»Nicht gerade ich«, sagte sie mit fester Stimme. »Er will mehr, aber vielleicht auch nur Drogen. Ich lasse mich nicht ausnutzen.«
»Wissen seine Eltern eigentlich Bescheid?«
»Ich habe mit ihnen gesprochen«, sagte Britta mit einem bitteren Unterton. »In ihren Augen bin ich an allem schuld.«
»Wieso das?«
»Wohl deshalb, weil ich meinen Doktor früher hatte«, sagte sie spöttisch, »weil ich nicht gebummelt habe. Weil ich kein Verständnis für seine eingebildeten Wehwehchen zeigte. Mein Gott, was diese Leute alles in ihn hineingeheimnissen! Er ist in ihren Augen ein verkanntes Genie, nicht eine vergammelte Existenz. Und wenn du mich fragst, wie es so weit mit ihm kommen konnte, weiß ich auch keine richtige Antwort darauf.«
Sie sagte ihm, dass sie darüber nicht mehr sprechen wolle, weil es verlorene Zeit sei, und für ihn sei das Kapitel Mona ja auch beendet.
*
Am Abend fuhr Jörg zu Barbara Heinicke. Frau Anni hatte sich rührend um sie gekümmert, und Barbara behauptete, dass es ihr schon bedeutend besser gehe.
»Sie werden es schon noch ein paar Tage merken«, sagte er warnend. »Übertreiben Sie nichts.«
»Ich werde mir Einlagen machen lassen«, sagte sie.
»Allein damit wird es auch nicht gleich besser. Sobald Sie wieder gehen können, kommen Sie zu Bestrahlungen, und dann fangen wir mit einer Bewegungstherapie an. Ich würde empfehlen, dass Sie eine Kur machen.«
»Du liebe Güte«, seufzte sie, »wo denn?«
»Zum Beispiel auf der Insel der Hoffnung. Da werden prächtige Erfolge erzielt, und Sie kennen doch Dr. Norden recht gut. Sie sollten jetzt so vernünftig sein, einem wirklich gut gemeinten Rat zu folgen.«
»Ich bin nicht so betucht, dass ich mir eine kostspielige Kur leisten kann«, sagte sie stockend.
»In diesem Fall zahlt doch auch die Krankenkasse. Machen Sie sich da mal nicht zu viele Sorgen.«
»Ich kann nicht herumfaulenzen«, begehrte Barbara auf. »Ich gehe ein wie eine Primel, wenn ich nichts tun kann.«
»Aber allzu viel Stress ist schädlich«, stellte er nachdrücklich fest. »Das war ein Schuss vor den Bug, und es mag gut sein, dass er noch zur rechten Zeit gekommen ist.«
»Der Hexenschuss«, sagte Barbara mit einem gequälten Lächeln. »Wer weiß, wer mir den an den Hals gewünscht hat.«
»An den Hals nicht gerade, aber Ihnen kann man doch nichts Böses wünschen«, sagte Jörg.
Sie warf ihm einen schrägen Blick zu. »Die Jugend drängt nach und ist nicht pingelig. Für die gehöre ich doch sowieso schon zum alten Eisen.«
»Jetzt machen Sie aber ’nen Punkt«, sagte Jörg lächelnd. »Torschlusspanik ist da doch wirklich nicht angebracht. Sie und Britta sind gleichaltrig, und ich finde, das ist ein sehr guter Jahrgang.«
Flüchtige Röte stieg in ihre Wangen. »Ihre Schwester ist nicht verheiratet?«, fragte sie zögernd.
»Nein, aber das versetzt sie nicht in Panik.«
»Mich auch nicht, wenn es darum geht, aber wenn schon Verschleißerscheinungen auftreten, kriegt man doch Angst.«
»Bei Ihnen liegt eine recht beträchtliche Nervenentzündung vor, und die Ursache habe ich Ihnen schon erklärt.«
»Eine sitzende Tätigkeit ist doch aber auch nicht gut«, meinte Barbara. »Für stupide Büroarbeit eigne ich mich ohnehin nicht.«
»Man braucht ja nicht unbedingt immer auf einem Stuhl vor dem Schreibtisch zu hocken«, sagte Jörg. »In einer Arztpraxis zum Beispiel ist man dauernd in Bewegung.«
»Aber davon habe ich leider nicht die geringste Ahnung, und so gut bezahlt sind solche Stellungen auch nicht. Ich muss noch ganz schön rackern, bis ich die Wohnung abbezahlt habe.«
»Von der Sie doch nicht viel haben, wenn Sie dauernd unterwegs sind«, erklärte er ruhig.
»Jeder Mensch braucht ein Zuhause«, sagte Barbara leise. »Und man muss möglichst früh dafür sorgen, dass man eins hat, wenn man älter wird und nicht mehr so kann. Es kostet doch einen Haufen Geld.«
»Wem sagen Sie das«, seufzte er. »Sie haben ja auch eine sehr hübsche Wohnung.«
»Jetzt wäre sie schon ein Drittel teurer, wenn ich nicht so früh angefangen hätte«, sagte Barbara, »aber was schwatze ich da herum, Sie haben bestimmt was Besseres vor.«
»Vor habe ich jetzt gar nichts mehr, aber vielleicht kommt ein Notfall. Britta weiß, wo ich zu erreichen bin.«
Und gleich darauf läutete schon das Telefon. Doch der Anruf war für Barbara. Es war ihr Chef, wie Jörg aus dem Gespräch entnahm.
»Nein, ich kann nicht. Ich liege fest«, sagte Barbara. »Wenn Sie es nicht glauben wollen, der Arzt ist gerade noch hier. Sie können ihn ja fragen.« Dann begannen ihre Augen wütend zu funkeln. »Also, das ist die größte Unverschämtheit, das lasse ich mir nicht bieten. Dr. Rosen wird ein Attest ausstellen, und für Ihre Anzüglichkeiten werden Sie sich entschuldigen.« Dann legte sie den Hörer so abrupt auf, dass sie einen leisen Schmerzensschrei ausstieß. Die heftige Bewegung hatte ihr wieder geschadet.
Jörg war schon bei ihr. Barbara stöhnte. »Dieser Depp«, zischte sie.
»Nicht aufregen, nicht verkrampfen, entspannen«, sagte Jörg.
»Das brauche ich mir doch nicht gefallen lassen«, ächzte Barbara.
»Was wollte er denn?«, fragte Jörg.
»Ich sollte morgen für Carola einspringen. Das ist eine von den Jungen, die mich doch so gern ausbooten wollen, aber sie hat anscheinend was Besseres vor. Nach Rom mit dem Bus. Mein Gott, was war ich auch blöd, dass ich nie nein gesagt habe. So eine Blöde findet er so rasch nicht mehr. Und mir dann auch noch unterstellen wollen, dass ich wohl lieber herumturtele.«
»Ist der Chef eifersüchtig?«, fragte Jörg hintergründig.
»Dieser Fettsack«, sagte Barbara ganz verächtlich. »Jetzt habe ich wirklich die Nase voll. Weil ich mal ein paar Wochen Urlaub hatte, den ersten seit drei Jahren, meint er, er könnte mich doppelt einspannen. Drei Tage Rom, dann drei Tage Amsterdam, anschließend London, und so weiter …«
Jörg sah sie nachdenklich an. »Und Sie hätten es ja wohl gemacht, wenn Sie jetzt nicht festliegen würden«, sagte er ernst.
Ein Zucken lief über ihr Gesicht. »Ja, oft genug hab’ ich es gemacht. Da sehen Sie, wie blöd ich bin, und Sie vergeuden Ihre Zeit mit mir.«
»Ich will nicht hoffen, dass es vergeudete Zeit ist«, sagte Jörg. »Sie haben ja schon eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann.«
Wieder läutete das Telefon, und diesmal galt es ihm. Er wurde zu einem Unfall gerufen.
»Das müssen Sie auch machen?«, fragte Barbara erschrocken.
Er nickte und eilte zur Tür. »Es ist dringend. Bis morgen, Frau Heinicke.«
Wenn er doch auch Barbara sagen würde, wie Britta, dachte sie. So ein Mann! Ja, dafür würde es sich lohnen, den Eigensinn und die damit schon eingefleischten Gewohnheiten aufzugeben. Aber was hatte sie denn schon zu bieten? Eine Wohnung, die noch mit Hypotheken belastet war und fast dreißig Lebensjahre.
Sie schloss die Augen. Ist das doch Torschlusspanik, ging es ihr durch den Sinn. Warum denke ich schon an die Dreißig, obgleich ich doch gerade achtundzwanzig bin? Und Britta ist mein Jahrgang, hat er gesagt. Aber sie ist ja viel schöner als ich.
Da wollte sie sich doch tatsächlich aufrappeln, um zum Spiegel zu gehen, aber da läutete glücklicherweise wieder das Telefon, und diesmal streckte sie den Arm ganz vorsichtig aus, jedoch bereit, dem Chef gehörig die Meinung zu sagen, falls er sie nochmals überreden wollte.
Aber es war Britta.
»Ich wollte mich nur erkundigen, wie es Ihnen geht, Barbara«, sagte sie mit ihrer sanften, weichen Stimme. »Jörg musste ja rasch weg, aber es ist anscheinend ein schwerer Unfall.«
»Lieb, dass Sie anrufen«, sagte Barbara.
»Ich habe Sie gleich gemocht. Schon, als wir uns an der Gartentür begegnet sind. Ich sitze jetzt hier allein herum und warte auf Jörg. Wenn es Ihnen recht ist, besuche ich Sie morgen.«
»Ich würde mich sehr freuen«, sagte Barbara leise. »Ich habe Sie auch gleich gemocht, und ich finde es sehr schön, wenn man sich das auch sagen kann.«
»Es gibt eben so etwas wie eine Antenne zwischen Menschen«, sagte Britta. »Und das ist so selten, dass man auch auf Empfang schalten sollte.«
»Das habe ich bereits, Britta«, sagte Barbara von tiefer Freude erfüllt. »Und ich sende meinen Dank.«
Es sollte der Beginn einer tiefen, herzlichen Freundschaft sein, die sich auch in schweren Monaten bewähren sollte.
Davon ahnten sie beide noch nichts. Barbara schlief mit einem glücklichen Lächeln ein, und Britta dachte nun schon zum wiederholten Male: Das wäre eine Frau für Jörg. Auf die konnte er sich verlassen, und wir würden uns wunderbar verstehen.
*
Dr. Jörg Rosen war zu einem grauenvollen Unfall gerufen worden. Ein junger Motorradfahrer war in eine Kurve zu schnell hineingefahren, ins Schleudern gekommen, gegen einen entgegenkommenden Wagen geprallt und auf diesen war dann auch noch ein zweiter aufgefahren.
Der junge Mann war tot, seine Beifahrerin schwer verletzt, und sie wurde schon im Notarztwagen abtransportiert, als Jörg die Unfallstelle erreichte.
Im Wagen, auf den das Motorrad geprallt war, gab es den schwerverletzten Fahrer, seine Frau mit mittelschweren Verletzungen und zwei leichtverletzte Kinder, die gellend nach ihrer Mutter schrien.
Sie wurden bereits von einem zweiten Notarzt versorgt. Für Jörg kam dann der große Schock, denn in dem Wagen, der auf jenen aufgefahren war, hing Mona Lohr bewusstlos im Gurt. Sichtbare Verletzungen waren nicht festzustellen und als Jörg sich um sie bemühte, schlug sie die Augen auf.
»Jörg«, murmelte sie, »ich wollte zu dir.«
Unwillkürlich musste er an Brittas Worte denken, selbst in dieser Situation. Ihm war es kalt.
Schon standen zwei Sanitäter bei ihm. »Die Verletzte zum Klinikum«, sagte Jörg rau.
»Nicht zu Billing«, murmelte Mona.
»Die Behnisch-Klinik ist aufnahmebereit«, sagte ein Sanitäter.
Jörg richtete sich mit düsterer Miene auf. »Gut«, sagte er heiser.
»Bleib bei mir«, flüsterte Mona.
Jörg sah die beiden Sanitäter an. »Es ist eine Kollegin, Frau Dr. Lohr«, sagte er tonlos. »Ich kann momentan keine Verletzungen feststellen. Ich komme nach und spreche mit Dr. Behnisch.« Seine eigene Stimme war ihm fremd.
»Bleib bei mir, Jörg«, sagte Mona wieder.
»Ich muss hier helfen«, sagte er. »Es ist nicht weit zur Behnisch-Klinik.«
Mona wurde auf die Trage gebettet. Jetzt sah er, dass ihre Knie bluteten.
»Das machen wir«, sagte ein Sanitäter.
Dann sah Jörg Dr. Norden kommen. Ihn hatte man auch gerufen, aber die meiste Arbeit war bereits getan. Jetzt ging es nur noch um die weinenden Kinder.
»Die übernehme ich«, sagte Dr. Norden. »Darauf verstehe ich mich besser als Vater, Kollege.«
»Mami, will zu Mami«, schrie das kleine Mädchen, und Dr. Norden nahm es in die Arme. »Kommst ja zur Mami, Kleines. Nicht weinen, es wird ja alles wieder gut.«
Oft schon hatte er solche tröstenden Worte gesagt, die dann doch keine Geltung mehr hatten, und da stand dann ein kleiner Junge, vielleicht sechs Jahre alt, der starr auf das Auto blickte, aus dem man die Kinder herausgeholt hatte, und sagte: »Es war ganz neu und noch nicht mal bezahlt. Und Papi hat so geblutet.«
Ein Kind, das noch nicht begriff, was da geschehen war, das unter einem Schock stand und dann plötzlich auch zu schreien begann. »Wo ist Wasti, wo ist unser Wasti?«
Ein kleiner Dackel kam benommen aus dem Wrack gekrochen, wedelte kläglich mit dem Schwanz und kroch auf dem Bauch zu dem Jungen.
Der kniete nieder. »Wasti, tut dir auch was weh?«, fragte er schluchzend.
»Ich nehme die Kinder und den Hund mit«, sagte Dr. Norden zu dem Polizisten, der nun zu ihnen trat. »Stellen Sie die Personalien fest, und geben Sie mir Bescheid.«
»Wird gemacht, Herr Dr. Norden.«
Ihn kannte man genau. Er war schon oft zur Stelle gewesen bei Unfällen. Dr. Rosen war noch ein Fremder.
Im Hause Norden war man ganz auf Kinder eingestellt, doch die eigenen schliefen bereits, als Daniel mit seinen beiden Schützlingen kam, sogar die kleinen Zwillinge.
Bärle, der Hirtenhund, beschnupperte den Dackel Wasti mit der Überlegenheit des Größeren, aber Wastis Reaktionen ließen vermuten, dass er schon wieder ganz wohlauf war und einem Spielchen nicht abgeneigt. Die beiden Kinder waren jetzt stumm und völlig verstört.
Fee hatte einen langen Blick mit ihrem Mann getauscht und fragte vorerst gar nichts. Lenni brachte Saft und Kekse.
»Ihr habt doch sicher Durst«, sagte Fee sanft.
»Kommt Mami?«, fragte das kleine Mädchen, während der Junge hastig trank.
»Sagt ihr uns jetzt mal, wie ihr heißt?«, lenkte Fee ab.
Der Junge nickte.
»Schöler«, sagte er. »Ich heiße Achim Schöler, und das ist meine Schwester Trixi. Und der Hund heißt Wasti.«
»Will zu Mami«, flüsterte die Kleine. »Bin müde. Mami Schlafliedchen singen.«
»Omi wird warten«, sagte der Junge.
»Wo ist die Omi?«, fragte Daniel.
»Am Ried, jetzt ist’s nicht mehr weit, hat Papi gesagt, dann hat es gekracht. Papi hat geblutet, hab’ es gesehen.«
»Heißt die Omi auch Schöler?«, fragte Daniel, während Fee das kleine Mädchen im Arm hielt, ein Liedchen summend.
»Omi Schöler«, sagte der Junge. »Die andere Omi heißt Karner.«
»Du bist ein gescheiter Junge«, sagte Daniel.
»Geh’ ja schon zur Schule«, sagte Achim. »Berliner sind helle.«
»Ihr kommt von Berlin?«, fragte Daniel.
Der Junge nickte. »Hat ewig gedauert. Wo sind Papi und Mami denn jetzt?«
»In einer Klinik, aber ihr seid bald wieder beisammen, Achim«, sagte Daniel Norden.
Fee warf ihm einen fragenden Blick zu. Er zuckte die Schultern. Er wusste ja bisher noch nichts, aber jetzt ging es erst mal um die Kinder.
»Die Omi hat doch sicher Telefon«, sagte er.
»Klar, wir reden ja oft mit ihr. Sie freut sich doch, wenn wir kommen. Der Karner-Omi fallen wir auf den Wecker.«
»Die Telefonnummer weißt du auch?«, fragte Daniel.
»Nö, die ist zu lang. Papi muss auch immer erst nachschauen.«
»Weißt du, wie die Omi mit Vornamen heißt?«, fragte Daniel weiter.
»Käthchen, Papi sagt immer Käthchen zu ihr. Papi hat so geblutet, und Mami kann kein Blut sehen.« Er schlug jetzt die Hände vor sein Gesicht. »Ich habe solche Angst.«
»Du brauchst keine Angst zu haben, Achim«, sagte Dr. Norden.
»Aber Omi wird auch Angst haben, wenn wir nicht kommen.«
»Ich schaue jetzt mal ins Telefonbuch«, sagte Daniel.
Die kleine Trixi war in Fees Armen eingeschlafen, das war ein kleiner Trost, aber Fee sah Daniel so angstvoll an, dass er ihrem Blick auswich.
Er fand eine Käthe Schöler im Telefonbuch. Am Ried 14, grad fünf Kilometer von der Unfallstelle entfernt war das. Es war mal wieder ein Augenblick in Dr. Nordens Leben, in dem ihm die Kehle eng wurde.
Sollte er jetzt anrufen? Sollte er warten, bis eine Nachricht von der Polizei kam?
Nach Minuten des Zögerns entschied er sich für einen sofortigen Anruf.
Eine leise Frauenstimme meldete sich und nannte den Namen Schöler.
»Frau Käthe Schöler?«, fragte Dr. Norden.
»Ja.«
»Hier spricht Dr. Norden«, sagte er, »erschrecken Sie bitte nicht.«
»Es ist etwas passiert?«, flüsterte sie. »Ich spüre es! Ich habe von dem Unfall gehört. Meine Kinder …« Ein ersticktes Schluchzen folgte.
»Bitte, regen Sie sich nicht auf, Frau Schöler. Achim und Trixi sind hier, in meinem Haus. Ich bin Arzt. Ihr Sohn und Ihre Schwiegertochter werden in der Behnisch-Klinik versorgt. Die Kinder haben nur ein paar Abschürfungen. Der Hund ist wohlauf.«
»Den haben wir von der Schöler-Omi«, rief Achim dazwischen. »Ist sie da?«
»Haben Sie den Jungen gehört, Frau Schöler?«, fragte Daniel. »Können Sie sich ein Taxi nehmen und kommen? Trixi ist eingeschlafen. Wir möchten sie jetzt nicht wecken.«
»Ich komme sofort. Sagen Sie mir bitte die Adresse. Ich bin Ihnen sehr dankbar.«
»Eure Omi kommt, Achim«, sagte Daniel. »Leg dich aufs Sofa.«
»Ich bin aber schmutzig«, murmelte der Junge.
»Das macht doch nichts, wir haben auch Kinder«, sagte Fee.
»Bei der Karner-Oma dürfen wir nicht mit den Füßen aufs Sofa«, brummelte der Junge.
»Ich muss mal telefonieren«, sagte Daniel leise.
Er ging hinaus, denn das Gespräch sollte der Junge nicht mithören.
In der Behnisch-Klinik konnte er nur Schwester Martha erreichen. Nein, die Schölers hätte man nicht in die Behnisch-Klinik gebracht, sondern ins Klinikum, sagte sie. Nur die Frau Dr. Lohr wäre da, aber es würde ihr nicht viel passiert sein. Sie hätten auch noch einen anderen Unfall. Der Teufel sei mal wieder los.
Daniel rief im Klinikum an. Er war auch dort wohlbekannt. Man sagte ihm, dass Frau Schöler schon bei Bewusstsein sei und Herr Schöler auch nicht in Lebensgefahr schweben würde. Er habe nur viel Blut verloren.
Daniel Norden atmete auf. So konnte er Käthe Schöler wenigstens mit dieser tröstlichen Nachricht empfangen, und sie war schnell da. Er hatte gerade erst den Hörer aufgelegt.
Achim vernahm ihre Stimme, sprang auf und stürzte seiner Omi in die Arme.
Sie drückte das Kind an sich, aber ihre angstvollen Augen hingen an Dr. Norden.
»Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass es Ihrer Schwiegertochter schon ganz gut geht und Ihr Sohn außer Gefahr ist«, sagte er leise. »Ich bin sehr froh, Ihnen das sagen zu können.«
»Ich hatte solche Angst«, stammelte sie. »So lange habe ich auf diesen Tag gewartet, aber uns bleibt wirklich nichts erspart.«
»Jetzt sind wir ja bei dir, Ömchen«, flüsterte Achim. Und da kam Wasti und jaulte freudig. Und Fee saß noch immer im Sessel und hielt die schlafende Trixi in den Armen.
Tränen rannen über Käthe Schölers Gesicht, als Daniel sie sanft in einen Sessel drückte. Und Achim streichelte ihre Wangen.
»Brauchst nicht weinen, Ömchen, der liebe Doktor hat doch gesagt, dass wir bald alle beisammen sind. Ich durfte mich sogar aufs Sofa legen, obgleich ich so schmutzig bin.«
»Wie soll ich es Ihnen nur danken«, flüsterte Käthe Schöler.
Und da schlug Trixi die Augen auf.
»Sind wir jetzt bei Omi?«, fragte sie schlaftrunken.
Schnell wischte Käthe Schöler die Tränen fort. »Jetzt seid ihr bei mir«, sagte sie bebend. »Endlich.«
»Mami auch?«, fragte Trixi.
»Mami kommt bald«, sagte Daniel.
»Papi auch«, flüsterte die Kleine.
»Ich kann die Kinder doch mitnehmen«, sagte Käthe Schöler bittend.
»Ich bringe Sie nach Hause«, sagte Daniel Norden. Er wusste, dass diese Frau jetzt nicht in Verzweiflung versinken würde. Sie hatte ihre Enkelkinder, sie hatte eine Aufgabe und durfte ja auch hoffen. Es war auch für ihn gut, dies zu wissen.
Es war ein hübsches Haus vor den Toren der Stadt, schon in ländlicher Umgebung, vor dem er dann hielt.
»Ich habe alles herrichten lassen für die Kinder«, sagte Käthe Schöler. »Das Warten war so schrecklich. Ich erzähle Ihnen alles mal, Herr Doktor. Ich komme bestimmt. Die Kinder brauchen jetzt Ruhe, bitte verstehen Sie das.«
»Aber ja«, sagte Dr. Norden. »Ich bin froh, dass wir Sie so schnell gefunden haben, aber der Achim ist ein gescheiter Bub.«
»Und du bist dufte, Doktor«, sagte Achim. »Wasti muss jetzt noch Futter kriegen.«
»Ich denke, er hat schon genug gefressen vom Bärle«, sagte Daniel Norden. »Jetzt schlaft schön bei der Omi.«
»Kann ich Jo und Anne morgen besuchen?«, fragte Frau Schöler. »Und kann ich die Kinder mitnehmen?«
»Rufen Sie vorher an«, sagte Daniel, »ich schreibe Ihnen die Nummer auf und den Namen des Arztes, an den Sie sich wenden können.«
»Dass es so was noch gibt«, flüsterte sie. »Wenn mir mal was fehlt, weiß ich wenigstens, wohin ich gehen kann.«
»Ihnen wünsche ich, dass Ihnen nie was fehlt«, sagte Daniel.
»Ich muss ja jetzt auch da sein für die Kinder. Nun werden sie endlich bei mir sein, endlich.«
Und es war mehr Hoffnung als Schmerz, was Daniel Norden mit heimnehmen konnte. Die Hoffnung einer tapferen Frau, die auch in schreckensvollen Stunden nicht verzagte. Nicht weit entfernt weinten Eltern um ihren einzigen Sohn. Sie dachten nicht daran, dass sein Leichtsinn andere in Lebensgefahr gebracht hatte. Sie waren ungerecht in ihrem Schmerz.
»Die Miriam hat es ja nie schnell genug haben können«, sagte Alfred Mallick. »Das Mädchen war sein Unglück.«
Und die Eltern von Miriam Thaler saßen in der Klinik und bangten um das Leben ihrer Tochter. »Ich hab’ immer gesagt, dass der Lutz nicht der richtige Umgang für unser Kind ist«, sagte Konrad Thaler. »Und wenn Miriam nicht durchkommt …«
»Sag das doch nicht, Konrad«, schluchzte seine Frau, aber in diesen Stunden waren die einen wie die anderen sich nicht bewusst, dass da ein ungerechter Hass aufflammte, dass jeder dem anderen die Schuld zuschob. Und es gab auch so viele andere, die die Schuld für etwas, was zur gleichen Zeit geschah, anderen zuschieben wollten, um sich freizusprechen von eigener Schuld, wie es die Eltern von Horst Mehlsen taten.
*
Britta wartete auf ihren Bruder, noch ahnungslos, dass Mona Lohr in den Unfall verwickelt war, und dass Jörg nun notgedrungen nach ihr sehen musste.
»Du hast lange auf dich warten lassen«, sagte sie vorwurfsvoll.
»Es gab Schwerverletzte«, erklärte er mit erzwungener Ruhe. »Du bist ja gut davongekommen, und wenn du nicht so dicht aufgefahren wärest, wäre dir gar nichts passiert.« Er konnte es sich nicht verkneifen, das zu sagen.
»Jetzt mach mir auch noch Vorhaltungen«, sagte sie gereizt. »Schuld war doch der Motorradfahrer. Ich habe sofort gebremst, aber der vordere Wagen ist zurückgekracht. Es hat doch hoffentlich keinen Toten gegeben.«
»Der junge Mann ist tot«, sagte Jörg. »Du brauchst nur ein paar Tage zur Beobachtung zu bleiben, sagte mir Dr. Behnisch.«
»Du kannst mich morgen ja abholen«, sagte sie. »Ich bleibe gern ein paar Tage bei dir.«
Sie sagte das mit einer Selbstverständlichkeit, die ihn erst mal sprachlos machte.
»Eine gute Gelegenheit, uns mal gründlich auszusprechen, Jörg«, fuhr sie fort.
»Es gibt nichts mehr zu sagen«, erklärte er steif. »Bei mir ist kein Platz für Besuch. Britta wohnt bei mir.«
Ihre Augen verengten sich. »Sie hat ja das ihre dazu beigetragen, dass es Differenzen zwischen uns gab«, sagte sie giftig.
»Es ist zu seltsam, dass immer andere zum Sündenbock gestempelt werden«, sagte er kühl. »Du scheinst vergessen zu haben, dass der Grund Billing heißt, oder willst du es vergessen? Lass mich aus dem Spiel, Mona. Such dir ein anderes Opfer.«
Sie schnappte förmlich nach Luft.
»Nimm wenigstens Rücksicht auf meine Verfassung«, zischte sie.
»Ich sehe keinen Grund. Du wirst doch nicht erwarten, dass ich Händchen halte.«
»Dir wäre es anscheinend auch egal, wenn ich jetzt tot wäre«, sagte sie zornig.
»Du bist nicht tot und hier in bester ärztlicher Betreuung. Ich wünsche dir schnelle und gute Besserung und eine gute Nacht.«
»Eine feine Einstellung hast du.«
»Ruf Billing an, wenn du Gesellschaft brauchst. Ist die Hochzeit etwa geplatzt?«
»Ich wollte mich mit dir aussprechen, Jörg. Es tut mir leid, dass mein beruflicher Ehrgeiz meine Gefühle verdrängt hat. Ich bin mir bald bewusst geworden, was du mir bedeutest.«
»Seit ich meine Praxis habe«, sagte er spöttisch. »Es hat sich schnell herumgesprochen, dass es sich für mich gut angelassen hat. Es ist aber nicht das Prominentenviertel, das deinen Vorstellungen entspricht.«
»Sei doch jetzt nicht albern, Jörg. Du hast das alles viel zu wörtlich genommen.«
»Verdreh die Tatsachen nicht«, entgegnete er. »Du hast die Trennung vollzogen, und dabei bleibt es. Du wirst doch nicht angenommen haben, dass ich dich mit offenen Armen empfangen werde!«
Doch, das hatte sie angenommen, davon war sie sogar überzeugt gewesen, und nun hatte sie eine kalte Dusche bekommen.
Bevor sie jedoch noch etwas sagen konnte, war er gegangen. Es war anders gelaufen, als sie es sich vorgestellt hatte, und nun war sie deshalb auch noch in diesen verflixten Unfall verwickelt.
In letzter Zeit schien alles wie verhext, und ihre Wut richtete sich wohlverteilt auf Billing ebenso wie auf Jörg Rosen. Ob es in Jörgs Leben inzwischen auch schon eine andere Frau gab? Daran hatte sie bisher überhaupt nicht gedacht, denn ihr selbst war er ohnehin immer zu langweilig gewesen.
Britta wohnte also jetzt bei ihm. Es schien auch endgültig aus zu sein zwischen ihr und Horst. Blöd genug von Britta, da nicht wenigstens finanziell mehr herausgeholt zu haben. Da hätte sie sich gesundstoßen können. So dachte Mona, und sie hatte ja solche Absichten auch bei Billing gehabt. Aber da hatte sie dann schnell erkennen müssen, dass er sich nicht an die Kette legen ließ.
Mona Lohr war mit sich und der Welt unzufrieden. Nichts ging so, wie sie es sich gedacht hatte, und dass Jörg so schnell zu einer Praxis kommen würde, damit hatte sie zuallerletzt gerechnet.
Nun lag sie hier, und vorerst kümmerte sich niemand um sie. Ihr Auto war kaputt, und es würde wieder ein großes Hin und Her mit den Versicherungen geben. Aber raffiniert wie sie war, begann sie nun schon etwas auszubrüten, bereit, aus dieser misslichen Lage noch das Bestmögliche zu machen.
*
Britta war völlig konsterniert, als Jörg von Mona erzählte. Es dauerte schon einige Zeit, bis sie dazu etwas sagen konnte.
»Nun hat sie wenigstens einen Denkzettel bekommen«, sagte sie. »Ich hoffe nicht, dass du vor Mitleid zerfließt, Jörg.«
»So bedauernswert ist sie nicht, aber ich staune selbst, wie kalt mich das alles lässt. Schließlich hab’ ich mal gedacht, sie wäre die Frau fürs Leben.«
Der sarkastische Unterton zauberte ein Lächeln um Brittas hübschen Mund.
»Man bildet sich allerhand ein, Bruderherz. Es kann die große Liebe bei uns beiden nicht gewesen sein. Gut, wenn man es vorher merkt. Scheidungen kommen teuer.«
»Es gibt auch glückliche Ehen unter Ärzten«, sagte Jörg nachdenklich. »Das Musterbeispiel sind ja die Nordens. Aber auch bei den Behnischs und den Leitners geht es gut.«
»Übrigens hat Dr. Norden angerufen. Die beiden Kinder sind von ihrer Oma abgeholt worden.«
»Sie haben zum Glück nur ein paar Schrammen abbekommen. Die Eltern bleiben ihnen auch erhalten. Ob das Mädchen zu retten ist, steht noch in den Sternen. Siebzehn Jahre …«, er unterbrach sich, »der Junge war neunzehn. Schlimm für die Eltern.«
»Manche Eltern müssen ihre Kinder auch verloren geben, wenn sie nicht sterben«, sagte Britta leise. »Und vielleicht ist das noch schlimmer.«
Jörg wusste, dass sie an Horst dachte. Sie war noch nicht darüber hinweg.
Aber Britta sagte nicht, was sie wirklich dachte.
»Ich habe noch mal mit Barbara telefoniert«, erklärte sie. »Ich werde sie morgen besuchen.«
Das erstaunte ihn doch. »Du bist doch sonst nicht so spontan«, sagte er.
»Es ist Sympathie und beruht auf Gegenseitigkeit«, erwiderte Britta. »So, jetzt aber Marsch ins Bett, Jörg.«
Als Britta am Sonntagvormittag zu Barbara kam, war diese schon aufgestanden.
»Na, ob das meinem Bruder gefallen wird?«, meinte Britta besorgt. »Er kommt nachher auch, Barbara.«
»Es tut nicht mehr weh. So schlimm kann es doch noch nicht um mich bestellt sein«, sagte Barbara heiter. »Oder Dr. Rosen hat ein Wundermittel gegen Hexenschuss. Hexen kann man ja auch vertreiben, wenn man keine Angst vor ihnen hat.« Sie machte eine kleine Pause. »Ich habe im Radio über den Unfall gehört. Muss schlimm gewesen sein.«
Britta nickte. »Jörg ist spät heimgekommen. Für ihn hat es da auch noch eine persönliche Konfrontation gegeben, mit der er nicht hatte rechnen können. Eine Kollegin ist in den Unfall verwickelt, mit der er so gut wie verlobt war, wenn man es so nennen will.«
Barbara wandte sich ab. »Das war sicher besonders schlimm für ihn«, sagte sie leise.
»Es ist ihr nicht viel passiert, und Jörg hat es sehr gelassen hingenommen. Ich bin sehr froh, dass er da nicht mehr rückfällig geworden ist. Ich kann diese Frau nicht ausstehen. Aber warum erzähle ich das eigentlich?«
»Sicher beschäftigt es Sie, Britta«, sagte Barbara.
»Ja, es beschäftigt mich. Ich habe geahnt, dass sich Mona wieder in Erinnerung bringt. Warum haben Sie eigentlich nicht geheiratet, bisher noch nicht, Barbara?«
»Weil ich den Richtigen nicht gefunden habe. Oder er mich nicht«, erwiderte Barbara mit einem kurzen Auflachen. »Ich bin wohl auch nicht der Typ, auf den die Männer fliegen.«
»Männer haben meistens Angst vor sehr emanzipierten Frauen, das habe ich neulich erst wieder gelesen. Erzählen Sie mir von Ihren Reisen, Barbara. Ich bin noch nicht viel in der Welt herumgekommen. Und wahrscheinlich wird mir dafür auch nicht viel Zeit bleiben.«
Es war so, als würden sie sich schon lange kennen.
Barbara empfand das beglückend. Sie hatte auf den Reisen so viele Menschen kennengelernt, auch junge Frauen ihres Alters, aber niemals hatte sie den Wunsch gehabt, Freundschaften zu schließen. Bei Männern war sie ohnehin immer besonders vorsichtig gewesen.
»Man braucht ein dickes Fell, um mit diesen Leuten auszukommen«, erzählte sie. »Gemeckert wird mehr als gelobt. Manchmal habe ich mich gefragt, warum sie eigentlich so weit herumreisen, weil ihnen das Essen und das Bett doch am wichtigsten sind. Natürlich sind nicht alle so, aber leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass es den meisten am wichtigsten ist, ihren Bekannten erzählen zu können, dass sie da und dort gewesen sind. Am schönsten war für mich eine Reise in den Kaukasus. Da waren nur Menschen, die an Land und Leuten interessiert waren und keine Stadt in der ganzen Welt hat mich so beeindruckt wie Tiflis. Dorthin würde ich gern mal allein fahren und mir alles in aller Ruhe ansehen.«
»Würden Sie mich mitnehmen, Barbara?«, fragte Britta.
»Schön wär’s«, sagte Barbara, »aber wenn ich meinen Job jetzt aufgebe, muss ich erst mal tüchtig sparen. Bis ich meine Wohnung abbezahlt habe, dauert es noch ein paar Jahre, und es fragt sich, ob ich eine andere Stellung finde.«
»Aber Sie wollen mit der Reiserei Schluss machen«, sagte Britta.
»Dr. Rosen hat es mir ans Herz gelegt, und meine Gesundheit sollte mir wohl doch wichtiger sein. An Krücken möchte ich doch nicht so bald gehen.«
»Überhaupt nicht. Jörg macht Sie schon wieder fit«, sagte Britta. »Sagen Sie bitte nicht, dass ich über Mona gesprochen habe.«
»Wo werd’ ich denn«, erwiderte Barbara munter. »Wir sind doch keine Klatschbasen.«
»An was für eine Stellung denken Sie, Barbara?«, fragte Britta gedankenvoll.
»Wo ich meine Sprachkenntnisse verwerten kann. Am liebsten keinen so sturen Bürobetrieb. Klingt sehr anspruchsvoll, gell?«
»Vielleicht wüsste ich da etwas«, sagte Britta. »Wäre es Ihnen recht, wenn ich mich diesbezüglich erkundigen würde?«
»Wenn es Ihnen keine Mühe macht?«
»Überhaupt nicht, aber ich höre Jörgs Wagen. Setzen Sie sich lieber, Barbara, sonst bekomme ich eins auf den Deckel.«
Jörg schaute schon ein bisschen skeptisch, als Barbara fröhlich erklärte, dass es ihr schon wieder ganz gut gehe, aber als sie dann im Zimmer hin und her gegangen war, ließ er sich überzeugen.
»Wie wäre es denn, wenn wir ins Bräustüberl zum Essen gehen würden?«, schlug er vor. »Es ist zwar kein Gourmet-Restaurant, aber man kann sehr gut essen, und weit ist es auch nicht.«
»Mir wohlbekannt«, sagte Barbara, »darf ich die Herrschaften einladen für all die Mühe, die Sie mit mir hatten?«
»So war es aber wirklich nicht gemeint«, lachte Jörg. »Die Damen sind meine Gäste.«
Britta lächelte in sich hinein. Vielleicht hat’s bei ihm gefunkt, dachte sie. Jedenfalls machte er einen recht gelösten Eindruck.
Während sich Barbara für den kleinen Ausflug ankleidete, erfuhr sie dann, dass Mona die Behnisch-Klinik schon wieder verlassen hätte.
»Billing hat sie geholt«, sagte Jörg beiläufig. »Sie scheint etwas zu wissen, womit sie ihn unter Druck setzen kann. Jenny Behnisch sagte, dass er recht hektisch gewesen wäre, als er Mona abholte. Mir kann’s egal sein.«
Barbara war ihm jedenfalls nicht gleichgültig. Britta kannte ihren Bruder, und sie freute sich im Stillen, dass sie so heiter beisammen sein konnten.
Das Essen schmeckte. Barbara zuckte nur hin und wieder zusammen, wenn sie eine hastige Bewegung machte, aber der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Und dann sagte sie schelmisch: »Gelobt sei der Hexenschuss, der mir einen so schönen Tag beschert hat, wie ich ihn wirklich schon lange nicht mehr erlebt habe.«
»Haben Sie denn keinen Freundeskreis?«, fragte Jörg nachdenklich.
»Ich war wohl zu viel unterwegs mit ständig wechselnden Gesellschaften«, erwiderte sie sinnend.
»Und nun?«, fragte er.
»Nun beherzige ich die Ermahnungen des Dr. Rosen«, erwiderte sie lächelnd. »Ich werde mich bemühen, sesshaft zu werden, wenn ich eine berufliche Möglichkeit finde.«
Britta sagte ihm später, was sie sich überlegt hatte. »Dr. Zeller könnte eine Übersetzerin gut brauchen. Was meinst du, Jörg?«
»Er ist doch fast blind«, stellte Jörg gedankenlos fest.
»Er soll ja auch nicht Barbaras Schönheit zur Kenntnis nehmen, sondern ihre Sprachkenntnisse«, meinte Britta neckend. »Er hat Geld, und außerdem ist er ein kluger vornehmer Mann.«
»Ich dachte, ich könnte Barbara für meine Praxis gewinnen«, sagte er zögernd.
»Du könntest sie nicht bezahlen, Jörg«, sagte Britta nachdenklich. »Sie braucht eine bestimmte Summe. Sie hat ganz offen mit mir darüber gesprochen. In zwei Jahren will sie die Wohnung schuldenfrei haben, dann hat sie mehr Luft. Aber vielleicht tut sich bis dahin noch einiges, und sie würde die Wohnung nicht mehr brauchen. Sie könnte diese dann verkaufen.«
»Will sie heiraten?«, fragte er hastig.
»Nein, davon ist nicht die Rede, aber könnte es nicht sein, dass ein gewisser Dr. Rosen diesbezüglich Interesse zeigen würde? So manche Arztfrau hilft ihrem Mann doch gern in der Praxis.«
»Ich muss doch sehr bitten, Britta. So will ich nicht zu einer billigen Hilfe kommen. Dazu hat Barbara ja wohl auch zu viel Format.«
Britta lachte vergnügt. »So habe ich es auch wirklich nicht gemeint. Sie gefällt dir doch, du brauchst es nicht zu leugnen.«
»Ich leugne es nicht, aber man muss sich doch erst besser kennenlernen.«
»Dazu, liebes Brüderchen, wirst du jetzt ja Gelegenheit haben. Ein schöner Rücken kann sehr entzücken!«
»Werde bloß nicht zu frech«, erwiderte er, aber er lächelte dabei verschmitzt. Sie gab ihm rasch einen Kuss, und er legte seinen Arm um ihre Schultern. »Ich wünschte, ich könnte dir ein männliches Pendant zu Barbara offerieren.«
»He, wie meinst du das? Von wegen eine Hand wäscht die andere?«
»Einen Partner, der so ehrlich, und so humorvoll ist wie Barbara, meine ich. Nach unseren trüben Erfahrungen bringt das einen Lichtblick.«
*
Einen solchen Lichtblick schien es für Britta bereits am Dienstag zu geben. Da sie um die Schwierigkeiten, beim Kongresssaal zu parken, wusste, hatte sie sich einen Platz in einer Nebenstraße gesucht. Und gleich neben ihr hielt dann ein anderer Wagen mit dem Äskulapstab am Fenster. Aber er hielt schon im Halteverbot. Britta hatte das gleich gesehen.
Der Mann, der ausstieg, war groß und breitschultrig, und durch eine goldgefasste Brille sah er sie irritiert an, als sie sagte: »Vorsicht, Herr Kollege.«
»Wieso?«, fragte er.
»Sie parken im Halteverbot«, erklärte Britta.
»Wenn man keinen anderen Platz findet«, brummte er.
»Und wenn man Ihren Wagen abschleppt?«, fragte sie.
Er deutete auf seine Windschutzscheibe und lächelte belustigt. »Arzt im Dienst«, sagte er trocken.
»Ach so, Sie wollen gar nicht zum Kongress«, sagte Britta verlegen.
»O doch, das will ich, aber manchmal ist so ein Schild doch zu was nütze. Und ich glaube, dass man heute sowieso ein Auge zudrücken wird. Und falls mein Wagen wirklich abgeschleppt werden sollte, sind Sie vielleicht so freundlich, mich dorthin zu fahren, wo ich ihn abholen kann, reizende Kollegin.«
Ganz schön frech, dachte Britta, aber er hatte es so nett gesagt, dass sie nicht böse sein konnte.
»Sofern ich dann nicht in den Verdacht gerate, gewisse Absichten zu hegen«, erwiderte sie schlagfertig.
Ein Blick umhüllte sie, der sie erröten ließ. »Dagegen hätte ich nun gar nichts einzuwenden«, sagte er leise, »aber Scherz beiseite. Den Zufall schickt uns Gott, sagt man doch. Mein Name ist Steinsdorf, Constantin mit Vornamen. Darf ich nun auch erfahren, wie meine reizende Kollegin heißt?«
»Britta Rosen«, erwiderte sie.
»Freut mich ungemein. Also gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieser Kongress so erfreuliche Aspekte eröffnet. Man muss sich ja ab und zu mal anhören, was die allwissenden Herren Kollegen mitzuteilen haben.«
Britta sah ihn kurz aber forschend an. Hätte sie ihn aus weiterer Entfernung gesehen, wäre ihr Urteil anders ausgefallen. Dann hätte sie ihn als arrogant eingeschätzt, denn er war an sich ein schwer einzuschätzender Typ Mann.
Aber sie sah ihn nahe. Ein schmales, ausdrucksvolles, sehr männliches Gesicht, einen gutgeschnittenen Mund, dessen Winkel humorvoll emporzuckten, und die grauen Augen hatten einen warmen Schimmer.
Vielleicht hatte er den fragenden Ausdruck ihrer Augen falsch gedeutet, denn nun sagte er lächelnd: »Ich bin nicht verheiratet und suche auch kein Abenteuer, aber von einer so reizvollen Überraschung lasse ich mich gern gefangennehmen. Hat nicht jeder Mensch insgeheim den Wunsch, dass einem das mal passiert?«
»Sie sind sehr direkt«, erklärte Britta stockend.
»Ja, das hatte ich mir vorgenommen, wenn mir mal die Frau über den Weg laufen sollte, die mir auf Anhieb gefällt. Da wollte ich nichts dem Zufall überlassen.« Er geriet plötzlich ins Stocken. »Oder sind Sie verheiratet?«
»Nein«, erwiderte Britta leise.
»Es ist zwar unbegreiflich, dass so eine Frau noch zu haben ist, aber warum soll man nicht auch mal Glück haben«, sagte Constantin Steinsdorf. »Man könnte tatsächlich abergläubisch werden.«
»Wieso?«, fragte Britta.
»Zuerst trabte links am Weg eine Schafherde vorbei. Schäfchen zur Linken, Freude tut winken, das hab’ ich von Mama gelernt. Dann kam auch noch ein Brautpaar in einer weißen Kutsche, und außerdem soll die Vierzehn angeblich meine Glückszahl sein. Und heute ist der Vierzehnte. Müssen wir eigentlich diesen Kongress besuchen?«
»Deshalb habe ich mir Urlaub genommen«, erwiderte Britta.
»Liebe Güte, dafür opfern Sie Urlaubstage?«
»Ich muss noch viel lernen. Sie haben wahrscheinlich schon mehr Praxis als ich.«
»Was das Lernen anbetrifft, meine ich auch, dass wir damit nie aufhören dürfen. Was jedoch das Glück angeht, sollte man es genießen, wenn es vom Himmel fällt.«
»Vom Himmel fällt jetzt Regen«, sagte Britta mit einem leisen Lachen, und ein großer Tropfen war genau auf ihrer Nase gelandet. Schnell zog er sie in einen Hauseingang, und gleich darauf prasselte der Regen wolkenbruchartig hernieder.
»Und aller Segen kommt von oben«, murmelte er und drückte ihre Fingerspitzen an seine Lippen. »So etwas kann man auf einem Kongress nicht erfahren, Britta Rosen, das muss man erleben. Dennoch gebührt diesem Kongress Dank.«
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, murmelte Britta.
»Nichts, schau mich an«, erwiderte er mit dunkler Stimme.
»Es ist ein bisschen verrückt«, flüsterte Britta.
»Ich finde es wunderschön«, sagte Constantin. »Schade, dass der Regen schon wieder aufhört.«
»Den Vortrag von Professor Korten möchte ich hören.«
»Einverstanden. Seinetwegen bin ich auch gekommen, nicht ahnend, dass ich etwas viel Wichtigeres erleben würde. Korten war mein Doktorvater.«
»Meiner auch«, lächelte Britta.
»Das haben wir also auch gemeinsam, aber uns verbindet bestimmt noch viel mehr«, sagte Constantin mit so viel innerer Überzeugung, dass es Britta ganz heiß wurde.
*
Der Kongress schien unter keinem guten Stern zu stehen.
Wahrscheinlich war auch der Wolkenbruch mit daran schuld, dass sich noch nicht alle Teilnehmer eingefunden hatten. Constantin und Britta waren noch lange nicht die Letzten!
Um sie herum herrschte Betriebsamkeit, doch ihnen machte das nichts aus. Sie fühlten sich, als wären sie allein auf der Welt. Es gab Liebe auf den ersten Blick, auf das erste Wort.
Dann erfuhren sie, dass Professor Billing erkrankt sei und den Kongress nicht eröffnen könne. Das freilich stimmte Britta nachdenklich, und sie fragte sich, ob Mona damit etwas zu tun haben könnte. Sie konnte ja nicht wissen, was sich inzwischen in der Klinik zugetragen hatte. Das berauschende Glücksgefühl, das sie an Constantin Steinsdorfs Seite empfand, wäre mit einem Schlag erstickt worden.
Professor Kortens Vortrag, so interessant er auch war, konnte sie nicht fesseln, da Constantin seine Hand unter ihren Arm geschoben hatte und mit seinem Zeigefinger ihren Puls berührte. Ihre Herzen schlugen im gleichen Takt, das war keine Einbildung.
In der Pause kam die Ernüchterung durch den Lautsprecher.
»Frau Dr. Rosen wird gebeten, sofort ins Klinikum zu kommen.«
Britta schrak zusammen.
»Es muss etwas passiert sein«, murmelte sie. »Ich muss fort.«
»Der Ruf braucht dich nicht erreicht zu haben«, sagte Constantin.
Sie sah ihn gedankenvoll an. »Du würdest auch gehen«, sagte sie leise.
»Okay, dann komme ich mit«, sagte er, und das schien genauso selbstverständlich wie das Du.
Er führte sie zu seinem Wagen, der nicht abgeschleppt worden war.
»Ich weiß nicht, was sein könnte«, sagte Britta. »Ich bin doch nur eine kleine Assistenzärztin.«
»Ist Billing dein Chef?«, fragte Constantin.
»Der alleroberste, aber ich hatte noch nie mit ihm zu tun. Ich bin erst seit kurzer Zeit an der Klinik.«
Dann dachte sie wieder an Mona, und ein Schrecken durchzuckte sie. Aber was sie dann erfuhr, raubte ihr fast die Besinnung. Horst Mehlsen war tot, er war hier an einer Überdosis Heroin gestorben, und er hatte ihren Namen genannt, als er eingeliefert wurde.
Constantin hatte sich zwar zurückgehalten, aber er konnte hören, wie es Britta gesagt wurde, und er sah, wie sie angeschaut wurde.
Er trat auf sie zu. »Was ist, Britta?«, fragte er. »Worum handelt es sich?«
Und da war plötzlich Mona da. Britta hatte sie noch gar nicht wahrgenommen.
»Es handelt sich um den Verlobten von Dr. Britta Rosen«, sagte Mona mit einem zynischen Unterton, »um unseren Kollegen Mehlsen.«
»Um unseren früheren Kollegen«, sagte jemand.
Britta sah Constantin mit einem Ausdruck von Schrecken und Verzweiflung an und flehend dazu.
»Was habe ich damit zu tun?«, fragte sie tonlos.
»Das wird wohl geklärt werden müssen.« Wieder war es Mona, die das sagte. Und plötzlich dachte Britta, wieso Mona überhaupt hier sei.
»Und was hast du hier zu tun?«, fragte sie heiser.
»Ich habe Horst hergebracht, aber er war nicht mehr zu retten. Du wirst jetzt einige Fragen beantworten müssen.«
Constantins Gedanken überstürzten sich. Man hatte von Brittas Verlobten gesprochen, aber ihm bedeutete das nicht so viel wie ihr hilfeflehender Blick.
»Ich möchte mit Frau Rosen sprechen«, sagte er.
Mona maß ihn mit einem abschätzenden Blick. »Sie werden sich gedulden müssen«, sagte sie. »Ich vertrete in dieser Angelegenheit Professor Billing. Wer sind Sie denn überhaupt?«
»Dr. Steinsdorf, Internist«, erwiderte Constantin sarkastisch, »und ich bin …« Er kam nicht weiter, Britta fiel ihm ins Wort. »Das hier ist meine Angelegenheit«, sagte sie tonlos. »Ich danke Ihnen, dass Sie mich herbrachten, Herr Kollege.«
»Und ich werde warten«, sagte er, »solange es auch dauert.«
Der Doppelsinn dieser Worte wurde Britta nicht gleich bewusst. Sie war aus einem zärtlichen Traum in die raue Wirklichkeit gerissen worden, aus lichten Wolken in schwarze Tiefe gefallen. Aber sie gewann ihre Fassung zurück, als Monas gehässiger Blick sie traf. Sie straffte sich.
Dann wurde auf sie eingeredet. Ein regelrechtes Verhör begann.
Jemand müsse Horst die Drogen verschafft haben, wurde gesagt.
Da wurde ihr jäh bewusst, dass man sie verdächtigte. »Ich habe ihn schon Wochen nicht gesehen«, sagte sie.
»Aber er war bei euch. Er hat es mir gesagt«, erklärte Mona.
»Sie waren doch mit ihm verlobt«, sagte der Oberarzt.
»Und ich habe die Verlobung gelöst, als er sich in diesen Kreisen bewegte«, erklärte sie nun ruhig. »Vorerst möchte ich dazu nicht Stellung nehmen. Ich bin selbst sehr interessiert, dass dieser Fall genauestens untersucht und geklärt wird. Ich werde es veranlassen, wenn es sonst niemand tut. Ich nehme an, dass man mich von meiner Tätigkeit hier entbinden wird. Ich habe ja ohnehin noch ein paar Tage Urlaub. Auf dem Kongress wurde bekannt, dass Professor Billing erkrankt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau Lohr offiziell seine Vertretung übernehmen soll. Gegen ungerechtfertigte Vorwürfe werde ich mich jedoch zu schützen wissen. Sie wissen, wo ich zu erreichen bin. Im allgemeinen Interesse hoffe ich, dass diese Angelegenheit korrekt behandelt wird, und nicht unter dem Gesichtspunkt, dass ich einmal mit Horst Mehlsen verlobt gewesen bin. Guten Tag.«
Und dann ging sie und ließ sprachlose Kollegen zurück.
Constantin hatte gewartet, aber Britta wich zurück, als er ihre Hand ergreifen wollte.
»Es war doch kein Glückstag«, sagte sie leise. »Es ist besser, wenn du aus dem Spiel bleibst. Es ist ein böses Spiel, Constantin Steinsdorf.«
»Ich will wissen, worum es geht«, sagte er. »Mich wirst du nicht los, nie mehr.«
»Man hat von meinem Verlobten geredet«, sagte Britta.
»Ich habe es gehört.«
Plötzlich war sie wieder ganz ruhig. Seine Stimme war es, die ihre Erregung dämpfte. Es war nicht der Mann, der ihr Herz so stürmisch hatte klopfen lassen, es war ein Mensch, der sich nicht abschrecken ließ durch eine Tatsache, die schockierend wirken musste, nach einer romantischen Ouvertüre.
»Jetzt fahren wir raus aus der Stadt, und du schaltest ab, Sternschnuppe«, sagte er weich. »Und dann reden wir über alles.«
Heiße Tränen stiegen in Brittas Augen. »Sternschnuppe, das stimmt sogar«, sagte sie verhalten. »Eben war ich noch im Himmel und nun bin ich hart auf dem Boden gelandet. So einfach, wie du es vielleicht sehen willst, ist das alles nicht. Mona Lohr wird schon dafür sorgen, dass Britta und Jörg Rosen was zu knabbern haben.«
»Und wer ist Jörg?«, fragte er.
»Mein Bruder. Er hatte mal die Absicht, Mona zu heiraten. Er ist auch Arzt. Orthopäde, und er hat gerade eine Praxis angefangen die sich gut angelassen hat. Ich fürchte, Mona will nicht nur mir was anhängen, sondern auch Jörg. Und ihn würde es schlimmer treffen.«
»Du musst nicht gleich zu schwarz sehen, Britta«, sagte Constantin. »Immer langsam mit den jungen Pferden, sagt Mama.«
»Du sprichst oft von Mama«, sagte sie gedankenvoll.
»Weil ich eine sehr liebe, gütige Mutter habe, Britta. Du nicht?«
»Wir sehen uns selten. Unser Vater ist ziemlich früh gestorben, und Mutter hat wieder geheiratet. Sie lebt in England. Sie lebt zufrieden und wir auch, wenn man es so nennen will.«
Für einen Augenblick war sie abgelenkt, aber wirklich nur für wenige Minuten.
»Ich mag meinen Wagen da nicht stehen lassen«, sagte sie plötzlich. »Und ich muss auch Jörg Bescheid sagen. Er sollte es nicht von Mona erfahren.«
»Gut, dann holen wir deinen Wagen, und ich fahre dir dann nach«, sagte er.
Sie schluckte aufsteigende Tränen hinunter. »Es wäre besser, du würdest vergessen, dass du Britta Rosen kennengelernt hast«, sagte sie.
»Du verlangst ein bisschen viel. Das werde ich nie vergessen. Das ist nämlich Liebe, Britta. Ich bin kein grüner Junge.«
Britta versuchte ein Lächeln. »So siehst du auch nicht aus.«
»Und wie sehe ich aus?«, fragte er sanft.
Nun purzelten doch die Tränen, die sie hatte zurückhalten wollen.
»Du bist so lieb. Jörg hat mir das Pendant zu Barbara gewünscht, und so bist du.«
»Und wer ist Barbara? Wir müssen uns noch viel erzählen, Britta, sehr viel.«
»Und du glaubst nicht, dass ich schuld an seinem Tod bin?«
»Mein liebes Mädchen, ich weiß nicht, worum es eigentlich geht, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass du niemandem Drogen geben würdest. Das habe ich mitbekommen, und darüber müssen wir auch reden. Ich lasse dich nicht gern allein ans Steuer, Britta.«
»Ich will nicht, dass der Wagen hier stehen bleibt«, sagte sie eigensinnig. »Ich fahre immer vorsichtig.«
»Gut, ich werde mich davon überzeugen«, sagte er.
Er fuhr ihr nach, aber an einer Kreuzung verlor er ihren Wagen dann doch aus den Augen, weil sie noch grün hatte und er halten musste. Und erst da fiel ihm ein, dass er ihre Adresse noch gar nicht kannte. Nun brach ihm doch der Schweiß aus. Er hielt bei der nächsten Telefonzelle, aber im Telefonbuch fand er keine Britta Rosen und auch keinen Jörg. Es war das Telefonbuch vom vergangenen Jahr, in dem Jörgs Nummer noch nicht stand.
Constantin rief die Auskunft an. Es dauerte einige Zeit, aber dann bekam er den Bescheid, den er sehnlichst erwartete, die Nummer und auch die Adresse. Aber dann musste er suchen, bis er die Buchenstraße fand.
Britta hatte bemerkt, dass ihr Constantins blaumetallicfarbener Wagen nicht mehr folgte, und auch ihr fiel ein, dass sie ihm die Adresse nicht genannt hatte.
Vielleicht soll es so sein, dachte sie. Vielleicht überlegt er es sich jetzt. Oder war es überhaupt nur ein Traum? In ihr war ein solches Durcheinander, dass sie wirklich kaum noch einen klaren Gedanken fassen konnte.
Wieso hatte Mona Horst in die Klinik gebracht? Wo hatte sie ihn getroffen, und was bezweckte sie nun? Warum war Billing krank und was glaubte man, ihr eigentlich anhängen zu können?
Ein Motorradfahrer überholte und schnitt sie, und nun dachte sie wieder an jenen Unfall, in den auch Mona verwickelt gewesen war. Sie hatte nicht so ausgesehen, als hätte sie einen Schock zu überwinden, und kein Kratzer war bemerkbar gewesen.
Ich muss alles in Ruhe überlegen, mit Jörg darüber sprechen, ging es ihr durch den Sinn. Und sie atmete auf, als sie vor dem Haus hielt.
Jörg hatte noch Sprechstunde, aber auch Barbara war da zur Bestrahlung.
Bereitwillig hatte ihr das die Sprechstundenhilfe gesagt, als Britta fragte, ob noch viel los sei.
»Der Herr Doktor hat gerade mit einer Achillessehne zu tun, und Frau Heinicke bekommt Mikrowellen, und für mich wäre eigentlich schon seit zehn Minuten Feierabend.«
»Sie können ruhig gehen«, sagte Britta. »Ich bin ja jetzt hier.«
»Wenn Sie es sagen«, murmelte das Mädchen. »Ich habe heute nämlich was vor. Frau Heinicke muss noch zehn Minuten angeschlossen bleiben. Die Uhr ist gestellt.«
»Macht Ihnen die Arbeit eigentlich Spaß?«, fragte Britta beiläufig.
»Es ist schon ziemlich anstrengend«, kam die Antwort, »aber ich heirate ja bald.«
Du lieber Gott, dachte Britta, aber jetzt hatte sie doch größere Sorgen. Marika entschwand, gleich darauf kam Jörg aus dem Sprechzimmer. Überrascht schaute er Britta an. »Du bist schon zurück? Von der Klinik wurde angerufen, dass du dringend gebraucht wirst. Haben sie dich auf dem Kongress nicht erreichen können?«
»Doch, und jetzt werde ich vorerst in der Klinik nicht mehr gebraucht. Es ist etwas passiert. Ich erzähle es dir später.«
Da läutete es. »Ich öffne schon«, sagte Britta, »das Mädchen habe ich gehen lassen.«
Als dann aber Constantin in der Tür stand, schwankte sie leicht.
»Ich habe mich erst nach der Adresse erkundigen müssen«, erklärte er hastig, »sonst wäre ich längst hier.« Er nahm sie in die Arme, was Jörg fassungslos zur Kenntnis nahm. »Ich habe dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr los wirst, Britta.«
Über ihre Schulter hinweg blickte er Jörg an. »Steinsdorf heiße ich«, murmelte er.
»Ich habe noch Patienten hier«, sagte Jörg verwirrt. »Wir sprechen uns noch?«
»Aber sicher.«
»Ich komme hier jetzt allein zurecht«, sagte Jörg.
»Gut, dann gehen wir nach oben«, erwiderte Britta.
Jörg ging zu Barbara und stellte das Gerät ab. »Ist was mit Britta?«, fragte sie stockend.
»Anscheinend ist was passiert, und jetzt ist ein Fremder aufgekreuzt.«
Barbara lächelte jetzt flüchtig. »Britta scheint er nicht fremd zu sein.«
Es läutete wieder. Nun wurde der andere Patient, der einen Meniskusriss hatte, abgeholt. Dann war Jörg mit Barbara allein. Sie hatte sich schon ganz rasch angekleidet, während er den Patienten verabschiedet hatte.
»Ich werde verschwinden«, sagte sie. »Liebe Grüße an Britta, und wenn sie Hilfe braucht, Anruf genügt.«
»Bleiben Sie doch noch, Barbara«, sagte er bittend. »Vielleicht störe ich da oben.«
»Es könnte aber auch sein, dass Sie erwartet werden«, meinte Barbara. »Ich bin ja schnell zu erreichen.« Ein besorgter Ausdruck war in ihren Augen. »Ist es was Schlimmes?«
»Ich weiß es nicht. Es muss mit der Klinik zusammenhängen.«
»Britta lässt sich nichts zuschulden kommen«, sagte Barbara mit ernstem Nachdruck.
»Es gibt missgünstige Menschen, Barbara.«
Er hatte es noch nicht ausgesprochen, als es wieder läutete.
»Bitte, bleiben Sie hier, Barbara. Man braucht Sie nicht zu sehen«, sagte Jörg, nichtsahnend, wie bedeutungsvoll sich diese Bitte erweisen sollte.
Barbara vernahm eine hohe, klirrende Stimme. »Ich muss dich sprechen, Jörg. Ist Britta zu Hause?«
Barbara wunderte sich, dass Jörg mit nein antwortete.
»Das ist gut. Horst ist gestorben an einer Überdosis Morphin. Wir dachten zuerst, er hätte Heroin gespritzt. Du musst Britta ausreden, da etwas zu unternehmen. Sie wird keine Schwierigkeiten in der Klinik bekommen, wie sie vermutet. Dass er süchtig war, wussten ja alle. Es wird kaum zu klären sein, woher er es bekommen hat. War er hier in der Praxis?«
Mona hatte sich an Jörg vorbeigedrängt und schaute sich um. Er hatte die Arme über der Brust verschränkt und beobachtete sie aus schmalen Augen.
»Bei mir wirst du kein Morphin finden«, sagte er eisig. »Ich gebrauche andere Mittel, falls es nötig ist. Und von Britta hat er ganz bestimmt nichts bekommen. Was hast du eigentlich damit zu schaffen?«
»Er hat mich angerufen. Er wollte zu Britta. Ich wusste nicht, dass sie nicht in der Klinik ist. Ich habe ihn dort getroffen, aber da war er schon halb bewusstlos.«
»Das klingt alles ein bisschen seltsam«, sagte Jörg ruhig. »Warum bist du so nervös, Mona?«
»Horst hat mir gesagt, dass er bei dir gewesen ist, und dass Britta ihm schon mal geholfen hat.«
»Ja, sie hat ihn zu einer Entziehungskur veranlasst, aber es hat nichts genützt, und sie hat ihn schon Wochen nicht mehr getroffen.«
»Bist du ganz sicher?«, fragte sie aggressiv.
»Ganz sicher, und sie hat auch nicht den geringsten Grund, etwas zu verschweigen.«
»Horst lebt nicht mehr, und mit Rücksicht auf seine Eltern sollte Britta diese Sache aber nicht aufbauschen. Niemand wird ihr etwas am Zeug flicken, das verspreche ich. Ich werde dafür sorgen, dass diese Angelegenheit so diskret wie möglich behandelt wird.«
Barbara konnte jedes Wort verstehen.
Sie stenografierte instinktiv alles mit, ohne wissen zu können, dass Jörg das Tonband unauffällig eingeschaltet hatte. Barbara war aufgeregt, sie spürte, dass jene Mona eine bestimmte Absicht verfolgte und gewiss nicht diese, Britta oder gar Jörg einen Freundschaftsdienst zu erweisen.
»Auf Diskretion lege ich keinen Wert, wenn es darum geht, dass an Britta doch etwas hängen bleiben soll und man nur um den Ruf der Klinik besorgt ist, wie auch um das Image von Horsts Eltern. Gewiss ist es für diese ein Schock, dass das, was Britta ihnen vertraulich sagte, um sie aufmerksam zu machen auf Horsts Abgleiten, nun doch publik wird, dass sie es nicht mehr wegreden können, aber Britta trifft wirklich keine Schuld.«
»Wieso eigentlich nicht?«, fragte Mona giftig. »Sie hat ihn doch fallen lassen. Ihr mit eurer spießigen Einstellung, mit eurem engen Horizont. Es gibt eben Menschen, die großzügiger denken, die nicht gleich Moral pauken.«
»Die alles ausprobieren müssen und ihr Leben verkorksen«, sagte Jörg. »Deren Leben zu Ende ist, bevor es noch richtig begann. Wenn dir das gefällt, wenn du das rechtfertigen kannst, bitte.«
»Ihr seid ja so erhaben«, zischte Mona. »So schrecklich überheblich und von euren Qualitäten überzeugt.«
Jörg lachte trocken auf. »Darf ich dich daran erinnern, dass du mich einen Schwächling ohne Initiative, ohne Mut zum Risiko genannt hast, von anderen Vorwürfen ganz zu schweigen? Nun, ich gebe zu, dass ich Risiken gern vermeide. Aber was soll dieses Gerede überhaupt? Ich habe noch etwas anderes vor.«
»Schön, wenn du dich so benimmst, werde ich eben nichts tun, um euch zu entlasten«, ereiferte sie sich gereizt.
»Uns braucht niemand zu entlasten«, sagte Jörg eisig. »Anscheinend gehörtest du doch zu den Letzten, die Horst lebend begegnet sind. Sei also vorsichtig mit verleumderischen Bemerkungen, Mona. Es könnte ins Auge gehen. Du hast allerhand gesagt, was mir gar nicht gefällt.«
Sie lachte frivol auf. »Und wie willst du das beweisen? Versuch es doch.«
»Das Tonband war eingeschaltet«, sagte er sarkastisch.
»Und es gibt eine Zeugin«, ertönte da Barbaras Stimme.
Wie eine Rachegöttin stand sie in der Tür. Mona wurde kreidebleich.
»Ein vorsichtiger Arzt empfängt eine Patientin nie allein«, sagte Barbara spöttisch.
»Ich bin keine Patientin«, stieß Mona hervor. »Ich habe eine sehr enge Beziehung zu Dr. Rosen, wenn Sie das zur Kenntnis nehmen wollen.«
»Hatten«, sagte Barbara gelassen. »Ich weiß Bescheid.«
Ein bisschen konsterniert war Jörg schon, als Barbara das sagte.
»Wer ist diese Person?«, fauchte Mona.
»Meine zukünftige Frau«, erwiderte Jörg mit einem hintergründigen Lächeln und Barbara mit einem zwingenden Blick anschauend.
Zuerst hatte ihr der Atem gestockt, aber nun bewies sie, wie schlagfertig und geistesgegenwärtig sie war. »Und frühere Beziehungen interessieren mich überhaupt nicht«, erklärte sie herablassend. »Und wenn Sie Jörg und Britta schaden wollen, müssen Sie sich schon was anderes ausdenken, Frau Lohr.«
»Ich brauche mir nichts auszudenken. Ihr werdet schon noch euer blaues Wunder erleben«, giftete Mona, aber dann ging sie.
Wie festgebannt blieben Jörg und Barbara durch die Breite des Raumes getrennt stehen.
»Woher wissen Sie ihren Nachnamen, Barbara?«, fragte Jörg fassungslos.
»Ich bitte es nicht übelzunehmen, aber Britta hat von ihr gesprochen. Jetzt spielt das doch keine Rolle mehr. Es war ein guter Gag, der sie ganz schön geschockt hat.«
»Das mit dem Tonband?«
»Ich meine mehr, dass Sie mich als Ihre zukünftige Frau bezeichneten.«
»Das betrachte ich nicht als Gag. Könnten Sie sich nicht an diesen Gedanken gewöhnen, Barbara?«
Ihre Augen weiteten sich, aber dann sagte sie mit einem umwerfenden Lächeln: »Solange wir uns noch siezen, dürfte das ein bisschen schwierig sein, aber man braucht ja nichts zu überstürzen. Ich denke, wir werden noch einige Probleme bewältigen müssen.«
Nun kam er auf sie zu und ergriff ihr Hände. »Du bist eine wundervolle Frau«, sagte er verhalten. »Wirst du mir diesen Fehltritt verzeihen können?«
»Welchen?«, fragte sie schelmisch.
»Mona.«
»Sie wird auch gewisse Vorzüge haben«, stellte Barbara gleichmütig fest, »ich verstehe nur nicht, wie eine Ärztin sich selbst so disqualifizieren kann. Ich hoffe nur, dass Britta sich nicht ins Bockshorn jagen lässt.«
*
Das war nicht zu fürchten. Britta hatte Constantin erzählt, was er wissen wollte. Sie hatte von Horst gesprochen und von Mona.
»Die Mehlsens sind reich und haben viel Einfluss«, erklärte Britta, »und wenn Mona mit ihnen unter einer Decke steckt, kann es noch einigen Wirbel geben. Du solltest dich da wirklich heraushalten, Constantin. Es könnte deiner Mutter nicht gefallen, dass du dich mit einer Frau einlässt, die mit einem Drogensüchtigen verlobt war.«
»Du kennst meine Mutter nicht, aber du wirst sie kennenlernen, Britta«, sagte Constantin. »Sie ist Psychotherapeutin und war bis vor einem Jahr Chefärztin in einer Entziehungsklinik.«
»Bei Horst hat die Entziehungskur nichts genützt, und seine Eltern gaben mir die Schuld. Sie wollten, dass ich ihn heirate.«
»Obgleich sie Bescheid wussten?«
»Sie wollten es nicht wahrhaben. Sie hatten unzählige Entschuldigungen. Der Stress der Examen war für ihren sensiblen Sohn zu viel, und ich habe ihn in meinem übersteigerten Ehrgeiz vernachlässigt. Es hätte ihn deprimiert, also war ich auch diesbezüglich schuld. Dass er auch andere Neigungen hatte, wollten sie erst recht nicht wahrhaben, und bei sich selbst suchen sie gewiss keine Schuld. Er bekam doch alles, und schließlich war er ein glänzender Schüler gewesen. Natürlich muss man mit so einem Abitur Medizin studieren, und selbstverständlich würden die reichen Eltern ihrem begabten Sohn dann auch eine Privatklinik einrichten. Aber als Arzt taugte er nichts, das habe ich nur ein bisschen zu spät begriffen. Ich ließ mich auch von seinem Charme einfangen, wie viele andere weibliche Wesen auch. Er fühlte sich als Apollo. Die Frauen sollten ihm zu Füßen liegen. Er wollte alles haben, aber nichts geben. Er hat mich nicht geliebt, Constantin, er hat mich gehasst, weil ich ihn durchschaut habe, weil ich nicht mitmachte.«
»Aber du hast ihn geliebt, als du dich mit ihm verlobtest«, sagte Constantin nachdenklich.
»Ich war verliebt, und es war eigentlich alles so wie ich es mir in meinen Illusionen vorgestellt hatte. Er stellte mich bald seinen Eltern vor, ich wurde mit offenen Armen empfangen. Sie müssen gewusst haben, wie labil er war und haben wohl erwartet, dass ich ihn mitziehe, ihm bei der Doktorarbeit helfe. Aber dabei erkannte ich, dass er für unseren Beruf überhaupt nicht geeignet war, dass ihm jegliches menschliche Verständnis abging. Während ich arbeitete, experimentierte er, mit Menschen und mit Drogen, wie ich dann auf erschreckende Weise erfahren musste.«
»Inwiefern erschreckend?«, fragte Constantin.
»Ich ließ mich von Horst überreden, mal an solcher Meditationsrunde, wie er es bezeichnete, teilzunehmen. Zuerst fand ich diese Atmosphäre nur skurril, dann begriff ich, dass die meisten schon high waren, dachte aber immer noch, dass sie sich gegenseitig helfen wollten, von ihrer Sucht loszukommen. Ich war sehr naiv, Constantin. Es artete in eine Götzenanbetung aus, und endlich wurde mir klar, dass Horst sich darin gefiel. Er nannte mich verklemmt und verlangte, mich so von meinen Hemmungen zu befreien. Es war mein Glück, dass dann ein Mädchen und ein junger Mann hereingestürzt kamen. Ihrem wirren Gerede konnte ich entnehmen, dass die Polizei hinter ihnen her sei. Horst kam mit mir. Er versprach mir auch, eine Entziehungskur zu machen, wenn ich seinen Eltern nichts erzählen würde. Da dachte ich, dass er noch zu retten wäre, aber das war Fehlanzeige. Daraufhin sprach ich mit seinen Eltern, aber sie sagten, dass ich das alles wohl übertreiben würde und außerdem eine falsche Einstellung zum Partner hätte. Da blieb mir nichts weiter, als zu sagen, dass er sich für solche Spielchen eben eine andere Partnerin suchen müsse. Sie ließen durchblicken, dass sie von mir zumindest erwarten würden, dass ich seine Doktorarbeit schreibe.«
»Ein starkes Stück«, sagte Constantin. »Unfähige Ärzte gibt es doch genug.«
»Was hat Mona damit zu tun, das stimmt mich sehr nachdenklich«, sagte Britta leise.
Bald darauf war Jörg gekommen, und sie hatten gemeinsam überlegt, nachdem er ausführlich von Monas Besuch berichtet hatte.
»Denken wir mal ganz logisch«, sagte Jörg. »Mona und Horst haben sich immer gut verstanden. Vielleicht haben sie sich öfter getroffen.«
»Ich traue Mona viel zu, aber nicht, dass sie sich mit Drogensüchtigen einlässt«, warf Britta ein.
»Für einflussreiche Leute war sie immer zu haben. Mit Billing lief es anscheinend nicht so, wie sie es sich gedacht hatte, und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich um Horst bemüht hat«, meinte Jörg. »Es geht mir nicht aus dem Sinn. Horst war vormittags da und wollte dich sprechen. Mona kam abends und wurde in den Unfall verwickelt.«
»Und es war dein Pech, dass du zu dem Unfall gerufen wurdest«, sagte Britta.
»Nun, ich denke, dass sie sowieso nach mir verlangt hätte«, erklärte er gedankenvoll. »Jedenfalls wurde sie am Sonntag von Billing abgeholt.«
»Und er konnte wegen Krankheit den Kongress nicht eröffnen«, sagte Constantin.
Jörgs Kopf ruckte empor. »Darf ich jetzt mal fragen, wann und wo ihr euch kennengelernt habt?«
»Heute Morgen, am Parkplatz«, erwiderte Constantin, »zwei Kollegen, die sich auf Anhieb sehr sympathisch waren. Mir wäre es offengestanden lieber gewesen, der Tag hätte einen anderen Verlauf genommen. Doch davon abgesehen …« Er griff nach Brittas Hand und drückte sie an seine Wange. »Es überwiegt das Glück, dass wir uns überhaupt begegnet sind.«
»Und es bleibt die Frage, wann Mona und Horst möglicherweise gemeinsame Beschlüsse gefasst haben«, sagte Jörg. »Aber ich werde jetzt Barbara anrufen, um ihr zu sagen, dass Britta bereits moralische Unterstützung hat.«
»Sie könnte dir doch solche gewähren«, meinte Britta.
»Das hat sie bereits getan. Worauf Mona das Feld wortlos räumte!«
Davon musste er dann auch noch erzählen. Britta stellte nachdenklich fest, welche bemerkenswerten Parallelen es doch in Jörgs und ihrem Leben gäbe.
»Es ist schön, dass ihr euch so gut versteht und zusammenhaltet«, sagte Constantin. »Ich würde Britta jetzt gern mit nach Hause zu uns nehmen, damit meine Mutter sie kennenlernt.«
»Ich kann hier jetzt nicht weg, Constantin«, sagte Britta, »und es ist wohl doch besser, wenn du deine Mutter erst vorbereitest.«
»Das bräuchte ich nicht«, erklärte er, »aber ich verstehe, dass du mit deinem Bruder einiges überdenken musst.«
»Ich fahre jetzt mal zu Barbara rüber«, sagte Jörg. »Wir haben auch einiges zu bereden. Haben Sie einen weiten Heimweg, Constantin?«
»Von hier aus nicht so weit, wie von der City, glücklicherweise«, erwiderte Constantin lächelnd.
Er war noch eine Stunde geblieben, bis Jörg zurückkam. Den Kongress wollte auch Britta am nächsten Tag nicht mehr besuchen.
»Ich rufe dich an, und wenn du einverstanden bist, hole ich dich am späten Vormittag ab«, sagte Constantin. »Ich will dich nicht bedrängen, aber ich denke, es wäre besser, wenn du ein paar Tage völlige Ruhe haben würdest, und die hättest du bei uns.«
Am Morgen dieses Tages hatte es ihn in Brittas Leben noch nicht gegeben, und jetzt beherrschte er es. Sie wehrte sich auch gar nicht dagegen. Sie war glücklich und dankbar, dass dieser Mann an einem so denkwürdigen Tag in ihr Leben getreten war. Sie konnte sich als Frau fühlen, sich an ihn anlehnen. Es war so unendlich beglückend, dass er keine misstrauischen Fragen gestellt, keine Zweifel geäußert hatte, dass vom ersten Augenblick an dieser Gleichklang dagewesen war.
Und jetzt war sie Jörg dankbar, dass er keine kritische oder gar anzügliche Bemerkung machte. Aber Jörg hatte mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen zu tun.
»Falls es zu deiner Beruhigung beitragen kann, ich werde Barbara heiraten«, sagte er nach einem langen Schweigen. »Du hast das richtige Gespür gehabt. Sie ist eine Frau, mit der man ein ganzes Leben verbringen kann, nicht nur eine für sorglose Tage.«
»Und Constantin ist solch ein Mann«, sagte Britta. »Man kann es nicht gleich glauben, aber es gibt diese Zuneigung, und wenn man sofort den Beweis bekommt, dass es kein Spiel ist, keine Augenblicksstimmung, dass es tatsächlich Menschen gibt, die den Augenblick zu einem bleibenden Erlebnis machen können, kann man leicht den Widerwärtigkeiten trotzen. Was meinst du, warum Mona gekommen ist?«
»Ich denke, sie hat etwas zu fürchten, und das ist ihr bewusst geworden, als du so standhaft erklärt hast, dass du etwas unternehmen willst gegen diesen Vorwurf. Damit hat sie nicht gerechnet.«
»Und ich denke, dass sie schon länger Verbindung zu Horst gehabt haben muss. Sie hat mit unserer Abteilung überhaupt nichts zu tun. Es kann kein Zufall gewesen sein, dass sie Horst dort getroffen hat. Aber sie muss gewusst haben, wie schlecht es um ihn steht, Jörg. Ich kann jetzt wieder klar denken. Sie hat nicht gewusst, dass ich Urlaub genommen hatte für den Kongress.«
»Meinst du nicht, dass sie es von Billing erfahren haben könnte?«
»Er hat sich doch um unseren Dienstplan nicht gekümmert. Ich werde schon herausbringen, wie es sich tatsächlich verhalten hat, und ob Billing tatsächlich erkrankt ist.«
»Mir ist der Gedanke gekommen, dass sie etwas von ihm weiß, womit sie ihn unter Druck setzen kann. Wie sonst hätte sie ihn veranlassen können, sie am Sonntag aus der Behnisch-Klinik abzuholen?«
Britta versank in Nachdenken. »Es wird noch viel zu klären geben. Aber da fällt mir ein, dass Professor Korten Billing sehr gut kennt, und Korten ist auch Constantins Doktorvater.«
»An Zufälle glaube ich jetzt nicht mehr, Britta«, sagte Jörg gedankenverloren. »Da scheint doch der Herrgott die Hand im Spiel zu haben.«
»Das sagst du?« Britta sah ihren Bruder nachdenklich an.
»Es gibt eben Ereignisse, die man mit Logik nicht erklären kann. Warum tritt gerade jetzt eine Frau in mein Leben, die mir den Glauben an die Frau, an die Liebe zurückgibt? Warum triffst du ausgerechnet an diesem Tag einen Mann, dem du so bedingungslos vertraust?«
»Es gibt eben Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich mit dem Verstand nicht erklären lassen«, sagte Britta, »aber deshalb brauchen wir den Verstand nicht gleich ganz zu verlieren, Jörg.«
»Ich denke, dass jetzt Gefühle den Vorrang haben, Schwesterchen«, sagte er weich. »Ich wünsche dir schöne Träume.«
*
Mona Lohr saß bei den Mehlsens, die mehr nervös als erschüttert wirkten. Für Mona ging es jetzt darum, ihre Haut zu retten.
»Mir kann niemand einen Vorwurf machen«, sagte sie, »ich habe mich bemüht, Horst so diskret wie möglich zu helfen. Ich weiß wirklich nicht, wer ihm das Morphin beschafft hat. Britta war es nicht, sonst würde sie nicht so energisch auf eine Untersuchung bestehen. Bedauerlicherweise habe ich auch bei Jörg kein Verständnis für diese Situation gefunden. Ich konnte nicht damit rechnen, dass Horst das Sanatorium verlässt.«
»Sie haben gesagt, dass dieser Döbel ihn nicht aus den Augen lassen wird«, sagte Armin Mehlsen.
»Döbel hatte einen freien Tag«, erklärte Mona.
»Wenn eine Untersuchung stattfindet, werden Sie nicht ausgeklammert werden«, sagte Armin Mehlsen heiser.
In Monas Augen flammte es böse auf. »Wir hatten eine Abmachung getroffen«, stieß sie hervor. »Ich möchte Sie daran erinnern.«
Margret Mehlsen sprang auf. »Ich habe dir gesagt, dass du dich darauf nicht einlassen sollst, Armin«, schluchzte sie auf.
»Horst lebt nicht mehr, also wird es keine Klinik Mehlsen geben«, sagte Armin kalt, »und demzufolge auch keine Chefärztin Dr. Lohr.«
Hätten Jörg und Britta dies hören können, wäre ihnen manches klar geworden.
»Wir wollen das einmal klarstellen, wenn mir dafür der Zeitpunkt auch etwas makaber erscheint«, fuhr Armin Mehlsen fort. »Unsere Abmachung, Frau Dr. Lohr, setzte voraus, dass Horst die Approbation bekommt und natürlich auch den Doktortitel.«
»Die Doktorarbeit war fertig«, brauste Mona auf. »Ich habe mir die größte Mühe gegeben, ihn so weit zu bringen, dass sein Zustand ein glaubhaftes Auftreten ermöglichen würde. Er war ein kaputter Typ, ihm war nicht mehr zu helfen, und wenn Sie meine Meinung wissen wollen, für ihn und vor allem für Sie wäre es besser gewesen, er hätte mit seinem Wagen einen Unfall gebaut, wie neulich dieser junge Mallick.«
»Um noch andere ins Unglück zu stürzen«, fragte Margret Mehlsen.
»Sie sind mit dem Leben davongekommen, wie ich auch«, erwiderte Mona gefühllos.
Armin Mehlsen baute sich vor Mona auf. »Warum haben Sie ihn nicht zu einer solchen Autotour überredet?«, fragte er zornbebend. »Um Sie wäre es doch auch nicht schade gewesen.«
»Armin«, schrie Margret Mehlsen auf, »bitte, sag nicht so etwas!«
»Guter Gott, merkst du noch immer nicht, worauf sie hinaus will, Margret? Die Klinik will sie haben, erpressen will sie mich. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Die edle, hilfsbereite Frau Dr. Lohr hat uns den Floh ins Ohr gesetzt, dass unser Sohn nur Examensängste hat und Britta alles übertrieb. Wir hätten damals auf Britta hören sollen, dann wäre Horst vielleicht noch zu retten gewesen. Aber es war ihm nicht mehr zu helfen. Wir hatten unseren Sohn längst verloren. Was uns diese Dame hier einflüstern wollte, tat sie doch nur zu ihrem eigenen Profit.«
»Das lasse ich nicht auf mir sitzen«, warf Mona wütend ein. »Horst hat Halt bei mir gesucht und gefunden. Ich habe für ihn getan, was ich konnte.«
»Es winkte ja auch eine moderne Privatklinik«, sagte Armin Mehlsen bitter. »Britta war nicht so. Sie hat versucht, uns die Augen zu öffnen, aber wir wollten ihr nicht glauben. Wir waren so töricht, Ihnen zu glauben, aber das ist nun vorbei. Horst ist tot, und es ist egal, was geredet wird. Es wissen zu viele, wie es wirklich war, und ich kann es Britta nicht verdenken, wenn sie nicht schweigt. Es geht um ihr Leben, um ein wertvolles Leben, und auch um Jörg. Ich will nicht, dass noch mehr Menschen ruiniert werden. Ich gebe Ihnen zwanzigtausend Euro für die Doktorarbeit, und vielleicht können Sie die nochmals verkaufen, da keine Verwendung mehr dafür besteht. Und dann versuchen Sie auch, mit Ihrem Gewissen zurechtzukommen.«
»Horst hat mich geliebt«, sagte Mona. »Er wollte mich heiraten.«
Margret Mehlsen schüttelte den Kopf, Armin maß Mona mit einem verächtlichen Blick.
»Wir wissen genau, unter welchen Voraussetzungen eine Heirat zustande kommen sollte«, sagte er, »von Liebe war beiderseits keine Rede. Dass Ihnen Horsts Tod zu diesem Zeitpunkt nicht gelegen kam, ist mir klar.«
»Dann wird man mir wenigstens nicht zutrauen, dass er das Morphin von mir bekommen hat«, sagte Mona gereizt. »Nun, ich habe eine Untersuchung nicht zu fürchten. Ich wollte solche nur in Ihrem Interesse vermeiden. Aber Sie haben es ja schon gesagt, Horst war nicht zu retten, er war schon zu sehr abhängig, und außerdem hatte er ja genügend Geld, sich Drogen zu besorgen. Insofern sollten Sie in erster Linie die Schuld bei sich selbst suchen«, drehte sie nun den Spieß um.
»Das tue ich«, erwiderte Armin Mehlsen tonlos. »Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, die Klinik in eine Stiftung für Drogenabhängige zu geben, die noch eine Chance zur Heilung haben.«
»Wie großzügig«, höhnte Mona. »Wenn Sie meinen, sich damit Ihren Seelenheil erkaufen zu können, bitte. Mein Honorar überweisen Sie bitte auf dieses Konto.« Sie schrieb rasch die Nummer auf ihre Visitenkarte und legte diese auf den Tisch. Dann verließ sie grußlos den Raum.
Eine Weile herrschte zwischen dem Ehepaar Mehlsen tiefes Schweigen, dann sagte Margret leise: »Sollte ich nicht doch mit Britta sprechen, Armin?«
»Nein, auf ihr soll nichts sitzen bleiben. Der Lohr traue ich alles zu. Sie nimmt eine Niederlage nicht so einfach hin. Wir haben genug Fehler gemacht, Margret, damit müssen wir jetzt leben.«
»Ich werde es nie begreifen, wie es so weit kommen konnte«, flüsterte sie aufschluchzend.
»Wir müssen uns damit abfinden«, sagte er.
*
Für Miriam Thalers Eltern brachte dieser Tag Hoffnung, dass die Gefahr für das junge Leben des Mädchens gebannt war. Miriam war kurz bei Bewusstsein gewesen. Sie hatte ihre Eltern erkannt.
Sie hatte nach Lutz gefragt, aber sie hatten ihr nicht gesagt, dass er tot war.
»Er war zu schnell gefahren«, flüsterte Miriam. »Wir wollten noch ins Kino gehen.«
Sie konnte sich erinnern. Für Dr. Behnisch war es am wichtigsten, dass ihre Gehirnzellen arbeiteten. Es würde noch lange genug dauern, bis sie sich wieder bewegen konnte. Das wollte er den Eltern nicht verschweigen.
Käthe Schöler hatte mehr Grund zur Freude. Ihre Schwiegertochter konnte schon aus der Klinik entlassen werden und Joachim Schöler hatte eine so kräftige Konstitution und einen so starken Lebenswillen, dass alles lange nicht mehr so schlimm aussah, wie es anfangs schien.
Auch die Kinder hatten ihn schon kurz besuchen dürfen, und da er sie so wohlauf sah und gut aufgehoben wusste, brauchte er sich darum keine Sorgen mehr zu machen. Ein weiterer Trost war es ihm, dass seine Frau Anne so gut davongekommen war. Allesamt waren sie unendlich dankbar, dass sie bald wieder beisammen sein konnten.
Dr. Norden konnte sich freuen, dass dieser Familie größeres Leid erspart blieb. Käthe Schöler hatte ihn angerufen und ihn gebeten, doch öfter mal nach ihrer Schwiegertochter zu schauen, damit sich nicht doch noch Spätfolgen herausstellten. Das wollte er gern tun, und er konnte den Schölers auch sagen, dass die Versicherung des jungen Mallick für alle Kosten aufkommen würde und auch ein neues Auto bezahlt werden müsse.
Lutz Mallicks Vater war Versicherungskaufmann und war darauf bedacht gewesen, seinen Sohn bestens abzudecken. Jetzt machte er sich allerdings auch bittere Vorwürfe, Lutz die schwere Maschine geschenkt zu haben. Es war kein Trost für ihn, dass er, selbst Motorradfan, viele Jahre nicht den kleinsten Unfall gebaut hatte. Und immer noch verrannte er sich in den Gedanken, dass Miriam seinen Sohn zu diesem Tempo aufgestachelt hatte.
Zwei Elternpaare, die sich vorher so freundschaftlich gesinnt gewesen waren, standen sich nun feindselig gegenüber.
Von Horst Mehlsens Tod erfuhr Dr. Norden erst am nächsten Tag, als er mit Jörg Rosen wegen eines Patienten telefonierte, der wegen eines Bandscheibenvorfalls behandelt werden musste. Daniel Norden erkundigte sich dabei auch nach Barbaras Befinden und erfuhr nun Neuigkeiten, die ihn sehr überraschten, aber auch teilweise doch recht erfreulich waren, bis auf den Tod von Horst Mehlsen.
Armin Mehlsen war ein bekannter Mann, aber Daniel Norden hatte bisher noch nicht gewusst, dass Britta Rosen mit Horst Mehlsen verlobt gewesen war. Allerdings war es ihm bekannt, dass Armin Mehlsen für seinen Sohn bereits eine Privatklinik eingerichtet hatte, und darüber war in seinem Freundeskreis recht kritisch diskutiert worden, denn die erfahrenen Ärzte hielten gar nichts davon, wenn die Söhne betuchter Eltern mit geringer praktischer Erfahrung auf die Menschheit losgelassen wurden, selbst wenn sie von erfahrenen Ärzten die Hauptarbeit machen ließen und die Verantwortung auf sie abwälzen konnten. Nun sollte es aber noch manche andere Überraschungen geben.
*
Britta hatte am Morgen ein Schreiben an die Klinikverwaltung aufgesetzt, in dem sie um eine genaue Untersuchung des Todes von Horst Mehlsen bat. Höflich aber sehr bestimmt hatte sie es verfasst, und auch Constantin hatte nichts daran auszusetzen. Er hatte schon gegen neun Uhr angerufen, aber gleich nach elf Uhr kam er, wie er es versprochen hatte, um Britta abzuholen.
Gerda Steinsdorf wartete indessen schon voller Spannung auf Britta, die ihr Sohn als seine Traumfrau bezeichnet hatte. Es war doch recht gut, dass er sie vorbereitet hatte, denn was er als eine selbstverständliche und unumstößliche Tatsache betrachtete, war für sie doch ein Anlass gewesen, etwas aus der Fassung zu geraten, denn sie hatte Constantin schon als ewigen Junggesellen betrachtet, wenn dies auch nicht gerade mit Wohlgefallen. Sie war eine tüchtige Frau, die mit beiden Beinen im Leben stand, die ihren Mann im Beruf gestanden hatte, wenn man es so nennen wollte, denn sie war tatkräftiger als mancher männliche Kollege gewesen. Aber im Herzen war sie eine Frau und Mutter und wollte liebend gern auch Großmutter werden. Aber nie hatte sie Constantin für eine Frau erwärmen oder gar begeistern können. Ganz nett, war bisher das größte Kompliment gewesen, das er mal einem weiblichen Wesen gezollt hatte, aber auszusetzen hatte er dann immer gleich was gehabt.
Doch nun, gestern bis in die Nacht hinein, hatte er von Britta geschwärmt.
»Mich hat’s umgerissen, Muttchen, als ich sie sah«, hatte er gesagt. »Die oder keine, und so hab’ ich es auch gleich angepackt.«
Aber er hatte dann auch genauestens berichtet, was danach geschehen war, und wenngleich Gerda Steinsdorf auch weit entfernt war, Vorurteile zu hegen, machte sie sich doch Gedanken, ob Britta wirklich so ganz und gar dem Traumbild ihres Sohnes entsprechen würde.
Als Ärztin, als Betreuerin von psychisch Kranken, war sie hochgeehrt und anerkannt worden. Als beste Mutter der Welt hatte Constantin sie oft genug bezeichnet, und sie war sehr glücklich, dass eine so innige Beziehung zwischen ihnen auch dann hielt, als er erwachsen war.
Jetzt fröhnte sie ihrem Hobby, dem Kochen, und damit verkürzte sie die Wartezeit. Ein Firstclass-Restaurant hätte es nicht leicht gehabt, mit ihr zu konkurrieren, so köstliche Düfte zogen bereits durchs Haus, als Constantin und Britta kamen.
Aber dann ging Gerda Steinsdorf das Herz und die Augen ganz weit auf, und die Küche wurde zur Nebensache, als Britta vor ihr stand. Ihre schönen klaren Augen strahlten, als sie Britta spontan in die Arme schloss und ihre Stimme war voller Rührung, als sie sagte: »Dass ich diesen Tag noch erleben darf, dass mir mein Junge eine Tochter ins Haus bringt.«
Constantin rettete die Spargelcremesuppe vor dem Überkochen und sagte lachend: »Wenn Mama das Essen vergisst, kannst du dir doppelt was einbilden, Britta.«
Dann nahm er beide in die Arme. »Na, habe ich dir zu viel versprochen, Muttchen?«
»Versprochen hast du gar nichts, geschwärmt hat er«, sagte Gerda.
»Aber ich versteh’ es, dass es ihn umgerissen hat.«
»Umgerissen?«, fragte Britta stockend.
»So hat er es mir erzählt. Aber die lebendige Tatsache ist überzeugender als das Traumbild.«
Constantin küsste Britta auf die Stirn. »Und du kannst nicht sagen, dass ich übertrieben habe, Sternschnuppe.«
»Es ist wunderschön«, sagte Britta leise. »Tausend Dank für diesen Empfang.«
»Dann können wir ja erst mal essen«, sagte Constantin. »Mama hat sich bestimmt was ganz Besonderes einfallen lassen.«
»Es duftet himmlisch«, sagte Britta.
Und so schmeckte es dann auch. Da gab es nicht erst das Aufeinanderzutasten, nicht die geheimen Zweifel, ob man sich verstehen würde. Es war genauso, wie es zwischen ihr und Constantin gewesen war. Wärme und Herzlichkeit bestimmten die Atmosphäre, schlug die Brücke zu ernsten Gesprächen, die dann folgten. Gerda machte es Britta leicht, auch über das zu sprechen, was sie belastet hatte und noch nicht überstanden war.
Sie sprach über Mona Lohr, und da horchte Gerda auf. »Du hast sie nicht erwähnt, Constantin«, sagte sie.
»Das erschien mir nicht wichtig, Mama«, erwiderte er. »Kennst du sie etwa?«
»Nicht persönlich, aber ein Verwandter von ihr war an unserer Klinik als Krankenpfleger beschäftigt. Raimund Döbel. Ein verkrachter Medizinstudent. Sie hat ihn weggeholt an eine andere Klinik. Er hat damit angegeben, dass seine Cousine Chefärztin werden würde.«
»Irrst du dich da auch nicht, Mama?«, fragte Constantin skeptisch.
»Augenblick mal, ich werde kurz telefonieren. Ich will mich vergewissern.«
Während Gerda telefonierte, schwiegen Constantin und Britta. Hören konnten sie nichts, und es dauerte ziemlich lange, bis Gerda zurückkam.
»Ich habe mich nicht geirrt«, sagte sie ruhig, aber doch mit einem leisen Triumph. »Schwester Karla war mal ein paar Monate mit Döbel befreundet, aber das ging auseinander. Sie ist ein solides Mädchen, und sie bezeichnete ihn als einen Traumtänzer.«
»Mich bezeichnest du hoffentlich nicht als solchen, Mama«, warf Constantin ein.
»Nicht, seit ich Britta kenne, aber zur Sache, Kinder. Karla hat mir bestätigt, dass Mona Lohr die Cousine von Döbel ist. Und sie sollte Chefärztin in der Mehlsen-Klinik werden.«
Britta sprang auf. »Jetzt wird mir wirklich manches klar«, sagte sie erregt.
»Ganz ruhig, Kleines«, sagte Gerda. »Karla hat mir allerhand erzählt. Sie hat zwar gedacht, dass alles Angeberei von Döbel gewesen sei, aber für uns kommt das jetzt in ein anderes Licht. Die Klinik hat Armin Mehlsen für seinen Sohn gekauft und umbauen lassen.«
»Das ist mir wohlbekannt«, warf Britta ein. »Davon war schon vor einem Jahr die Rede. Die Klinik sollte unser Hochzeitsgeschenk sein, und Horsts Eltern waren überzeugt, dass ich da mitmachen würde. Sie haben ja keine Vorstellung, was dazugehört, eine Klinik zu leiten. Sie dachten, dass man mit Geld alles machen könne. Sie wollten ja auch nicht wahrhaben, dass ihr Sohn unfähig war, ein guter Arzt zu werden. Auf mich wollten sie nicht hören.«
»Aber bei Mona Lohr fanden sie Gehör«, sagte Gerda Steinsdorf. »Und sie wollte Döbel da anscheinend eine lukrative Stellung verschaffen. Karla hat das alles als Spinnerei von Döbel betrachtet, aber ich sehe das jetzt doch anders. Döbel hat nämlich zu Karla gesagt, dass Mona Horst Mehlsen heiraten würde, und er wollte sie überreden, auch an diese Klinik zu kommen.«
»Sie wollte Horst heiraten«, wiederholte Britta nachdenklich. »Sie hat gewusst, dass sie die Zügel in die Hände nehmen könnte. Mehlsen war ja bereit zu zahlen, um seinem Sohn Prestige zu verschaffen, aber welche Rolle mag da Billing gespielt haben?«
»Ich werde mal mit Korten reden«, sagte Constantin nach kurzem Überlegen.
»Ich möche wissen, was Döbel für eine Rolle gespielt hat, nachdem er die Klinik verließ«, sagte Gerda, »und außerdem bin ich heilfroh, dass Britta sich nicht kaufen ließ.«
Britta sah sie bittend an. »Kannst du mir diesen Ausrutscher verzeihen?«
»Mein liebes Kind, es gibt Schlimmeres«, erwiderte Gerda mütterlich. »Ein Umweg ins Glück ist besser, als ein gerader Weg ins Unglück.«
Ein längeres Schweigen trat ein. Constantin hatte seinen Arm um Brittas Schultern gelegt.
»Es gibt noch viel zu überdenken«, sagte Gerda dann in das Schweigen hinein. »Die Mehlsen-Klinik existiert bisher ja nur als Bau. Ich frage mich, was Döbel inzwischen gemacht hat. Karla weiß es nicht. Sie hat mir nur gesagt, dass er sie neulich anrief und bei ihr unterkriechen wollte. Aber sie ist standhaft und hat das abgelehnt. Immerhin haben wir eine Menge erfahren.«
»Und ich werde versuchen, mit Korten zu sprechen«, sagte Constantin. »Da die Damen sich verstehen, kann ich euch ja mal ein paar Minuten allein lassen.«
Es blieb nicht bei ein paar Minuten. Als Constantin zurückkam, war seine Miene ernst.
»Korten ist sehr interessiert, mit uns beiden zu sprechen, Britta. Er erwartet uns heute Abend.«
»Ja, da muss ich mich wohl bescheiden«, sagte Gerda bekümmert.
»Du darfst natürlich mitkommen, Mama«, sagte Constantin. »Korten hat es ausdrücklich gesagt, und er freut sich, dich einmal wiederzusehen.«
»Hat er gesagt?«, meinte Gerda hintergründig. »Siehst du, Britta, so sind die Männer, manchmal müssen sie daran erinnert werden, dass man noch existiert. Er war ein guter Freund meines lieben Mannes, aber wir haben uns schon Jahre nicht mehr gesehen.«
»Wie das so ist, wenn man beruflich zu sehr engagiert ist«, sagte Constantin. »Ich möchte hiermit gleich anmelden, dass bei uns das Privatleben nicht zu kurz kommen darf, Britta.«
»Darf ich dich erinnern, dass wir uns gestern erst kennenlernten, Constantin?«, fragte sie mit einem träumerischen Lächeln.
»Gestern erst? Ich kann mir nicht helfen, dann müssen wir uns schon mal in einem früheren Leben begegnet sein«, erwiderte er. »Und da waren wir bestimmt verheiratet. Diesen Zustand müssen wir schnellstens wiederherstellen.«
»Meinen Segen habt ihr«, sagte Gerda. »Und wenn ich übermorgen Großmutter werden würde, hätte ich auch nichts einzuwenden.«
»Als Mutter und Ärztin musst du eigentlich wissen, dass dies so schnell bedauerlicherweise nicht geht«, sagte Constantin lachend, »aber wenn’s nach mir ginge, hätte ich auch nichts einzuwenden.«
»Ich sage gar nichts mehr«, flüsterte Britta, »gegen euch beide komme ich nicht an.«
Sie wurde immer wieder aufgemuntert, konnte gar nicht ins Grübeln geraten. Dieser Mann war ein Geschenk des Himmels, und dass seine Mutter sie wie eine Tochter aufgenommen hatte, war so beglückend, dass Britta die Ältere innig umarmte.
»Es ist so schön für mich, dass es euch gibt«, sagte sie.
Kurz bevor sie aufbrachen, um zu Professor Korten zu fahren, läutete das Telefon. Nur zögernd griff Gerda danach. »Ihr seid nicht da«, sagte sie, »und ich weiß auch nicht, wo ihr seid.«
Doch diese Vorsichtsmaßnahme war nicht notwendig, denn sie wurde verlangt, und es war Schwester Karla, die so aufgeregt war, dass sich Gerda schwertat, etwas zu verstehen.
»Nun mal langsam, Karla«, sagte sie, aber dann lauschte sie angestrengt und geriet auch in Erregung.
»Das ist allerdings fatal«, sagte sie. »Beruhigen Sie sich. Ich komme morgen in die Klinik und rede mit dem Chef. Und wenn Sie da nicht mehr klarkommen, besorge ich Ihnen eine andere Stellung. Ich weiß, dass Sie damit nichts zu schaffen haben.«
Aber Gerdas sonst so freundliches Gesicht war düster, als sie den Hörer auflegte.
»Was ist los, Muttchen?«, fragte Constantin.
»Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass fünf Ampullen Morphium fehlen, und die arme Karla wurde scharf ins Verhör genommen.«
»Morphium«, rief Britta erregt aus, »und dieser Döbel, der Cousin von Mona, war doch an dieser Klinik Krankenpfleger.«
»Der Gedanke ist mir auch gleich gekommen«, sagte Gerda, »aber Döbel ist schon gute vier Wochen nicht mehr dort. Ich muss da erst noch nachhaken. Jetzt wollen wir mal hören, was Korten zur Klärung beitragen kann.«
Sie brauchten fast eine Stunde, bis sie Kortens Haus erreichten. Es war Urlaubszeit, und der Verkehrsstrom geriet oft ins Stocken.
»So teuer kann das Benzin gar nicht werden, dass die Leute nicht doch fahren«, brummte Constantin.
»Ich gönne den Leuten ja ihren Urlaub«, sagte Gerda, »wenn nur nicht so viel passieren würde. Da fahren sie frisch und fröhlich los, und dann …«, sie ächzte leise, »da vorn ist auch was passiert.«
Drei Autos waren nur noch Blechhaufen, aber der Unfall musste schon vor einiger Zeit passiert sein, denn sie wurden vorbeigewinkt, und als Constantin fragte, ob er helfen könne, wurde ihm erwidert, dass die Verletzten schon abtransportiert wären.
»Jetzt red bittschön nicht mehr von Unfällen, Muttchen«, sagte Constantin. »Deine Vorahnungen haben mich schon manches Mal erschreckt.«
»Sie sind ja nicht immer schlecht«, sagte Gerda. »Jedenfalls habe ich dir zugeredet, den Kongress zu besuchen.« Sie nickte Britta lächelnd zu. »Sonst wäre er nicht gefahren.«
»Siehst du, Britta, so ist unsere Mama, jetzt will sie den Orden, dass ich dich gefunden habe«, scherzte Constantin.
»Ich will keinen Orden, ich will Enkelkinder haben«, sagte Gerda.
»Britta hat sich noch gar nicht geäußert, ob sie auch welche haben will, und es wäre doch ein bisschen indiskret gewesen, ihr so bald solche Fragen zu stellen«, meinte Constantin mit einem Lausbubenlächeln.
»Natürlich will ich Kinder haben«, erklärte Britta freimütig.
Constantin schenkte ihr rasch ein zärtliches Lächeln. »Gut, auch diesbezüglich sind wir einer Meinung«, sagte er. Nun waren sie am Ziel, und Professor Korten kam ihnen schon entgegen.
Zuerst begrüßte er Gerda mit Handküssen. »Schandbar, dass erst so ein Anlass ein Wiedersehen bringt«, sagte er bekümmert. »Die Jahre laufen uns davon.«
»Aber zur Ruhe will sich keiner setzen«, meinte sie mit charmanter Anzüglichkeit.
»Und wie haben sich meine beiden Lieblingsschüler kennengelernt?«, fragte er dann mit einem tiefen Lächeln.
»Gestern auf dem Kongress«, erwiderte Constantin.
»Gestern erst? Da hat es aber schnell gefunkt, wie mir scheint«, meinte Robert Korten.
»Wird nicht bestritten«, sagte Constantin.
»Und noch schöner ist sie geworden, die kleine Britta«, sagte der Professor väterlich. »Ich habe gehört, dass Sie in die Klinik gerufen wurden und mich erkundigt, Britta. Ich hatte keine Ahnung, dass Ihnen Constantin schon zur Seite stand.«
»Wir hatten gerade festgestellt, dass wir unser Wissen von demselben großartigen Lehrer profitiert haben, als wir auch schon zur ersten Bewährungsprobe gefordert wurden«, sagte Constantin.
»Was nicht mal übel zu sein braucht, wenn man sie so gut besteht«, stellte Professor Korten fest. »Aber bei einem guten Glas Wein lässt es sich besser reden.«
»Ich hoffe, du kannst uns ein bisschen weiterhelfen, Robert«, sagte Gerda.
»Was Billing betrifft, schon, jedoch mit der Bitte, es nicht als aufgegriffenen Klatsch zu betrachten, und mir meine Abneigung gegen ihn zu verzeihen. Es ist an der Zeit, dass ihm seine dämliche Überheblichkeit endlich mal vergeht. Haltet es nicht für Feigheit, wenn ich bisher nichts unternommen habe, aber es wäre vergebliches Bemühen gewesen. Ihr habt doch eine Ahnung, wie das so läuft. Es wird unter den Tisch gekehrt, was dem Berufsstand abträglich sein könnte. Wenn einer aufmüpfig wird, stopft man ihm den Mund, und ich bin einfach schon zu alt, um mich über die Methoden so mancher Herren aufzuregen. Ich gehe in zwei Monaten in Pension, und dann soll mir wirklich alles egal sein, und wenn sie Billing noch immer decken, ist ihnen auch nicht zu helfen.«
Er hatte seinem Herzen Luft gemacht. Dann aber konnten seine gespannten Zuhörer vernehmen, wie er die jetzige Situation einschätzte.
»Diese Affäre mit Mona Lohr war nur eine von vielen. Man kann Billing nicht absprechen, dass er ein Frauentyp ist. Dass er viel Mist gebaut hat, steht auf einem anderen Blatt. Wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Apropos Richter. Durch diesen Fall habe ich ihn aufs Korn genommen. Der Staranwalt Dr. Benno Richter, Gott hab ihn selig, war ja mein Nachbar.
Als er vor zwei Jahren einen schweren Kreislaufkollaps erlitt, war ich gerade mal im Urlaub.«
»Du hast tatsächlich mal Urlaub gemacht?«, fragte Gerda.
»So einen halben. Ich folgte einer Einladung von amerikanischen Kollegen. Es war eine interessante Zeit. Als ich zurückkam, war Richter Patient von Billing auf der Privatstation, und seine sehr attraktive dritte Ehefrau, ich meine Richters Frau, war recht kurz angebunden, als ich mich nach dem Befinden ihres Mannes erkundigte. Als mir dann hintertragen wurde, dass die attraktive Elena Richter öfter sehr privat mit Billing beisammen wäre, nahm ich mir die Freiheit, Richter zu besuchen. Ich fand einen Mann vor, der physisch und psychisch am Ende war, mir aber einiges erzählte, was mich sehr nachdenklich stimmte. Er wollte ein neues Testament machen, aber das würde von Billing und Elena verhindert. Ich sorgte dafür, dass der Notar, den Richter wünschte, ihn aufsuchte. Es wurde ein neues Testament aufgesetzt, aber bevor Richter es unterzeichnen konnte, erschien Elena Richter. In der Nacht darauf verstarb Richter an plötzlichem Herzversagen. Mona Lohr hatte Nachtdienst, aber ganz gegen seine Gewohnheit war Billing bis nach zehn Uhr in der Klinik geblieben. Er rechtfertigte das später damit, dass Richters Zustand so desolat gewesen sei, er aber dann doch eingeschlafen wäre.«
»Ich habe nur gelesen, dass Richter gestorben ist«, warf Gerda ein. »Was war mit dem Testament?«
»Nichts«, erwiderte Professor Korten. »Das vorher gemachte wurde in Kraft gesetzt. Es wurde allerdings auch zu einer Enttäuschung für die schöne Elena, denn zwei Drittel des Vermögens fielen an die drei Kinder aus den ersten beiden Ehen. Immerhin brauchte Elena nicht zu darben, und sie entschwand. Und dann schienen sich Billing und Mona Lohr plötzlich blendend zu verstehen.«
»Und es gab keinen Jörg Rosen mehr für Mona«, sagte Britta.
Robert Kortens Augenbrauen schoben sich zusammen. »War das ernst?«, fragte er.
»Von Jörgs Sicht wohl«, erwiderte sie. »Aber in Billing sah sie wohl die größere Chance.«
»Bis es wieder mal eine reiche, junge und attraktive Witwe gab«, sagte Robert Korten spöttisch. »Manch einer nennt ihn schon den Witwentröster. Nun, jetzt ist er zu einem ernsten Fall geworden.«
»Er ist also tatsächlich krank?«, fragte Britta hastig.
»Angeblich soll es ein Kreislaufzusammenbruch gewesen sein, aber ich habe erfahren, dass er in ein Nervensanatorium gebracht wurde. Man ist sehr diskret und schweigsam. Schließlich handelt es sich um Professor Billing. Mit dem Fall Mehlsen hat er jedenfalls nichts zu tun. Da war er schon weg vom Fenster.«
Nun aber erfuhr auch er manches, und es dauerte ziemlich lange, bis er es verdaut hatte.
»Dann könnte es doch der Wahrheit entsprechen, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und der Lohr gekommen ist. Ich bin da vorsichtig, wenn so was gemunkelt wird. Die Lohr ist nicht beliebt. Ob das mit der Privatklinik stimmt, wage ich auch zu bezweifeln.«
»Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was die Untersuchung über Horst Mehlsens Tod ergeben wird«, sagte Gerda. »Und ich werde morgen meine alte Klinik aufsuchen und mich um Karla kümmern.«
»Und ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen, und Horsts Eltern aufsuchen«, sagte Britta.
»Aber nicht ohne mich«, erklärte Constantin sofort.
»Diplomatisch wäre das nicht, meinte Gerda. »Lasst ihn erst mal begraben sein.«
Beim Abschied von Professor Korten sagte dieser, dass sie sich hoffentlich bald wiedersehen würden.
»Spätestens zur Hochzeit«, meinte Gerda, »und auf die brauchen wir wohl nicht lange zu warten.«
Dann brachten sie Britta heim, und so lernte Jörg auch gleich Brittas Schwiegermutter kennen. Ein Stündchen wurde auch hier noch geredet, aber nun war es fast Mitternacht, und da die beiden Ärzte anderntags wieder fit sein mussten in der Praxis, wollten sie das nächste Beisammensein auf das Wochenende verschieben. Gerda gab der Hoffnung Ausdruck, dass bis dahin schon mehr Klarheit herrschen würde.
»Wenn etwas ist, ruf mich an«, sagte Constantin zu Britta, »ganz gleich, zu welcher Stunde. Wart erst mal ab, was die anderen unternehmen.«
Aber dazu war Britta nicht bereit, und nun erfuhr sie auch noch etwas von Jörg, was sie sehr nachdenklich stimmte.
»Ich wollte es vorhin nicht sagen«, erklärte er. »Armin Mehlsen hat angerufen. Er möchte dich dringend sprechen. Er ist auch bereit, dich hier aufzusuchen, falls du nicht zu ihnen kommen willst.«
Brittas Augen weiteten sich staunend. »Dazu ist er bereit?«
»Er scheint sehr deprimiert zu sein. Er hat gesagt, dass er nicht als Feind käme.«
»Dann soll er nur kommen«, meinte Britta. »Ich bin sehr interessiert, einige Auskünfte zu kommen.«
»Welche?«
»Darüber reden wir, wenn ich mit ihm gesprochen habe, Jörg.«
Der nächste Tag sollte noch manche Überraschungen bringen, auch für Dr. Norden, denn bei ihm erschien schon am Morgen Raimund Döbel in der Praxis. Für Dr. Norden war er kein Unbekannter, obgleich er nicht wusste, welche Rolle er in dem Geschehen um Horst Mehlsen und Mona Lohr spielte. Dr. Norden wusste auch nichts von dieser Verwandtschaft. Er hatte Raimund Döbel schon zwei Jahre nicht mehr gesehen. Damals war Döbel noch Medizinstudent gewesen, und Dr. Norden hatte ihn kennengelernt, als er in den Semesterferien eine Jugendgruppe betreute. Da erkrankten die meisten an einer Lebensmittelvergiftung, hervorgerufen durch einen Kartoffelsalat. Döbel hatte es ziemlich schlimm erwischt, und die Laboruntersuchungen hatten dann auch noch ergeben, dass eine Anämie feststellbar war, die Dr. Norden bedenklich stimmte.
Als Raimund Döbel jetzt vor ihm saß, hatte Dr. Norden den Eindruck, dass er schwerkrank sei. Seine Gesichtsfarbe war fahl, fast grau zu nennen, seine Augen glanzlos und tief umschattet, und ständig lief ein nervöses Zucken über sein Gesicht.
Dr. Norden war völlig ahnungslos, was Döbel in den vergangenen zwei Jahren gemacht hatte. Als er ihn arglos und ganz beiläufig fragte, ob er sein Examen bestanden hätte, begann der junge Mann, den man gut doppelt so alt schätzen konnte, als er war, zu zittern.
Bevor Dr. Norden noch weitere Fragen stellen konnte, brach Döbel zusammen.
Noch mehr erschrocken war Dr. Norden dann, als er am Körper des Mannes vielerlei Einstiche feststellen konnte. Vor allem aber am linken Arm. Dr. Norden brauchte nicht lange zu überlegen. Hier in seiner Praxis konnte er diesem Mann nicht mehr helfen, und so geschah es, dass Raimund Döbel wieder in dieser Klinik landete, die er vor einigen Wochen verlassen hatte, ohne dass Dr. Norden auch dies wusste.
Doch so geschah es auch, dass Dr. Gerda Steinsdorf dies sehr rasch erfuhr, denn sie befand sich zu diesem Zeitpunkt schon in der Klinik.
Fünfzehn Jahre war sie hier als Chefärztin tätig gewesen und hatte gute Erfolge erzielt, aber sie hatte auch viele Enttäuschungen hinnehmen müssen. Doch nach dem Motto, dass uns stärker macht, was uns nicht umbringt, war sie stets positiv zum Leben eingestellt geblieben, dankbar dafür, dass sie einen so wohlgeratenen Sohn hatte, der ihr keine Sorgen bereitete.
Sie hatte Constantin jede Freiheit gelassen, die er zur Selbstverwirklichung brauchte, aber sie hatte offen und ernsthaft mit ihm über alle Probleme gesprochen, die das Leben mit sich bringen konnte, und er hatte gewusst, dass er mit ihr über alles sprechen konnte.
Und wie oft hatte sie in dieser Klinik mit jungen Menschen zu tun, die daran gescheitert waren, weil sie mit niemanden ernsthaft sprechen konnten, weil sie unverstanden blieben in ihren Nöten und Ängsten und deshalb in die falsche Gesellschaft gerieten, in der sie sich verstanden fühlten.
Gerda Steinsdorf hatte auch etwas Verständnis für Raimund Döbel gehabt, hatte in ihm nicht nur den verkrachten Medizinstudenten gesehen.
Darüber hatte sie bereits mit dem jetzigen Chefarzt Dr. Rust gesprochen.
Dr. Rust war schrecklich nervös. Er war noch nicht so lange an der Klinik, um sich ungeteilten Wohlwollens zu erfreuen, obgleich er sich die erdenklichste Mühe gab. Dass bereits in der kurzen Zeit, in der er diesen Posten innehatte, diese Morphiumampullen verschwunden waren, machte ihm schwer zu schaffen, denn bei seiner Amtsübernahme war alles kontrolliert und in Ordnung befunden worden.
»Ich bin nicht gekommen, um dies nochmals zu klären«, hatte Gerda gesagt, »sondern um Schwester Karla beizustehen. Wenn der Verdacht jetzt auf Döbel fällt, was noch nicht erwiesen ist, kann man ihr nicht zum Vorwurf machen, dass sie mit ihm befreundet war.«
Jedenfalls war nicht nachzuweisen, wann die Ampullen verschwunden waren, da schon lange keine mehr gebraucht worden war. Man griff zu anderen Medikamenten, wenn der Zustand eines Patienten solche erforderlich machte.
In die Unterredung mit Dr. Rust hinein kam die Nachricht, dass Raimund Döbel gebracht worden war. Gerda Steinsdorf hielt den Atem an, Schwester Karla war wie gelähmt und Dr. Rust fragte Dr. Norden erregt, warum man den Patienten gerade hierher bringe.
»Weil ich annehme, dass man hier auf solche Patienten eingerichtet ist«, erwiderte Dr. Norden ruhig. »Ich dagegen nicht. Ich bin überzeugt, dass der Patient unter Entzugserscheinungen leidet. Er befindet sich in einem kritischen Stadium.«
»Er ist süchtig?«, mischte sich Gerda erregt ein. »Sind Sie sicher?«
»Sie brauchen ihn nur zu untersuchen«, erklärte Dr. Norden.
»Er ist Ihnen bekannt?«, fragte Gerda, während sich Dr. Rust nun schon um Döbel bemühte.
»Vor Jahren war er mal mein Patient«, erwiderte Dr. Norden. »Aber seither habe ich ihn nicht mehr gesehen.«
»Warum kam er zu Ihnen?«, fragte Gerda.
»Das weiß ich nicht. Er war in desolatem Zustand, aber bevor ich ihn befragen konnte, brach er zusammen, und da stellte ich fest, dass er ein Drogenabhängiger ist.«
»Er war an dieser Klinik Krankenpfleger«, sagte Gerda geistesabwesend.
»Oh, das wusste ich nicht. Als ich ihn kennenlernte, war er Medizinstudent. Wieso Krankenpfleger?«
»Weil er das Examen nicht bestanden hat. Familiäre Schwierigkeiten brachten ihn wohl in finanzielle Bedrängnis, sodass er das Studium abbrechen musste. Ich bin nicht mehr Chefärztin, Herr Kollege. Ich bin in Pension, aber ich bin heute hier …« Sie unterbrach sich. »Das möchte ich jetzt doch nicht sagen. Darf ich fragen, weswegen er seinerzeit Ihr Patient war?«
»Wegen einer Lebensmittelvergiftung, aber da war er mit Sicherheit noch nicht süchtig. Als er heute kam, fragte ich ihn arglos, ob er das Examen bestanden hätte. Daraufhin kam dann der Zusammenbruch. Der Fall interessiert mich sehr.«
»Mich auch, und auch noch in einem anderen Zusammenhang.«
Eine Schwester erschien. »Döbel ist zu sich gekommen, Frau Doktor. Er will Sie sprechen. Er hat nach Ihnen gefragt.«
Gerda sah Dr. Norden an. »Wir werden uns noch sprechen«, sagte sie.
Dr. Norden konnte in seine Praxis zurückkehren, und er konnte wieder einmal über die Geduld seiner Patienten staunen. Nur zwei waren gegangen aus beruflichen Gründen, aber Loni hatte ihnen einen Termin für den späten Nachmittag gegeben. So schnell suchte sich niemand einen anderen Arzt, wenn er mal mit Dr. Norden vertraut war. Jeder wusste, dass nur ein ganz dringender Fall ihn von seinen Patienten wegrufen konnte. Und jeder wusste auch, dass er sich für alle Zeit nahm.
Dr. Rust hatte indessen seinen Platz am Bett von Raimund Döbel seiner Vorgängerin überlassen. Mit gemischten Gefühlen hatte er es getan, da Döbel, nicht ganz gegenwärtig, es nicht zu begreifen schien, dass Gerda Steinsdorf hier nicht mehr das Sagen hatte. Andererseits war Dr. Rust jetzt ganz froh, dass sie ihm diese nicht leichte Aufnahme abnehmen konnte.
»Ich bin ja da, Döbel«, sagte sie, »was ist denn los mit Ihnen? Raus mit der Sprache. Sie wissen doch, dass Sie mit mir reden können.«
»Karla hat damit nichts zu tun«, murmelte er. »Sie hat mir das Zeug nicht gegeben. Ich habe die Ampullen genommen. Ich brauchte Geld. Mit mir ist es bald aus. Es ist Leukämie, so viel verstehe ich, Frau Doktor.« Seine Augen glänzten fiebrig. »Mona hilft mir nicht mehr«, murmelte er. »Ich weiß nicht weiter. Warum bin ich hier? Hier sollte es doch niemand erfahren.«
»Dr. Norden wusste nicht, dass Sie hier tätig waren«, sagte Gerda heiser.
»Er hat mir damals geholfen, ich dachte, dass er mir jetzt auch helfen würde, aber es ist mir wohl nicht mehr zu helfen.«
»Haben Sie Mehlsen die Ampullen verkauft?«, fragte sie drängend, da sie spürte, dass sein Bewusstsein schon wieder schwand.
»Mehlsen, das wissen Sie?«, murmelte er. »Mona hat mir die Ampullen weggenommen. Aber mit der Stellung ist es nun auch nichts.« Er atmete schwer. »Alles aus, alles …«
Mehr konnte Gerda von ihm nicht erfahren. Ihr Gesicht war sehr ernst, als sie mit Dr. Rust sprach. »Ich fürchte, dass ihm nicht mehr zu helfen ist. Er sagt, dass er Leukämie hat. Er hat mir gesagt, dass er die Ampullen genommen hat, und dass Karla damit nichts zu tun hat. Vor Gericht wird man ihn nicht mehr stellen können. Sie müssen jetzt entscheiden, was mit ihm zu geschehen hat.«
Er sah sie an. »Was würden Sie tun?«, fragte er.
»Ich würde ihn als Patienten betrachten, der keine Chance mehr hat«, erwiderte sie. »Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit.«
*
Für Britta war es auch nicht einfach gewesen, mit Armin Mehlsen zu sprechen. Ein gebrochener Mann war zu ihr gekommen. Er versuchte nicht, sich zu rechtfertigen, er überhäufte sich mit Selbstanklagen, und er wollte reinen Tisch machen.
So erfuhr Britta von dem Abkommen mit Mona. »Wir haben dir unrecht getan, Britta und dann haben wir ihren scheinheiligen Worten geglaubt«, hatte er das Bekenntnis begonnen. »Damals war es für mich eine Bestätigung unserer Gedanken, dass dein persönlicher Ehrgeiz Horst zur Verzweiflung gebracht hätte. Sie sagte es auch, und sie wickelte mich ein, dass sie Horst aus dieser Resignation heraushelfen könne, da er sie als eine ehrliche Freundin betrachte. Sie sagte, dass sie von Jörg genauso enttäuscht worden sei, wie Horst von dir. Was sie sonst noch alles sagte, will ich gar nicht wiedergeben. Sie hat es jedenfalls sehr raffiniert angefangen. Sie sprach von einer Gruppentherapie, die ihr Cousin leiten würde.«
»Raimund Döbel«, warf Britta nachdenklich ein.
»Du kennst ihn, Britta?«, fragte Armin Mehlsen erstaunt.
»Nein, ich habe von ihm gehört. Er ist ein durchgefallener Medizinstudent und war als Krankenpfleger in einer Klinik für Drogenabhängige und psychisch Kranke tätig.«
»Das wusste ich nicht. O Gott, es wird immer schlimmer«, stöhnte Armin Mehlsen. »Was kommt jetzt noch auf uns zu?«
»Horst ist tot«, sagte Britta tonlos. »Ihr habt versucht, euren Sohn zu retten, mit allen Mitteln. Ihr habt keine Kosten und Mühen gescheut.«
»Hätten wir doch nur auf dich gehört und gleich etwas getan.«
»Ich glaube jetzt, dass es da schon zu spät war. Er wollte sich nicht helfen lassen, auch nicht von mir. Er war so überzeugt, dass alles richtig war, was er tat. Ich sollte mich seinem Leben anpassen, seiner Lebensanschauung, aber das konnte ich nicht.«
»Du hast ihn nicht geliebt«, sagte Armin Mehlsen leise.
»Wenn ich ihn geliebt hätte, wäre ich daran mit zugrunde gegangen«, erwiderte Britta. »Aber ich habe alles versucht, um ihm und auch euch die Augen zu öffnen. Es war vergeblich. Und ihr müsst verstehen, dass ich mir für dieses Ende keine Verantwortung zuschieben lasse.«
»Das wollen wir nicht, Britta. Ich bin doch hergekommen, um dir zu sagen, dass wir selbst die Untersuchung fordern werden. Die Klinik soll ein Therapiezentrum für Suchtgefährdete werden.«
Sie sah ihn staunend an. »Das ist ein guter Entschluss«, sagte sie gedankenvoll.
»Vielleicht kann doch noch manchen geholfen werden. Dass Horst so enden musste, werde ich nie begreifen, und ich werde es mir nie verzeihen, dass ich Mona mehr vertraute, als dir.«
»Es gibt Dinge, die man eben nicht glauben will«, sagte Britta nachdenklich. »Man sucht Entschuldigungen oder man weigert sich einfach, den Tatsachen ins Auge zu blicken. Es tut mir leid für euch, sehr leid.«
»Unser Sohn tut so was nicht, hat Margret gesagt. Er ist doch so intelligent, und er weiß doch, wie schlimm die Folgen sein können.«
»Das will keiner wahrhaben, solange sie überzeugt sind, die Kontrolle über sich zu behalten. Ich habe mich sehr damit befasst. Ich habe versucht, ernsthaft mit Horst zu sprechen. Er hat mich ausgelacht. Er war überzeugt, nicht abhängig zu werden. Er wollte es beweisen. Aber jetzt ist nichts mehr zu ändern.«
»Etwas war noch zu ändern. Mona Lohr wird davon nicht profitieren, und ich werde mich auch nicht scheuen, offenzulegen, welche Rolle sie gespielt hat.«
»Sie wird jeden Vorwurf widerlegen«, sagte Britta. Bevor sie noch etwas sagen konnte, läutete das Telefon, und nun erfuhr Britta von Gerda, dass Döbel von Dr. Norden in die Klinik gebracht worden war.
Britta stockte der Atem. »Herr Mehlsen ist gerade bei mir, das wird ihn interessieren.«
»Was will er denn?«, fragte nun Gerda erregt.
»Es ist alles okay, kein Grund zur Besorgnis. Wir sprechen später darüber.«
Aber für Armin Mehlsen schien das keine schlechte Nachricht zu sein.
»So wird die Lohr nicht jeden Vorwurf widerlegen können«, sagte er hart.
*
Constantin hatte in der Sprechstunde so viel zu tun, dass er nicht mal ein paar Minuten Zeit erübrigen konnte, um mit seiner Mutter zu sprechen.
Auch Dr. Norden konnte an diesem Tag keine Mittagspause einlegen. Fee war allerdings auch sehr mit den Zwillingen beschäftigt, die sehr unruhig waren, weil sie Zähne bekamen. Da sie sonst selten weinten, regten sich auch ihre drei Geschwister auf.
»Sie werden doch nicht krank werden, Mami«, jammerte Anneka.
»Ihr habt auch geweint, als ihr Zähne bekommen habt«, erklärte Fee beruhigend. »Das geht auch vorbei.«
»Aber es dauert ziemlich lange«, meinte Danny.
»Und dann fallen sie wieder raus«, brummte Felix, der zur Zeit gerade mit ein paar Zahnlücken leben musste. »Blöde Einrichtung.«
»Lenni sagt, dass die dritten Zähne auch zu schaffen machen«, meinte Danny. »Sie muss heute wieder zum Zahnarzt.«
»Und du kannst gleich mitgehen und nachschauen lassen, Danny«, sagte Fee.
»Muss das sein, Mami?«, maulte er.
»Ja, es muss sein. Sei froh, wenn du mal keine Spange kriegen musst.«
»Das tät mir gerade noch fehlen«, meinte Danny, »wo ich doch so gern Flöte spielen möchte.«
»Warum denn gerade Flöte?«, fragte Fee nicht gerade begeistert.
»Das mögen Babys«, stellte Danny fest. »Seit Ulli Flöte spielt, ist der ihr Baby gleich immer ruhig.«
»Vielleicht sollte Ulli erst mal zu uns kommen und Flöte spielen, damit wir sehen, wie unsere Zwillinge reagieren«, meinte Fee skeptisch. »Manche Babys mögen Flötentöne gar nicht.«
»Na ja, wir können es mal probieren«, willigte Danny ein. »Für nichts und wieder nichts mag ich mich auch nicht anstrengen.«
»Klavier ist viel schöner«, sagte Felix. »Und das hören Jan und Desi auch gern.«
Christian und Désirée, die Namen der Zwillinge waren schnell gekürzt worden, und dass Felix schon recht hübsch Klavier spielte, hätte er von Onkel David geerbt, meinte Danny. Es war sinnlos, ihm klarzumachen, dass David Delorme, der mit Katja, der Tochter aus Anne Cornelius erster Ehe verheiratet war, dazu ein berühmter Pianist und Dirigent, kein Blutsverwandter sei. David gehörte zur Familie, und Felix wollte auch mal so berühmt werden wie er. Er war allerdings auch mehr musisch begabt, und seiner Meinung nach reichte es wirklich, wenn Danny mal ein Arzt werden würde. Nur Ärzte in der Familie bräuchte es ja nicht zu geben.
Das war auch Fee Nordens Meinung. Und sie hatte längst festgestellt, dass ihre Kinder Individualisten waren und jedes schon seine eigene kleine Persönlichkeit entwickelte. Ihr konnte das nur recht sein, da sie sich trotzdem, oder auch vielleicht gerade deshalb so gut verstanden.
Danny ging mit Lenni, die nun schon Jahre der gute Hausgeist bei den Nordens war, zum Zahnarzt. Felix ging zur Klavierstunde, und Fee hatte die Zwillinge in den Wagen gelegt, und den durfte Anneka durch den Garten schieben. Das gefiel den Kleinen, und bald waren sie eingeschlafen.
»Siehst du, Mami, wir brauchen keine Flöte und kein Klavier«, sagte Anneka strahlend. »Unsere lieben Schätzchen haben mich halt am liebsten.«
Fee machte es besonders glücklich, dass gerade Anneka, die doch recht lange das Nesthockerle gewesen war, so zärtlich an den Zwillingen hing. Es war ihre größte Sorge gewesen, dass dieses sensible Kind sich zurückgesetzt gefühlt haben könnte. Das Gegenteil war der Fall. Während Danny und Felix den doppelten Nachwuchs doch mit Skepsis betrachtet hatten, war Anneka voll behutsamer Zärtlichkeit, und ihr höchstes Glück war es, wenn sie die Babys in die Arme nehmen durfte.
Sie waren eine glückliche Familie. Bei ihnen stimmte alles, und so ernst Daniel Norden seinen Beruf auch nahm, seine Frau und seine Kinder brauchten sich nicht zu beklagen.
Als Daniel abends heimkam, hörte er sich geduldig an, was seine Kinder zu berichten hatten. Danny erzählte voller Stolz, dass der Zahnarzt mit ihm sehr zufrieden gewesen sei, dass die arme Lenni aber wieder mal einen Zahn weniger hätte.
»Froh bin ich, dass ich den Quälgeist los bin«, sagte Lenni, als Daniel sich nach ihrem Befinden erkundigte.
»Uns Quälgeister wirst du aber nicht los«, sagte Danny.
»Ihr seid doch keine Quälgeister«, meinte Lenni weich. »Was würde ich denn ohne euch machen. Für Zähne gibt es Ersatz, für euch nicht.«
Und sie enteilte schon wieder in die Küche.
»Gell, Mami, wenn wir unsere liebe Lenni nicht hätten, würde es dir ganz schön nass neingehen«, meinte Felix. »Die Wally von Schneiders wird so ein Trampel sein. Die hat heute eine ganz kostbare Vase zerschmissen.«
»So was lässt man auch nicht rumstehen«, sagte Danny. »Bekomme ich jetzt eine Flöte, wenn meine Zähne in Ordnung sind?«
»Himmel, muss es gerade Flöte sein«, seufzte Daniel.
»Oder Trompete«, meinte Danny.
»Das wäre ja noch schlimmer«, ächzte Daniel.
»Du brauchst nicht zu flöten«, sagte Anneka, »unsere Kleinen schlafen auch, wenn man sie ein bisschen herumfährt.«
»Und wie wir wissen, gibt es sehr hübsche Schlafliedchen«, warf Daniel ein.
»Aber wenn Danny unbedingt Flöte spielen will, soll er es auch«, sagte Fee. »Bloß üben muss er dann im Hobbyraum.«
»Da tanzen dann die Mäuse«, sagte Daniel neckend.
»Mei, kommen da Mäuse?«, fragte Felix entsetzt.
»Ihr kennt doch die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln, der hat sogar Ratten mit der Flöte gelockt«, sagte Daniel schlau.
»Und Kinder hat er fortgelockt«, sagte Anneka ängstlich.
»Ich kann solche Geschichten überhaupt nicht leiden«, erklärte Danny. »Dann spiele ich eben Gitarre.«
»Spiel lieber Tennis im Sommer«, riet Daniel seinem Sohn. »Im Winter reden wir dann noch mal darüber, für welches Instrument du dich entscheidest.«
»Ist auch eine Idee«, gab Danny zu. »Ist ja auch blöd, wenn man bei der Hitze üben muss.«
»Du hast wirklich eine ganz besondere Art, Unheil von uns abzuwenden«, scherzte Fee, als die Kinder im Bett waren.
»Wieso Unheil?«
»Flötentöne können Kopfschmerzen verursachen«, sagte sie mit leisem Lachen. »Es war ein göttlicher Einfall, Danny ans Tennis zu erinnern.«
»Geflötet hätte er nicht lange, ich kenne unseren Sohn. Er muss alles ausprobieren, aber so lange das keine krankhaften Formen annimmt, wollen wir zufrieden sein.«
»Worauf spielst du an?«, fragte Fee.
»Auf Horst Mehlsen.« Nun konnte er loswerden, was ihn beschäftigte, seit er sich auch mit Raimund Döbel befassen musste.
»Guter Gott, das zieht ja weite Kreise«, sagte Fee besorgt, »und eine ganze Anzahl Ärzte können da ins Gerede kommen.«
»Eine wird sich nicht herauslavieren können, und der schadet es gar nichts, dass sie eins auf den Deckel bekommen wird«, erklärte Daniel
»Wen meinst du?«
»Mona Lohr.«
*
Mona fühlte sich sicher. Sie machte ihren Dienst in der Klinik wie sonst. Von Billing brauchte sie nichts zu fürchten. Ihr war sein Zustand auch völlig gleichgültig. Wer ihr nicht nützlich sein konnte, wurde abgeschrieben. Es wurmte sie nur ungemein, dass Jörg ihr solche Abfuhr erteilt hatte, aber vor allem, dass es bereits eine andere Frau in seinem Leben gab. Damit hatte sie nicht gerechnet.
In der Klinik war man verunsichert durch ihr selbstbewusstes Auftreten. Zweifel und Misstrauen waren vorhanden, wenn sie auch nicht laut wurden. Durch gezielte, wenn auch ganz beiläufig klingende Bemerkungen, verstand es Mona, Britta ins Zwielicht zu bringen.
Aber dann kam ein Anruf, der sie restlos aus dem Gleichgewicht brachte. Sie wurde dringend an Raimund Döbels Krankenbett gerufen.
Sie hatte nicht die geringste Ahnung gehabt, wohin er verschwunden war. Sie hatte sich darum auch keine Gedanken gemacht, denn sie hatte ihm den Rat gegeben, zu verreisen und so weit wie nur möglich, da Horsts Tod all ihre Pläne über den Haufen geworfen hatte.
Dr. Rust sagte ihr, dass Döbels Zustand bedenklich sei. Sie entgegnete, dass sie unabkömmlich sei und frühestens am Abend kommen könne.
Auf diesen Schrecken folgte der zweite, als sie verständigt wurde, dass Armin Mehlsen die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hätte, um den Tod seines Sohns untersuchen zu lassen. Für den nächsten Morgen um zehn Uhr wurden alle Beteiligten zur Vernehmung gebeten.
Monas Gedanken überstürzten sich. Da war noch Billing, was würde der sagen können, und was konnte Raimund schon gesagt haben? Jäh wurde ihr bewusst, dass sie solche Probleme nicht einkalkuliert hatte, und sie hatte auch nicht ernsthaft damit gerechnet, dass Mehlsen seine Drohung wahrmachen würde. Und dann wurde ihr plötzlich klar, dass alles schiefgelaufen war. Sie hatte gemeint, dass die Zeit für sie arbeiten würde, dabei war nicht die Zeit gegen sie gewesen, sondern auch der letzte Rest Verstand in Horst.
Wie ein Film rollte vor ihren Augen ab, was an jenem Freitag in dem Haus am Tegernsee geschehen war, und Raimund war Zeuge gewesen.
*
Schwester Karla saß an Raimunds Bett, und nun hielt sie voller Mitleid seine Hand, da sie wusste, dass sein Leben bald zu Ende gehen würde.
Er war bei Bewusstsein. Er war sehr schwach, aber er wollte reden. Er hatte auch die Injektion bekommen, die er brauchte, nachdem er nach Mona verlangt hatte.
»Wenn Mona nicht kommt, werde ich dir alles sagen, Karla«, murmelte er. »Alles. Ich wollte doch so gern leben. Mona hat gesagt, dass alles in Ordnung kommt und es uns gutgehen wird. Ich habe mich auch mit Horst gut verstanden. Er hat gewusst, dass ich Leukämie habe, und er hat gut für mich gesorgt. Ich sollte für ihn sorgen, aber mir ging es schlecht. Dann ist Mona gekommen, und Horst hat gesagt, dass ich in eine Klinik muss. Ich weiß nicht, was sie dann geredet haben, sie sind rausgegangen, aber sie haben gestritten. Ich habe es gehört, wie Horst sie angeschrien hat, dass sie nur die Klinik will und ihr sonst alles egal ist. Er hat von Britta geredet, und Mona hat gesagt, dass er doch zu ihr gehen solle. Sie würde ihn sogar hinbringen.«
»Hat sie das getan?«, fragte Karla.
»Sie hat uns mitgenommen. Sie hat Horst zu seinen Eltern gebracht und mich mit in ihre Wohnung genommen. Sie hat mir was gegeben, und ich habe ganz gut geschlafen. Manchmal ging es mir ganz gut, Karla, und dann wieder schlecht. Mona hat mir noch Geld gegeben und gesagt, dass ich verreisen solle. Horst würde bei seinen Eltern bleiben, und sie würde sich um ihn kümmern. Und nun haben sie mir gesagt, dass Horst tot ist. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Mona hat mir die Ampullen weggenommen, ich schwöre es. Du musst es mir glauben.«
»Ich glaube dir, Raimund«, sagte Karla mit erstickter Stimme.
»Ich hätte dich doch geheiratet. Ich hatte dich sehr gern, Karla«, murmelte er.
»Warum hast du mir nicht gesagt, dass du denkst, dass du Leukämie hast?«, fragte sie bebend.
»Ich denke es doch nicht, ich weiß es. So viel verstehe ich von Medizin, dass ich so eine Blutuntersuchung vornehmen kann. Ich wollte nicht, dass du das mitmachst. Mona hat mir versprochen, dass ich es guthaben werde und dass ich noch lange leben kann. Aber sie hat auch Horst versprochen, dass alles gut wird. Und nun ist er tot. Ich werde auch sterben. Ich weiß es. Ich habe die Ampullen genommen. Ich will es vor Zeugen sagen.«
Er hatte nicht bemerkt, dass während der ganzen Zeit Dr. Rust im Zimmer gewesen war, hinter dem Vorhang, der vor dem Waschbecken angebracht war. Karla hatte es gewusst, und es war ihr auch recht gewesen.
»Du hast es doch schon gesagt, Raimund«, sagte sie sanft. »Schlaf jetzt.«
»Warum ist die Frau Doktor nicht mehr hier?«, fragte er schleppend.
»Sie ist doch in Pension. Dr. Rust ist auch ein guter Arzt.«
»Ich wollte so gern ein guter Arzt sein«, murmelte er, aber dann fielen ihm die Augen zu.
Dr. Rust wartete noch ein paar Minuten, dann trat er auf Karla zu und legte seine Hände auf ihre zuckenden Schultern. »Sie waren sehr tapfer, Schwester Karla«, sagte er leise.
Langsam stand sie auf, ihre Augen waren feucht. »Helfen kann ihm doch niemand mehr«, sagte sie tonlos.
»Aber anderen kann man helfen«, erwiderte er. »Sie werden es können, wenn Sie es wollen, nach diesen Erfahrungen. Bitte, bleiben Sie bei uns.«
Ja, es war so, wie Raimund Döbel gesagt hatte. Mona hatte die beiden jungen Männer mitgenommen. Sie hatte Horst zu seinen Eltern gebracht und Raimund mit in ihre Wohnung mitgenommen. Sie wusste um das Auf und Nieder seiner Krankheit in diesem Stadium, und sie wusste, wie sie einem solchen Kranken wenigstens vorübergehend helfen konnte. Raimund war nach langem Schlaf in einer verhältnismäßig guten Verfassung gewesen. Sie hatte ihn zum Bahnhof gefahren und ihn in einen Zug gesetzt, der nach Wien fuhr.
»Du bleibst erst mal bei Tante Cilly«, hatte sie gesagt. »Ich hole dich ab, wenn alles hier geregelt ist.«
Er hatte nicht gewagt, Mona zu widersprechen. Sie duldete das nicht. Und auch Tante Cilly in Wien hatte nie einen Widerspruch geduldet. Er hatte keine freundliche Erinnerung an sie, bei der er mehrere Jahre seiner Kindheit verbracht hatte. Er hatte Angst vor ihr, wie er auch vor Mona Angst hatte.
Beim nächsten Halt stieg er wieder aus, setzte sich in die Bahnhofswirtschaft und trank einen Kaffee. Er schmeckte abscheulich. Dann entschloss er sich, ein paar Tage hierzubleiben. Wie es weitergehen sollte, wusste er nicht. Schon bald fühlte er wieder die Schwäche durch seinen Körper kriechen, fiebrige Hitze und dann auch wieder dieses Frösteln. Stoff für ein paar Spritzen hatte er noch, aber er musste sie einteilen. Hatte Mona nicht daran gedacht, dass er sie brauchte? Klar denken konnte er nicht mehr, und dann wusste er auch nicht mehr, wie viel Tage schon vergangen waren, als er in seiner Verzweiflung Horst anrief.
Da meldete sich Armin Mehlsen. »Horst ist tot«, hatte er gesagt. Raimund hatte es nicht glauben wollen. Er war nach München gefahren. Hundeelend war es ihm, und da erinnerte er sich an Dr. Norden. Damals hatte er sich gewünscht, so ein Arzt zu werden, aber beim Examen war es dann gewesen, als hätte er einen völligen Gedächtnisschwund. Nichts hatte er zustande gebracht, Spott und Hohn hatte er geerntet, auch von Mona.
So, wie Raimund dies jetzt als Albtraum noch einmal durchlebte, so ging es nun allerdings auch Mona durch den Sinn und sie empfand plötzlich Furcht. Billing war nicht erreichbar und auf ihn konnte sie keinen Druck mehr ausüben. Eines Tages würde sie es büßen, hatte er gesagt, aber da hatte sie ihn ausgelacht. Jetzt war ihr das Lachen vergangen. Sie sah keinen anderen Ausweg mehr als die Flucht.
Ein Stein war ins Rollen gekommen, aber bevor er sich zu einer Lawine auswirken konnte, wurde er gebremst. Mona Lohrs Verschwinden ließ nun alles in anderem, im rechten Licht erscheinen.
Raimund Döbel hatte nochmals lichte Momente gehabt und weitere Einzelheiten preisgegeben. Dass Horst sich selbst die tödliche Injektion verpasst hatte, erschien wahrscheinlicher, als dass Mona sie ihm verabreicht hätte, denn sie sah ihre Zukunft ja in der Klinik von Armin Mehlsens Gnaden. Und als sie ahnte, dass Horst nicht mehr zu helfen war, wollte sie für seinen Tod Britta verantwortlich machen.
Einfach war es nicht, die verschiedenen Teile des Geschehens zu einem Ganzen zusammenzufügen, und was an Bekenntnissen fehlte, musste kombiniert werden, aber dazu trugen auch Gerda Steinsdorf, Armin Mehlsen und Schwester Karla bei, und dann auch Elena Richter, die es genoss, ihren Rachedurst endlich stillen zu können. Sie erklärte, dass sie niemals intime Beziehungen zu Professor Billing gehabt hätte, dass sie auf ihn nur die Hoffnung setzte, er könne ihrem Mann helfen. Hintergründig räumte sie dann ein, dass er in ihr wohl dann eine reiche Witwe gesehen hätte, und an Mona ließ sie kein gutes Haar. Sie wäre diejenige gewesen, die ihrem schwerkranken Mann eingeflüstert hätte, dass sie ein Verhältnis mit Billing gehabt habe. Sie hätte ihm guten Gewissens sagen können, dass dies nicht stimme, und er hätte es geglaubt.
Wie das Testament geändert werden sollte, erfuhr niemand. Der Notar berief sich auf seine Schweigepflicht, und da das Testament nicht in Kraft gesetzt worden war, wurde da nicht weiter geforscht.
So wurde Mona mit Schuld überhäuft, auch mit solcher, die anderen zuzuschreiben war, aber zur Rechenschaft konnte sie nicht gezogen werden. Sie blieb verschwunden. Das Einzige, was über sie noch in Erfahrung gebracht werden konnte, war, dass sie sich nach Südamerika abgesetzt hatte. Raimund Döbel starb einige Tage später. Karla war bis zu seinem letzten Atemzug bei ihm, und die letzten Worte, die sie von ihm hörte, lauteten: »Ich bin froh, wenn alles vorbei ist.«
Für ihn gab es Entschuldigungen, denn er war von einer schrecklichen Krankheit gepeinigt worden, die seinen Körper zerstört hatte und seinen Geist lähmte.
Gerda brauchte Karla keine andere Stellung zu besorgen. Sie blieb an der Klinik. Sie wollte helfen, wo noch zu helfen war.
Und für die anderen, die jung und voller Hoffnung waren, konnte nun ein anderes Leben beginnen.
*
Britta kehrte nicht ins Klinikum zurück. Es war Constantins Wunsch, ihm in der Praxis zu helfen, und außerdem wurde jetzt mehr von der Hochzeit, als vom Beruf gesprochen.
Barbara hatte sich daran gewöhnt, Einlagen zu tragen und auch recht hübsche Schuhe gefunden, in die sie hineinpassten.
Dass sie schmerzfrei war, schob sie jedoch mehr auf Jörgs fürsorgliche Behandlung, während Dr. Norden der Meinung war, dass auch das ruhige Leben und ihre seelische Ausgeglichenheit dazu beitrugen.
Heimlich hatte Barbara einen Kursus als Arzthelferin belegt und auch erfolgreich abgeschlossen. Außerdem arbeitete sie halbtags in einem Übersetzungsbüro, und dort hätte man sie auch gern für immer behalten, doch in ihrem Leben gab es nun auch einen Mann, den sie so heiß und innig liebte, wie sie es nie für möglich gehalten hatte.
In Jörgs Leben war das Kapitel Mona abgeschlossen und wurde nie mehr erwähnt. Wenn ihm aber Dr. Norden einen neuen Patienten schickte, erwähnte er es jedes Mal, wie dankbar er ihm sei, dass er Barbara zu ihm geschickt hätte. Und jetzt brauchte er sich auch keine Sorgen mehr um die Zukunft zu machen. An Patienten mangelte es nicht. Bald gehörte auch Joachim Schöler dazu, der nach seiner Entlassung aus der Klinik nachbehandelt werden musste. In ein Rehabilitationszentrum hatte Joachim Schöler nicht gehen wollen. Er brauchte seine Familie, um ganz zu genesen. Eine Stellung hatte er auch bekommen. Armin Mehlsen hatte sie ihm verschafft, ohne dabei genannt sein zu wollen. Ja, er wollte gutmachen, was er aus falscher Vaterliebe versäumt hatte. Er hatte ein offenes Ohr für alle, die Hilfe brauchten und den Willen zum Leben hatten. Käthe Schöler war nun eine glückliche Großmutter, Gerda Steinsdorf hoffte, bald eine zu werden.
Allzu lange musste sie darauf bestimmt nicht warten, denn so viel Liebe, wie Constantin für Britta empfand und sie für ihn, musste ja neues Leben zur Folge haben.
Im September sollte Hochzeit sein. Jörg war ziemlich enttäuscht, als er erfuhr, dass der Termin schon festgelegt war.
»Ich habe gedacht, wir könnten Doppelhochzeit feiern«, sagte er zu Barbara. »Sie scheinen zu denken, dass wir es uns erst noch überlegen müssen, Babsi.«
»Bei ihnen pressiert’s«, erwiderte Barbara fröhlich.
»Wieso?«, fragte er verblüfft.
»Lieber Herr Doktor, du stellst doch sonst so gute Diagnosen«, lachte Barbara. »Der Nachwuchs ist schon unterwegs.«
»Britta hat davon nichts gesagt«, erklärte er.
»Mir auch nicht, aber als Frau hat man dafür ein Gespür. Wann geht eigentlich Marika?«
»Zum ersten Oktober.«
»Gut, dann bewerbe ich mich«, meinte sie neckend. »Die Prüfung habe ich bestanden. Das Zeugnis wird vorgelegt.«
Er schaute sie so fassunglos an, dass sie lachen musste. »Oder willst du auch lieber eine promovierte Ärztin engagieren?«, fragte sie. »Weißt du, ich habe gedacht, dass ich meine Wohnung verkaufe, und damit können wir dann die Hypotheken abzahlen, und nachdem ich die Prüfung bestanden habe, sparen wir das Gehalt für die Sprechstundenhilfe. Man hat mir übrigens bescheinigt, dass ich sehr schnell begreife und talentiert bin.«
»In jeder Beziehung«, sagte er, »daran habe ich nie gezweifelt. Aber die Hypotheken kann ich auch allein abzahlen. Und eine Frau kann ich auch ernähren.«
»Du weißt ja nicht, wie anspruchsvoll ich bin. Eine Dreizimmerwohnung wird zu klein für eine Familie. Wir müssen anbauen. Ich habe mich schon erkundigt, ob das genehmigt wird. Es wird keine Schwierigkeiten machen. Wir können erst an Nachwuchs denken, wenn wir mehr Platz haben.«
»Du denkst wirklich an alles«, staunte er. »Wann hast du den Kursus gemacht?«
»Wenn du gedacht hast, wo ich wohl meine Zeit verbringe, während du schwer arbeitest«, erwiderte sie schelmisch. »Ich habe auch viel lernen müssen, mein Schatz, aber es hat mir viel Spass gemacht.« Sie blinzelte ihm zu. »Marika werde ich schon ersetzen können. Weißt du, sie macht das alles so mechanisch. Ich bin ganz dabei. Eigentlich hätte ich Medizin studieren sollen, anstelle von Sprachen.«
»Dann hätten wir uns bestimmt nie kennengelernt«, sagte er, »denn du wärest ganz bestimmt eine sehr erfolgreiche Ärztin geworden.«
Sie küsste ihn stürmisch. »Na, vielleicht wären wir uns dann auch bei einem Kongress begegnet, wie Britta und Constantin. Aber was soll’s, manchmal tut es auch ein Bandscheibenschaden.« Nach einem weiteren langen Kuss sagte sie dann nachdenklich: »Erinnere mich bloß nicht an die Schmerzen, und Einlagen trage ich nur dir zuliebe. Und mein Herz hätte ich an einen anderen bestimmt nicht verloren.« Sie schmiegte sich in seine Arme und rieb ihre Wange an seinem Kinn. »Es war so lieb, dass du dich so um mich gekümmert hast.«
In seinen Augen leuchtete Liebe. »Es war ja kein weiter Weg zu dir, Liebstes, und du hast mir halt gleich so gut gefallen.«
»Hat Britta nicht nachgeholfen?«, fragte sie neckend.
»Gefreut hat es mich schon, dass ihr euch gleich so gut verstanden habt, und ich wollte es Britta nicht gleich auf die Nase binden, dass es keiner Nachhilfe bedürfe. Ich wusste ja nicht, ob ich Resonanz finden würde bei dir.«
»Man könnte es besser ein Echo nennen«, sagte Barbara schelmisch. »Also werde ich engagiert?«
»Auf Lebenszeit, das weißt du«, erwiderte Jörg zärtlich.
*
So sollte es doch noch zu einer Doppelhochzeit kommen, wenn Jörg und Barbara sich mit dem Aufgebot auch sehr beeilen mussten. Sie hatten sich dann doch so schnell entschlossen, weil Lady Curley, Britta und Jörgs Mutter ihr Kommen zugesagt hatte.
Die Geschwister waren ziemlich erstaunt darüber, aber Gerda meinte, dass sich das wohl so gehöre.
»Sie ist eben nicht so eine Mutter wie du«, sagte Britta gedankenvoll. »Einen Beruf hatte sie ja nicht, und ohne Mann kam sie sich als halber Mensch vor.«
»Als halbe Frau«, warf Jörg anzüglich ein. »Aber sonst sind wir ja gut mit ihr ausgekommen und dankbar waren wir auch, dass sie uns den Stiefvater nicht vor die Nase setzte.«
»Ist er nicht nett?«, erkundigte sich Gerda.
»Wenn man seine Kreise nicht stört, kann er ganz nett sein«, meinte Britta lächelnd, »aber er hat für Kinder nichts übrig gehabt, und erwachsene Kinder sollen auf eigenen Füßen stehen, das war ja auch Mamas Standpunkt. Für uns war es gut, Muttchen, wir sind nicht zu bedauern.«
Als Lady Charlott angereist kam, konnte Gerda solche Einstellung verstehen.
Eine elegante, charmante Frau, überaus gepflegt, die jung wirken wollte und es auch tat mit Hilfe eines sehr guten Liftings, wie es Gerda gleich für sich feststellen konnte. Aber die Rührung, die sie jetzt zeigte, als sie ihre erwachsenen Kinder in die Arme schloss, war nicht gespielt.
Constantin schien ihr außerordentlich gut zu gefallen, aber auch Barbara bekam freundliche Worte zu hören. Ihre Hochzeitsgeschenke bestanden in großzügigen Schecks, da sie ja nicht wusste, was die jungen Leute alles noch brauchen würden, erklärte sie dazu ein wenig verlegen. Britta bekam noch ein wunderschönes Collier und Barbara ein Armband, das auch seinen Wert hatte.
»Das Hochzeitsessen soll ein Geschenk von Charly sein«, erklärte sie, »und ich soll ausrichten, dass er sich freuen würde, euch bei Gelegenheit kennenzulernen. Ich hoffe es jedenfalls sehr, dass ihr uns bald besuchen werdet.«
Heimweh hatte sie bestimmt nicht. Sie lebte sorglos und zufrieden und nun voller Genugtuung, dass ihre Kinder gut versorgt waren.
Von Horst hatte sie glücklicherweise nie etwas erfahren, und so gab es da keine umbequemen Fragen.
Störend wirkte sie jedenfalls nicht. Sie sorgte für Stimmung. Man merkte, dass sie gewohnt war zu arrangieren und zu unterhalten, und sie gefiel sich nun sogar in der Rolle der stolzen Mutter, da alles nach Wunsch lief.
Während Gerda bei der kirchlichen Trauung tief gerührt war, genoss Charlott diese wie einen romantischen Film. Die beiden Paare konnten sich sehen lassen, die Bräute sahen bezaubernd aus. Charlott bedauerte nur, dass keine Väter da waren, die die Bräute zum Altar führten. In England wäre das eine so schöne Sitte, stellte sie beiläufig fest, aber an dieser Bemerkung merkte man, dass sie nicht daran dachte, dass es einmal Väter gegeben hatte. Man nahm es ihr nicht mal übel. Sie lebte in der Gegenwart.
Und wie sie angewirbelt gekommen war, wirbelte sie am Tag nach der Hochzeit auch gleich wieder davon, denn ihren Charly konnte sie nicht lange allein lassen.
»Wo hat sie ihn denn eigentlich kennengelernt?«, fragte Gerda nun doch ein bisschen neugierig, als wieder Ruhe eingekehrt war.
»Als Teenager«, erwiderte Britta. »Sie war im Schüleraustausch in England und lernte den Sohn des Hauses kennen. Vielleicht hatte sich da was angesponnen. Wir haben es so genau nie erfahren, obgleich Mama sonst doch nicht gerade schweigsam ist. Aber Charly wurde von seinem Vater geschäftlich in die Welt geschickt, und Mama lernte dann unseren Vater kennen. Charlys Schwester Maryann hat uns öfter besucht. Das war eine ehrliche Freundschaft, und als Vater gestorben war, hat Maryann Mama auch gleich eingeladen. Ja, da hat sie dann Charly wiedergetroffen, und er war frei und ledig. Mama fand, dass wir alt genug wären und auf eigenen Füßen stehen könnten und versorgte uns mit Geld. Sie könne und wolle sich die Chance nicht entgehen lassen, einen vermögenden Mann zu heiraten, so lange sie sich auch noch einiges vom Leben erwarte. Damals waren wir schon ein bisschen geschockt, Muttchen, aber jetzt verstehen wir sie. Sie ist ganz anders als du. Sie wäre eine griesgrämige Frau geworden, die uns immer wieder vorgeworfen hätte, dass wir sie dazu gemacht haben. Ich mag sie trotz allem.«
»Man muss sie mögen. Sie ist so ehrlich«, sagte Gerda. »Wenige Menschen haben den Mut, sich so zu sich selbst zu bekennen.«
»Du bist mir dennoch lieber, Muttchen«, sagte Britta zärtlich. »Insgeheim wünscht man sich doch eine Mutter, eine richtige Mutter.«
Und das war das schönste Kompliment für Gerda. »Und ich habe mir solche Tochter gewünscht, Brittakind«, erwiderte sie innig. »Aber gut ist es doch, dass da keine unüberwindlichen Konflikte sind.«
»Hoffentlich gibt es bei dir keine«, sagte Britta.
»Wieso denn?«
»Robert Korten schien fasziniert von Mama zu sein.«
Gerda lachte amüsiert auf.
»Sie versteht es ja, und von mir weiß er, dass ich für solche Späßchen nicht mehr zu haben bin. Nein, da gibt es keine Konflikte, Liebes. Er ist ein guter Freund, mehr nicht. Ich wünsche mir nur noch ein paar goldige Enkelchen, die ich lieb haben darf.«
»Das darfst du bald, Muttchen«, sagte Britta weich. »Wir sind doch glücklich, dass wir zusammenbleiben, dass du bei uns bleibst. Und ich werde es dir nie vergessen, dass du mich so liebevoll aufgenommen hast, trotz allem.«
»Was heißt denn trotz allem, Britta. Du hast dir nichts vergeben, und mein Sohn liebte dich. Und als ich dich sah, wusste ich, dass du die Richtige für ihn bist. Ein bisschen Menschenkenntnis darfst du mir schon zutrauen.«
»Weißt du, was ich jetzt manchmal denke? Die Sache mit Horst war mir zugedacht, um reif zu werden, reif genug, um einen Mann zu schätzen wie Constantin.«
»Sag jetzt nur nicht, dass mir die Sternschnuppe überreif in die Arme fiel«, ertönte da Constantins dunkle Stimme. »Du warst ein bezauberndes Mädchen und bist eine hinreißende Frau.«
»Dann lasse ich euch jetzt allein und mache das Essen«, sagte Gerda. »Wenn ihr schon keine Hochzeitsreise macht, dann sollt ihr wenigstens gut gefüttert werden.«
»Unser Muttchen«, sagte Britta innig hinter ihr her, und Gerda dachte, meine Kinder, meine glücklichen Kinder. Was will ich noch mehr? Aber es gab ja tatsächlich noch mehr, worauf sich ihre Wünsche richteten, und das füllte die kommenden Wochen und Monate aus.
Britta ging es gut während der Schwangerschaft. Zu aller Erstaunen rief jetzt Charlott ziemlich oft an, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen und immer wieder sagte sie auch, wie schön die Stunden mit ihnen allen gewesen wären.
Auch Robert Korten erkundigte sich laufend, ob alles in Ordnung sei, und manchmal kam er höchstpersönlich, um sich zu überzeugen. Und da schien es doch so, als sei er anderer Meinung als Gerda. Sie war ja auch eine patente Frau, aber auch ebenso standhaft in ihren Prinzipien.
Ein bisschen bekümmert war jetzt nur Barbara. Sie wünschte sich ja auch ein Baby.
»Wenn ich keins kriege, Jörg, lass ich mich wieder scheiden«, sagte sie eines Abends deprimiert.
»Das könnte dir so passen. Unser Nachwuchs ist halt sehr rücksichtsvoll. Ich kann meine Babsi in der Praxis eben noch nicht entbehren. Du weißt doch genau, wie gern dich unsere Patienten haben. Was meinst du, was sie sagen würden, wenn plötzlich wieder eine Marika dasitzen würde, die nur an den Feierabend denkt.«
»Unser Kind kann auch in der Praxis dabeisein«, sagte Barbara.
»Und du sitzt im Büro und stillst es, und so nebenbei fertigst du auch die Patienten ab«, scherzte er.
»Deinen Humor möchte ich haben«, sagte sie mit leisem Vorwurf.
»Du hast ihn mir wiedergegeben, Babsi«, erwiderte er liebevoll. »Ich brauche dich. Du darfst niemals denken, dass mir ein Kind wichtiger ist als du.«
»Aber ich möchte eins haben, sonst werde ich zu alt.«
Er nahm sie in die Arme. »Du wirst nie alt, du bist so herrlich jung«, sagte er zärtlich, »und gerade jetzt schöner denn je. Vielleicht solltest du doch mal zu Dr. Norden gehen und einen Test machen lassen.«
»Was für einen Test?«, fragte sie.
»Einen Schwangerschaftstest.«
»Den kannst du doch auch machen«, entgegnete sie.
»Siehst du, Babsi, darin bin ich feige. Ich könnte es nicht fertigbringen, dir möglicherweise zu sagen, dass es Fehlanzeige ist. Und eigentlich finde ich es auch viel schöner, wenn meine so sehr geliebte Frau nach Hause kommt und mir um den Hals fällt und sagt, dass es stimmt.«
»Wieso denkst du, dass es stimmen könnte?«, fragte sie.
»Weil so ein ganz besonderer Glanz in deinen Augen ist.«
Schon am nächsten Tag ging sie zu Dr. Norden. Jörg ahnte es, obgleich sie gesagt hatte, dass sie ein paar Besorgungen machen wolle. Und er wartete mit sehr gemischten Gefühlen auf ihre Rückkehr. Er hatte sich schon zurechtgelegt, was er ihr Tröstendes sagen würde, wenn sie enttäuscht käme.
Aber sie kam ins Haus gestürmt und fiel ihm um den Hals, und zwischen Lachen und Weinen jubelte sie: »Du hast recht gehabt, es stimmt. Bei dir klappt halt die Augendiagnose.« Und dann sagte sie auch noch schelmisch: »Dr. Norden meinte, dass die Einlagen dazu auch beigetragen haben konnten.«
»Dieser Schelm«, lachte Jörg. »Er ist der netteste Kollege, den man sich wünschen kann.«
»Ich habe ihm alles zu verdanken«, flüsterte Barbara. »Dich. Du weißt ja gar nicht, wie sehr ich dich liebe.«
»Auch wenn du es nicht glauben willst, ich weiß es«, sagte er. »Nur so viel Liebe kann einen Mann so glücklich machen. Aber es beruht ja auf Gegenseitigkeit.«
*
Zu aller Beruhigung verlief auch bei Barbara die Schwangerschaft völlig normal. Die ersten beiden Monate waren überstanden, als Brittas große Stunde nahte.
Dr. Leitner hatte keine Mühe. Constantin und Gerda waren selbstverständlich dabei, und so viel war im Kreissaal der Leitner-Klinik noch nie gelacht worden. Gerda verstand es meisterhaft, auch die aufregenden Momente mit Humor zu überbrücken, und als Constantin dann doch nervös wurde, verströmte sie eine bewundernswerte Ruhe.
Sie war es auch, die das strampelnde Geschöpfchen aus Dr. Leitners Händen entgegennahm.
»Der Sohn ist da!«, rief sie zwischen Lachen und Aufschluchzen aus, und Tränen übergroßer Freude rollten über ihre Wangen, während Constantin das erschöpfte Gesicht seiner Frau mit zärtlichen Küssen streichelte.
»Ich dachte schon, es wäre ein Mädchen«, flüsterte Britta.
»Constantin soll er heißen, Constantin der Zweite«, sagte Britta kategorisch.
»Solange ich immer der Erste für dich bleibe, bin ich einverstanden, Allerliebstes«, sagte Constantin
»Ein Prachtexemplar ist es«, sagte Dr. Leitner, als der Kleine gewogen, gemessen und gewaschen war. Dann konnte Britta ihn in den Arm nehmen.
»Bei den Eltern doch kein Wunder«, sagte Gerda stolz und voller Großmutterglück. Dann aber musste sie die Nachricht gleich an Barbara weitergeben, die schon voller Spannung auf diesen Anruf wartete.
»Sie haben einen Sohn«, sagte sie andächtig zu Jörg. »Ich kriege bestimmt nur ein Mädchen.«
»Wieso nur, ich wünsche mir eine Tochter. Eine, die genauso wird wie du. Mädchen lieben die Väter mehr als ihre Söhne.«
»Das kommt aber auch auf die Mutter an«, meinte sie schelmisch. »Aber wenn du unbedingt eine Tochter haben willst, sollst du sie auch bekommen. Einen Sohn werde ich dann auch noch kriegen.«
Sieben Monate später hatten sie ihre Tochter, und sie sollte nun tatsächlich Victoria getauft werden. Winzig sah das Baby aus neben dem kräftigen Conny, der freudig in die Hände klatschte, als er das Baby sehen durfte. Er dachte wohl, dass es ein Spielzeug sei.
»Nicht zu glauben, dass du auch so klein warst«, meinte Britta verwundert.
»Da siehst du, wie schnell Kinder wachsen«, lächelte Gerda, »aber allzu lange wird es ja nicht dauern, bis wir auch wieder so was Kleines haben.«
»Unsere Omi ist unersättlich«, meinte Constantin neckend.
»Wie schön, dass wir sie haben«, sagte Britta.
»Und wir davon auch profitieren«, schloss sich Barbara an.
In Gerdas großem gütigem Herzen war so viel Liebe, dass auch die kleine Victoria eine Omi hatte, aber es soll auch erwähnt sein, dass Charlott sich großzügig erwies. Jörg bemerkte dazu allerdings ein bisschen anzüglich, dass sie eine zahlende und eine fürsorgliche Mutter hätten.
Gerda konnte es nur recht sein, wie sich alles so ergeben hatte. Sie bekam alles, was sie an Liebe gab, vielfältig zurück, und was konnte es Schöneres geben, als ein von Freude erfüllter Lebensabend.