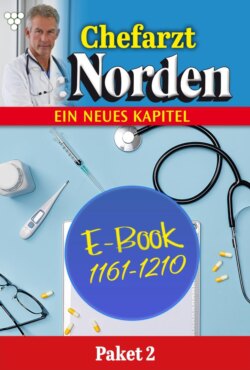Читать книгу Chefarzt Dr. Norden Paket 2 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDr. Christina Rohde zog ihren OP-Kittel aus und warf ihn in den Wäscheständer. Erschöpft ging sie zu den Waschbecken hinüber, die in einer langen Reihe an der gegenüberliegenden Wand angebracht waren. Sie hatte den ganzen Tag im Saal gestanden und operiert. Der Rücken tat ihr weh, und ihre Füße spürte sie kaum noch. Die Sehnsucht nach einer ausgiebigen Pause war in der letzten Stunde immer größer geworden.
»Bist du endlich fertig?« Sarah Buchner, die an der Behnisch-Klinik als Gynäkologin arbeitete, kam in den Waschraum.
»Ja, für heute reicht’s. Seit acht stand ich ununterbrochen am Tisch.«
»Hast du noch nicht mal zu Mittag gegessen?«
»Klar, wenn du mit Mittag meine trockne Stulle meinst, die ich mir zwischendurch gegönnt habe.«
»Du Ärmste. Da hatte ich es heute ausgesprochen gut. Eine Sectio vormittags und eine am Nachmittag.« Sarahs Augen leuchteten begeistert, und Christina konnte ihr das nicht verdenken. Eine Sectio, also ein Kaiserschnitt, war immer etwas Besonderes. Auch wenn der Anlass dafür mitunter sehr dramatisch war, gelang es niemanden, seine Rührung zu verbergen, wenn das Baby den schützenden Schoß verließ und mit seinem ersten Schrei die Welt begrüßte.
»Junge oder Mädchen?«, fragte Christina lächelnd und wünschte sich, sie wäre dabei gewesen.
»Beides. Erst ein strammer Achtpfünder und vorhin eine zierliche Kleine, die es gerade mal auf die Hälfte brachte.«
»Und du warst bei ihren allerersten Atemzügen dabei. Du bist wirklich zu beneiden, Sarah.«
»Ich weiß«, kam es mit einem strahlenden Lächeln zurück.
Christina trocknete sich die Hände ab und nahm die OP-Mütze runter. Sie verzog missbilligend den Mund, als sie sich im Spiegel betrachtete. Das schokoladenbraune Haar hatte das stundenlange Ausharren unter der eng sitzenden Mütze nicht gut vertragen. Von seinem seidigen Glanz war nichts mehr übrig, stattdessen wirkte es verschwitzt und strähnig. Unwillig löste Christina das Zopfgummi und fuhr mit den Fingern durch das Haar, um es ein wenig in Form zu bringen. Ihre Kollegin tat es ihr gleich, obwohl sie es nicht nötig hatte. Sarahs blonde Mähne floss in weichen, sanften Wellen über ihre Schultern.
»Wie machst du das nur?«, fragte Christina. »Deine Haare sehen immer so aus, als wärst du gerade vom Friseur gekommen. Ich dagegen …«
»Im Gegensatz zu dir habe ich meine Mütze keine Stunde getragen. Glaub mir, ich sehe nicht besser aus als du, wenn ich so einen OP-Marathon hinter mir habe.« Sarah trocknete sich die Hände ab. »Hast du Zeit für einen Kaffee? Dann könnte ich dir von den Babys berichten, oder wir machen einen kleinen Ausflug auf die Neugeborenenstation, um sie uns anzusehen.«
»Klingt äußerst verlockend, aber heute kann ich leider nicht. Ich ziehe mich nur um und gehe dann sofort zum Chef. In fünf Minuten habe ich einen Termin bei ihm.«
Sarah sah erstaunt auf. »Warum?«
»Keine Ahnung. Er hatte darum gebeten. Seitdem überlege ich, ob ich irgendetwas ausgefressen habe.«
Es klang nicht so, als würde sie sich deswegen ernsthaft Sorgen machen, und auch Sarah konnte über diese Vorstellung nur lachen. »Gerade du? Norden ist froh, dass er dich hat. Du schiebst hier die meisten Überstunden oder Extra-Dienste und gehörst zu den besten Chirurgen.«
Das sagte Sarah nicht, um Christina zu schmeicheln. Es war schlichtweg eine Tatsache, die jedem Mitarbeiter der Behnisch-Klinik bekannt war. Christina galt als einsatzbereit, pflichtbewusst und als begnadete Chirurgin.
Mit Anfang dreißig waren sie und Sarah Buchner im gleichen Alter. Sie liebten beide ihre Arbeit und gingen voll in ihr auf. Für einen Partner oder gar eine eigene Familie blieb da keine Zeit. Davon war Christina jedenfalls fest überzeugt, auch wenn es Kollegen gab, die beides – Beruf und Familie – auf die Reihe bekamen. Und manchmal überlegte sie, wie es wohl wäre, nach einem langen, harten Tag in der Klinik heimzukommen und von einem Menschen erwartet zu werden, dem sie wichtig war. Der sie fragte, wie ihr Tag war, der ihr geduldig zuhörte oder sie einfach mal in den Arm nahm.
Als Christina Rohde fünf Minuten später das Büro von Dr. Daniel Norden betrat, hätte sie am liebsten auf dem Absatz kehrtgemacht. Dr. Erik Berger, der griesgrämige und ungehobelte Leiter der Notfallambulanz, wartete dort bereits ungeduldig.
»Wird ja auch Zeit«, knurrte er, als Christina auf dem Stuhl neben ihm Platz nahm.
»Ja, ich freu mich ebenfalls, Sie zu sehen, Herr Kollege«, gab Christina zuckersüß zurück. »Wenn ich gewusst hätte, dass Sie auch hier sind, hätte ich mich natürlich noch mehr beeilt, aus dem OP zu kommen.«
Ein lautes Räuspern von Daniel Norden verhinderte Bergers nächsten Kommentar, der sicher nicht freundlich ausgefallen wäre. Das lag nicht nur daran, dass Dr. Berger an sich kein netter Mensch war. Nein, die Abneigung, die er gegenüber Christina Rohde ganz offen zur Schau trug, ging tiefer – und war eindeutig beidseitig. Sie mochte ihn nicht und verstand nicht, dass der Chef ihm sein schlechtes Benehmen immer wieder durchgehen ließ und ihm nicht häufiger die Leviten las. An Gründen dafür mangelte es ganz sicher nicht.
»Ich freue mich, dass Sie so kurzfristig die Zeit gefunden haben herzukommen«, begann Daniel Norden. »Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, deshalb werde ich gleich zum Punkt kommen und mich kurzfassen.« Daniel sah in die erwartungsvollen Gesichter seiner Mitarbeiter. Noch war er sich nicht sicher, wie sie mit dem, was er ihnen zu sagen hatte, umgehen würden. »In allen Abteilungen ist genau festgelegt, wer den Bereichsleiter bei Ausfall zu vertreten hat – außer in der Notaufnahme. Als Sie, Herr Berger, vor einiger Zeit wegen Urlaub und Krankheit ausfielen, war ich sehr froh, dass Frau Rohde Ihre Aufgaben übernehmen konnte. Sie ist ja nicht nur Chirurgin, sondern besitzt auch eine Zusatzausbildung in Notfallmedizin. Deshalb ist es nur naheliegend, dass Frau Rohde ab sofort als Ihre ständige Vertretung eingesetzt wird.«
»Was soll das plötzlich?«, schnappte Berger. »Bisher ging es doch auch immer so!«
»Deswegen muss es ja nicht so bleiben«, erwiderte Daniel geduldig. Auf Bergers Widerspruch war er gefasst gewesen. Er kannte seinen genialen, aber bärbeißigen Notfallmediziner gut genug, um zu wissen, dass sich Berger nicht einfach widerspruchslos in alles fügte. Bisher war Erik Berger der alleinige Herr über sein kleines Reich gewesen – und nahezu unersetzbar. Sein krankheitsbedingter Ausfall vor einigen Monaten hätte für die Aufnahme große Schwierigkeiten bedeuten können, wäre Christina Rohde nicht für ihn eingesprungen. Dank ihr war der Betrieb ohne nennenswerte Probleme weitergelaufen.
»Sie werden mir sicher zustimmen, Herr Berger, dass es unvernünftig und unverantwortlich wäre, wenn wir uns nicht ausreichend auf mögliche Notsituationen vorbereiten würden. Wir müssen auch in Ihrer Abteilung verbindliche Regeln und Strukturen haben, die eine ordnungsgemäße Arbeit jederzeit gewährleisten. Dazu gehört auch, dass eine feste Vertretung für Sie bestimmt wird, die mit den Abläufen in der Aufnahme bestens vertraut ist. Ich denke, es gibt niemanden, der das besser leisten könnte als Frau Rohde. Sie muss jederzeit in der Lage sein, Sie zu ersetzen, falls …«
Berger hatte genug gehört. Wütend sprang er auf. »Jederzeit? Na gut! Warum fängt sie nicht gleich damit an? Sieht so aus, als wäre ich hier überflüssig!«
»Hören Sie auf, so einen Unsinn zu reden!« Daniel schüttelte verstimmt den Kopf. Warum benahm sich Berger bloß so kindisch? »Als Leiter einer Abteilung müssten Sie doch am besten wissen, wie wichtig es ist, auf den Notfall vorbereitet zu sein. Und um mehr geht es hier nicht! Niemand will Sie ausbooten oder loswerden. Ich schon gar nicht!« Daniel machte sich nicht die Mühe zu verbergen, wie verärgert er über Erik Bergers albernes Verhalten war. Am liebsten hätte er ihm hier und jetzt ordentlich die Meinung gesagt. Doch eine unfeine Auseinandersetzung, in der jeder seinen Emotionen freien Lauf ließ, würde diese angespannte Situation nur noch verschärfen.
Also nickte er nur schweigend, als Berger fragte: »War’s das jetzt? Kann ich wieder gehen?«
Erik Berger war schon zur Tür hinaus, als er stoppte und umkehrte. Tief gekränkt sagte er: »Sie irren sich, wenn Sie denken, dass ich einfach nur stur wäre oder nicht wüsste, dass eine feste Vertretung wichtig ist. Allerdings hätte ich erwartet, dass Sie zuerst mit mir darüber reden und mich nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellen.« Er warf einen wütenden Blick auf Christina Rohde. »Oder dass ich ein Mitspracherecht bei der Auswahl hätte.«
»Heißt das, Sie sind mit mir nicht einverstanden?«, wollte Christina jetzt wissen.
»Als ob das eine Rolle spielen würde!«, schnauzte Berger und verschwand nun endgültig.
Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, wurde Daniel nachdenklich. Auch wenn er sich darüber ärgerte, dass Berger wieder einen Aufstand gemacht hatte, kam er nicht umhin, Verständnis für ihn zu haben. Vielleicht war er wirklich etwas vorschnell gewesen und dabei übers Ziel hinausgeschossen. Vielleicht hätte er vorher mit Erik Berger sprechen müssen. Oder mit Christina Rohde, die er mit seinem Vorhaben genauso überrascht hatte.
»Es tut mir leid, Frau Rohde. Das Ganze ist nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Doch im Moment kann ich nicht mehr machen, als Sie zu fragen, ob Sie den Posten überhaupt wollen. Sie würden natürlich jede Unterstützung von mir bekommen, die notwendig ist.«
»Unterstützung? In welcher Form?«
»Ich denke an Freistellungen von Ihrer jetzigen Tätigkeit, damit Sie sich gut auf Ihre neue Arbeit vorbereiten können. Sie wissen ja am besten, dass die Notfallmedizin ihre Besonderheiten hat. Die Akutsituationen, mit denen man dort konfrontiert wird, erfordern ein hohes Maß an Wissen, aber auch Routine, damit man dem hohen Stresslevel gewachsen ist. Es wäre deshalb gut, wenn Sie hin und wieder für eine Woche in der Notaufnahme arbeiten oder auf einem Rettungswagen mitfahren würden.«
»Rettungswagen klingt gut. Sehr gut sogar. Aber die Aufnahme?« Christina seufzte auf. »Sie haben Herrn Berger ja gerade erlebt …«
»Um Herrn Berger kümmere ich mich«, entgegnete Daniel. »Keine Sorge, Frau Rohde. Bis Sie in die Aufnahme müssen, hat Herr Berger sich wieder beruhigt. Vorerst hatte ich eh an die Rettungswache gedacht. Wenn Sie einverstanden sind, können Sie dort schon am nächsten Montag anfangen, um die nächsten beiden Wochen auf einem Rettungswagen zu verbringen.«
Christina konnte ihre Freude über dieses Angebot nicht verbergen. Strahlend erwiderte sie: »Natürlich bin ich einverstanden. Mit allem. Mit der Vertretungsstelle, der Rettungswache, sogar mit Dr. Berger. Obwohl …« Es kostete sie alle Anstrengung, um die Worte, die ihr schon auf der Zunge lagen, zurückzuhalten. Auch wenn Erik Berger ein zynischer Grobian war und sie sich über sein unmögliches Benehmen schrecklich ärgerte, hielt sie es für falsch, sich in Gegenwart des Chefs über ihn auszulassen. »Obwohl die Situation etwas schwierig ist«, sagte sie deshalb nur diplomatisch.
»Schwierig?« Daniel lächelte. »Schön, dass Sie es so nett ausdrücken, Frau Rohde.«
*
Fee setzte sich zu ihrem Mann aufs Sofa. Sofort legte Daniel einen Arm um ihre Schultern und genoss ihre Nähe. Die Zwillinge, Dési und Janni, hatten sich nach dem Abendessen auf ihre Zimmer zurückgezogen. Im Hause Norden kehrte nun Ruhe ein. Ruhe und Zeit, um den Tag Revue passieren zu lassen und sich über seine Geschehnisse auszutauschen. Natürlich ging es dabei meistens um die Behnisch-Klinik, in der beide ihren Dienst verrichteten. Daniel Norden als Chefarzt der Klinik und Fee als Leiterin der Kinderabteilung.
»Und verrätst du mir nun endlich, was dich schon den ganzen Abend beschäftigt?«, fragte Fee.
Daniel gab seiner Frau einen leichten Kuss und lächelte die kleinen Sorgenfalten fort, die sich nach der Auseinandersetzung mit Erik Berger unbemerkt auf seiner Stirn gebildet hatten. »Du kennst mich einfach zu gut, Feelein.«
»Nach all den Jahren sollte man das erwarten dürfen. Also, sag schon, was war los? Wer hat dich geärgert?«
»Frag lieber, wen ich verärgert habe!«
Als Fee ihn nur verwundert ansah, sagte er knapp: »Berger.«
»Erik Berger?« Fee lachte auf. »Es gehört nicht viel dazu, ihn zu verärgern. Dein Vergehen kann also nicht sehr groß gewesen sein.«
»Ich würde es auch nicht unbedingt Vergehen nennen, eher eine Gedankenlosigkeit. Ein dummer Fehler, wie ich inzwischen einsehe. Einer, den ich hätte vermeiden können.« Daniel berichtete von dem Gespräch in seinem Büro und sagte abschließend: »Mir ist erst später klargeworden, dass ich ihm kein guter Vorgesetzter gewesen bin. Bei jedem anderen hätte ich mich anders verhalten. Wenn es nötig gewesen wäre, für die Orthopädie oder Innere einen stellvertretenden Abteilungsleiter zu finden, hätte ich vorher mit den leitenden Oberärzten gesprochen. Ich hätte nicht einfach über ihren Kopf hinweg etwas so Wichtiges im Alleingang entschieden, sondern mich mit ihnen beraten und ihnen bei der Wahl des passenden Kandidaten ein umfassendes Mitspracherecht eingeräumt. Bei Berger habe ich es nicht getan. Ich hatte es noch nicht mal in Erwägung gezogen und frage mich nun die ganze Zeit, warum das so war.«
»Für dich war das der Weg des geringsten Widerstandes. Niemand von uns ist scharf auf endlose Diskussionen und Streitereien mit Berger. Einfach eine Anordnung zu treffen und sie ihm in Gegenwart von Frau Rohde zu präsentieren, erschien dir unbewusst als beste Lösung.«
»Unbewusst …« Daniel lächelte gequält. »Darf ich auf dein Urteil als Psychiaterin vertrauen und meinem Unterbewusstsein die Schuld für den Fauxpas geben? Bin ich damit aus dem Schneider?«
Fee lachte. »Nein, mein Lieber, leider nicht. Wenn du aus dem Schneider wärst, müsstest du es jetzt nicht ausbaden. Ich fürchte, dir wird nichts anderes übrigbleiben, als vor Berger zu Kreuze zu kriechen und zu versuchen, ihn milde zu stimmen. Er ist ein fantastischer Arzt, auf den die Notaufnahme nicht verzichten kann. Du solltest es dir nicht mit ihm verscherzen. Rede mit ihm! Versuch, die Wogen zu glätten, bring es wieder in Ordnung und sichere dir Bergers Loyalität! Es ist immer besser, Verbündete zu haben als Feinde. Und bei allen Fehlern, die Berger hat, er wäre dir ein sehr guter und verlässlicher Verbündeter, auf den du im Notfall immer zählen könntest.«
»Spricht aus dir eine clevere Strategin oder bist du einfach nur sehr klug?«
»Wäre nicht auch beides möglich?«, erwiderte Fee grinsend und gab Daniel einen Kuss.
»Nur bei dir.« Daniel sagte das so liebevoll, dass er damit Fees Herz auch nach all den Jahren schneller schlagen ließ. Er zog sie dichter zu sich heran. Der Kuss, den er ihr jetzt gab, war ein Spiegelbild seiner Liebe und so wundervoll, dass Fee betete, er möge nie enden.
Der zauberhafte Abend mit seiner Fee hatte zwar Daniels Sorgenfalten glätten können, aber das schlechte Gewissen war geblieben. Deshalb ging er am nächsten Tag in die Notaufnahme, kaum dass er die Zeit dafür fand.
Erik Berger saß an seinem Schreibtisch und sah nur kurz auf, als sein Chef zu ihm ins Dienstzimmer kam.
»Haben Sie einen Moment, Herr Berger?«
»Schlecht jetzt. Hab zu tun.« Erik blickte verbissen auf seinen Monitor und sah heute besonders übellaunig aus. Daniel ließ sich davon nicht beeindrucken. Er musste das, was ihn beschäftigte, unbedingt loswerden. Das war er sich und seinem Mitarbeiter gegenüber schuldig. Wenn er etwas verbockt hatte, musste er es auch wieder in Ordnung bringen. So war er nun mal.
In den Jahren als Chefarzt der Behnisch-Klinik war Daniel durch eine harte Schule gegangen. Das Chefsein hatte ihm niemand in die Wiege gelegt. Das hatte er sich erst erarbeiten müssen. Natürlich hatte er auch früher, in seiner eigenen Hausarztpraxis, den Ton angegeben, aber mit den Aufgaben, die er als ärztlicher Leiter einer Klinik innehatte, konnte er das nicht vergleichen. Fachlich hatte ihn die Arbeit hier vor keine große Herausforderung gestellt. Als Mediziner wusste er immer, was zu tun war. Er scheute sich nicht vor einer Entscheidung, wenn es galt, ein Menschenleben zu retten. Doch andere Ärzte anzuleiten, zu führen und zu motivieren war ungleich schwerer und etwas, was er lernen musste. Dass dieser Lernprozess nie aufhörte und dass auch immer noch Fehler möglich waren, hatte er erst gestern erfahren müssen. Daniel besaß genug Charakterstärke, um das zugeben zu können und dafür gerade zu stehen.
»Keine Sorge, ich werde Sie nicht lange aufhalten.« Daniel setzte sich auf den Besucherstuhl. »Ich bin hergekommen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen.«
Es dauerte einen Moment, bis Erik begriff und erstaunt von seiner Arbeit aufsah.
»Es war falsch, dass ich Sie vor vollendete Tatsachen gestellt habe«, fuhr Daniel fort, als er Bergers Aufmerksamkeit hatte. »Ich halte es immer noch für wichtig, dass es für Sie eine feste Vertretung gibt. Aber ich hätte das vorher mit Ihnen besprechen müssen. Und vor allem hätte ich mir Ihre Meinung dazu anhören müssen. Die Entscheidung, wer für die Stelle am geeignetsten ist, hätten wir gemeinsam treffen müssen. Das im Alleingang zu machen, war ein Fehler, für den ich mich bei Ihnen entschuldigen möchte.«
Erik Berger sah Daniel sekundenlang an. Nur wer ihn gut kannte, bemerkte die leichte Veränderung, die Daniels Worte in ihm ausgelöst hatten. Seine Gesichtszüge wurden weicher und seine Augen blickten einen Hauch freundlicher drein.
»Okay«, sagte er schließlich und wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Er hämmerte auf die Tastatur seines Computers ein, als wollte er einen neuen Rekord aufstellen.
Zufrieden stand Daniel auf. Er wusste, mehr würde er von Berger nicht bekommen. Doch als er bereits die Türklinke in der Hand hatte, hielt Erik ihn auf:
»Ach, übrigens, Chef, Frau Rohde wäre auch meine erste Wahl gewesen. Falls Sie mich gefragt hätten.«
»Beim nächsten Mal«, erwiderte Daniel lächelnd.
Zufrieden mit sich und dem Ausgang des Gesprächs ging Daniel zum Fahrstuhl. Sein schlechtes Gewissen war auf einen kläglichen Rest zusammengeschrumpft, und Berger war halbwegs versöhnt. Besser hätte es gar nicht ausgehen können.
Daniels nächster Gang führte ihn auf die Innere. Hier warteten Dr. Alexander Schön, Schwester Sina und Schwester Britta im Dienstzimmer auf ihn.
»Guten Morgen«, wurde er von Britta bestens gelaunt begrüßt. »Das Team Valentina ist vollzählig angetreten.«
»Mehr als vollzählig.« Alexander Schön lehnte sich entspannt auf seinem Stuhl zurück. »Ich gehöre ja eigentlich gar nicht dazu. Für Valentina Beerenburg bin ich der Arzt auf der Ersatzbank, der nur im Notfall tätig wird, wenn der Chefarzt gerade unabkömmlich ist.« Dabei klang er nicht beleidigt, sondern so, als würde ihm diese Nebenrolle sehr gut gefallen.
»Für jemanden auf der Ersatzbank sind Sie aber ganz schön beschäftigt«, erwiderte Daniel. »Immerhin sind Sie es, der im Hintergrund die Fäden in der Hand hält und alle Maßnahmen koordiniert. Mir kommt dann eigentlich nur noch die Aufgabe zu, die Ergebnisse zu präsentieren.«
»Eine sehr bedeutungsvolle Aufgabe bei einer sehr bedeutungsvollen Patientin«, gab Alexander Schön lächelnd zurück. »Wenn Sie die Gespräche mit Frau Beerenburg übernehmen, bleibt mir mehr Zeit für die Patienten, die mich wirklich brauchen. Ich habe also keinen Grund zur Klage.« Schmunzelnd fügte er hinzu: »Und die Verwaltung sicher auch nicht. Ich bin sicher, die Damen und Herren dort sind jedes Mal aufs Neue entzückt, wenn sie Frau Beerenburg im Anschluss die Rechnung schreiben dürfen. Eine völlig gesunde Frau, die jedes Jahr für zehn Tage in die Klinik kommt, um sich gründlich durchchecken zu lassen, das beste Komfortzimmer belegt, auf Chefarztbehandlung und zwei Privatschwestern besteht, sorgt sicher für ein nettes Plus in der Kasse.«
»Von dem wir alle profitieren. Die Familie Beerenburg ist ein wichtiger Unterstützer der Behnisch-Klinik. Viele soziale Projekte sind nur durch die finanzielle Förderung unserer gutbetuchten Privatpatienten möglich.«
Dr. Schön nickte zustimmend und dachte dabei an die zusätzlichen Stationshelfer, die sich um Patienten kümmerten, die keinen Besuch bekamen oder unter Demenz litten und deshalb betreut werden mussten. Ohne das Geld von wohlhabenden Mäzenen und Wohltätern könnte sich die Behnisch-Klinik diesen kleinen, aber sehr hilfreichen Luxus nicht leisten.
Daniel öffnete eine Datei auf seinem Tablet. »Frau Beerenburgs Hausarzt hat mir die letzten Befunde gemailt. Alle Blutwerte sind im Normbereich, und im EKG gibt es keine Auffälligkeiten. Frau Beerenburg erfreut sich bester Gesundheit und möchte das gern von uns bestätigt bekommen. Wir werden also die übliche Diagnostik durchführen, ihr ein paar entspannende Massagen gönnen und sie ein bisschen verwöhnen.« Er wandte sich an die Schwestern. »Für die Massagen schickt die Physiotherapie ihre beste Kraft, die Frau Beerenburg bereits in den vergangenen Jahren behandelt hat. Für das Verwöhnprogramm auf der Station sind Sie beide zuständig. Schwester Sina, für Sie ist es das erste Mal. Es mag sich einfach anhören, in den nächsten zehn Tagen nur für eine einzige Patientin zuständig zu sein. Aber ich verspreche Ihnen, das wird es nicht sein. Nicht nur weil Valentina Beerenburg zu den anspruchsvolleren Patientinnen gehört, sondern weil Sie während dieser Zeit keine freien Tage nehmen können. Im Wechsel mit Schwester Britta werden Sie fünf Tage Frühdienst und fünf Tage Spätdienst hintereinander haben. Ich persönlich finde das nicht gut, aber Frau Beerenburg besteht ausdrücklich darauf, nur von zwei Schwestern betreut zu werden. Ein Wunsch, den ihr leider niemand ausreden konnte. Wie das übrigens mit den meisten Wünschen ist, die Frau Beerenburg hat. Ich bin mir sicher, dass Schwester Britta Sie dazu umfassend in Kenntnis setzen wird.«
Schwester Sina errötete leicht, als nun alle Augen auf sie gerichtet waren. Sie mochte es überhaupt nicht, so im Mittelpunkt zu stehen. Schüchtern meinte sie: »Britta hat mich bereits über viele Dinge informiert. Ich denke, ich bin ganz gut vorbereitet.«
»Sehr gut.« Daniel Norden nickte. »Frau Beerenburg ist eine sehr vitale, agile Achtzigjährige, die sehr viel Aufmerksamkeit fordert. Hier sind also weniger Ihre pflegerischen oder medizinischen Kenntnisse gefragt, sondern vielmehr Ihre menschlichen. Und natürlich Ihre Verschwiegenheit und Diskretion. Aber das wird hoffentlich selbstverständlich sein.«
Mehr als ein stummes Nicken brachte Sina nicht zustande. Bei den letzten Worten des Chefarztes hatte ihre Haut einen intensiven Rotton angenommen, obwohl es dafür keinen Grund gab. Jedenfalls keinen, den sie zu vertreten hatte. Sie wusste, dass sie in diesem Jahr den Platz für Schwester Lore einnahm. Lore hatte sich zusammen mit Britta in den letzten Jahren um Frau Beerenburg gekümmert. Sie war eine der freundlichsten und erfahrensten Schwestern der Behnisch-Klinik – mit einem kleinen, aber entscheidenden Makel: Sie hatte eine unleugbare Schwäche für Klatsch und Tratsch. Etwas, was Frau Beerenburg überhaupt nicht leiden konnte. Sie hatte Lore als zu geschwätzig bezeichnet und um Ersatz gebeten. Natürlich war man diesem Wunsch sofort nachgekommen, auch wenn das bei Lore für reichlich Tränen gesorgt hatte.
Die Wahl war schnell auf die junge Sina gefallen. Sie galt als fleißig, umsichtig und sehr verschwiegen. Allerdings auch als etwas schüchtern. Deshalb waren Daniel Bedenken gekommen, ob Sina der resoluten Valentina Beerenburg überhaupt gewachsen war. Darüber dachte er noch nach, als er längst wieder an seinem Schreibtisch saß. Vor sich eine gut gefüllte Postmappe, die er abarbeiten musste und eine Tasse Kaffee, die ihm seine Assistentin Katja Baumann frisch zubereitet hatte.
Schwester Sina arbeitete erst seit wenigen Monaten an der Behnisch-Klinik. Sie hatte ihre Ausbildung zur Krankenschwester mit Bestnoten abgeschlossen und war bei allen Patienten sehr beliebt. Mit Anfang zwanzig fehlte ihr allerdings die Selbstsicherheit, die den meisten Gleichaltrigen schon längst eigen war. Und während Daniel einen Schluck aus seiner Tasse nahm, dachte er darüber nach, ob er der schüchternen Sina mit einer so dominanten Patientin wie Frau Beerenburg nicht doch zu viel zumutete.
*
Sina ging an diesem Tag mit Herzklopfen nach Hause. Ab morgen würde sie für zehn Tage die Privatschwester einer sehr bedeutenden Dame der Münchner Oberschicht sein. Valentina Beerenburg war die Witwe eines milliardenschweren Großunternehmers, der in den Nachkriegsjahren einen riesigen Konzern aus dem Boden gestampft hatte. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sich Valentina für wohltätige Zwecke engagiert und war dabei ein gern gesehener Gast auf allen roten Teppichen gewesen. Vor einigen Jahren hatte sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Man traf sie nur noch selten bei offiziellen Anlässen. Die Unternehmensleitung lag inzwischen in den Händen ihres einzigen Sohnes Ludwig. Sie würde irgendwann an Valentinas Enkel Vincent übergehen, der schon jetzt, mit 24 Jahren, in der Geschäftsführung mitarbeitete.
Es gab wohl niemanden in München, dem die Unternehmerdynastie Beerenburg kein Begriff war. Selbst Sina, die in einer beschaulichen Kleinstadt im Norden Deutschlands aufgewachsen war, wusste um deren Bedeutung. Neben ihnen kam sich Sina klein und unbedeutend vor. Sie wusste, es gab keinen vernünftigen Grund dafür. Immerhin leistete sie mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag und half kranken Menschen, gesund zu werden und Hoffnung zu schöpfen. Trotzdem konnte sie es nicht verhindern, dass ihr Herz vor Aufregung schneller schlug, wenn sie an den morgigen Tag dachte.
Sina sah sich in ihrem kleinen Einzimmer-Apartment um. Alles war blitzsauber und aufgeräumt. Es gab nichts, was sie tun konnte, um sich abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen. Sie ging zu der alten Kommode hinüber, auf der das gerahmte Bild ihrer Eltern stand. Zärtlich strich sie mit einem Finger darüber. Ihr Vater war vor vielen Jahren bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Ihre Erinnerungen an ihn waren verschwommen, und sie war sich nie sicher, ob sie ihrer Fantasie oder der Wirklichkeit entsprungen waren. Auch ihre Mutter lebte nicht mehr. Sina hatte sie vor fünf Jahren verloren. Es gab nur eine Großtante, zu der Sina selten Kontakt hatte. Sie standen sich nicht besonders nahe. Tante Elfriede hatte nie ein Hehl daraus gemacht, dass ihr an ihrer Großnichte nichts lag. Deshalb hatte es Sina bald aufgegeben, an einer Beziehung festzuhalten, die für beide bedeutungslos war.
Wenn Sina an Valentina Beerenburg dachte, drängte sich ihr das Bild ihrer Großtante Elfriede auf: herrisch, distanziert und immer schlecht gelaunt.
Sina atmete tief durch, um diese Gedanken zu verdrängen. Irgendwie würde sie es schaffen, mit Valentina Beerenburg zurechtzukommen. Und falls nicht, tröstete sie das Wissen, dass nach zehn Tagen alles vorbei wäre.
In dieser Nacht schlief Sina schlecht. In ihren wirren Träumen spielte Valentina Beerenburg – mit Tante Elfriedes Gesicht – eine große und beängstigende Rolle. Im Morgengrauen wurde Sina wach. Übermüdet, aber erleichtert, dass diese Nacht vorbei war, stand sie sofort auf.
»Du machst dir viel zu viele Gedanken«, versuchte Britta, ihre junge Kollegin zu beruhigen, als diese lange vor Dienstbeginn in der Klinik eintraf. »Du wirst sehen, dass Frau Beerenburg gar nicht so schlimm ist, wie du denkst. Als sie vor zwei Stunden ankam, hat sie mich zur Begrüßung sogar umarmt. Ich mag sie. Wir kommen wunderbar miteinander aus, und das wird bei dir auch nicht anders sein.«
»Oder es ergeht mir wie Lore, und ich werde aus ihrer Nähe verbannt.«
Britta musste lachen. »Du doch nicht! Ich bin mir sicher, dass ihr euch gut verstehen werdet. Und Lore …« Sie seufzte auf. »Mich wundert, dass Valentina ihr Verhalten überhaupt so lange geduldet hat. Unsere Lore ist zwar eine Liebe und Nette, aber leider kann sie nichts, was sie aufschnappt, für sich behalten. Du bist da ganz anders, Sina. Allein dafür wird dich unsere Patientin lieben.«
»Wenn du das sagst.« In Sinas Worten klang deutlicher Zweifel mit. Noch war sie nicht überzeugt.
»Freu dich doch einfach auf die Zeit. Du wirst dich danach zurücksehnen, wenn du hier wieder voll im Stress stehst. Genieß es einfach! Das ist fast so schön wie Urlaub.«
»Die Vorstellung, nur für eine einzige Patientin zur Verfügung zu stehen, ist doch absurd.«
»Nicht, wenn diese Patientin bereit ist, dafür einen Haufen Kohle hinzulegen, den die Klinik gut gebrauchen kann und der anderen Patienten, die finanziell schlechter gestellt sind, zugute kommt. Und falls dir langweilig wird und du bei Valentina nichts zu tun hast, kannst du natürlich auch bei den normalen Stationsaufgaben mithelfen. Du musst nur dran denken, dass deine Patientin immer Vorrang hat und du alles liegenlassen musst, sobald sie dich braucht.«
Sina nickte und holte tief Luft. »In Ordnung. Das bekomme ich hin.«
»Sehr gut. Und nun komm mit. Ich stelle dich vor. Und versuch, nicht so ängstlich und verschüchtert auszusehen, sonst verschlingt sie dich sofort mit Haut und Haar.« Als Sina vor Schreck die Augen aufriss, lachte Britta laut auf. »Das war ein Scherz! Sie wird dir schon nichts antun!«
Valentina Beerenburg war im schönsten und größten Komfortzimmer der Behnisch-Klinik untergekommen. Mit einem normalen Patientenzimmer hatte es nicht viel gemein. Stilvolle Möbel mit edlem Holzfurnier, teure Originale an den Wänden und eine elegante Sitzlandschaft erinnerten eher an eine noble Hotelsuite. Es gab sogar eine kleine Pantry und einen Arbeitsbereich mit Schreibplatz und Besprechungstisch.
Valentina Beerenburg saß auf dem Sofa und blätterte in einer Zeitschrift, als die beiden Schwestern das Zimmer betraten. Aus wasserblauen Augen musterte sie Sina interessiert. Freundliche, kluge Augen, die Sina ihre Angst nahmen.
Valentina Beerenburg war eine außergewöhnliche Frau, der niemand ihre achtzig Jahre ansah. Feine Linien um Augen und Mund verrieten ihre Lebenserfahrung, ohne sie betagt erscheinen zu lassen. Ihr kunstvoll frisiertes Haar glänzte in einem warmen Goldton. Es passte perfekt zu dem vornehmen, aristokratisch wirkenden Gesicht mit einer geraden, schmalen Nase und fein geschwungenen Lippen.
»Sie sind also die neue Schwester, die sich zusammen mit Schwester Britta um mich kümmern wird«, sagte Valentina mit einer angenehm warm klingenden Stimme, noch ehe Britta Gelegenheit bekam, Sina vorzustellen. »Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Schwester Sina.«
»Ich freue mich auch, Frau Beerenburg«, erwiderte Sina lächelnd.
»Kommen Sie, setzen Sie sich!« Valentina klopfte auf die Lehne des Sessels, der in ihrer Reichweite stand. »Wir müssen uns doch erst mal ein wenig beschnuppern. Sie müssen mir unbedingt von sich erzählen. Ich bin ja schon so gespannt!« Sie wartete, bis Sina gehorsam, wenn auch zögerlich, Platz genommen hatte, und fragte dann: »Wie sieht’s aus? Trinken Sie einen Kaffee mit mir? Oder lieber einen Tee?«
Sina verschlug es kurz die Sprache. Deshalb sagte Britta schnell: »Kaffee natürlich! Jede Krankenschwester, die etwas auf sich hält, ist ein echter Kaffeejunkie. Wie sollen wir denn sonst einen Nachtdienst überstehen können?«
Valentina lachte. »Das hatte ich mir schon fast gedacht. Also dann, Schwester Britta. Bringen Sie Ihrer Kollegin und mir eine schöne Tasse Kaffee. Das ist dann Ihre letzte Amtshandlung für heute. Machen Sie einfach mal früher Feierabend! Genießen Sie das herrliche Wetter, und unternehmen Sie etwas mit Ihren Kindern!«
»Ihr Wunsch ist mir Befehl!« Britta salutierte scherzhaft und ging dann zur Pantry, in der eine teure Espressomaschine stand. Nur wenig später trug sie ein kleines Tablett mit den Kaffeetassen, Milch und Zucker zum Tisch.
Valentina rümpfte die Nase. »Was ist mit den Keksen? Haben Sie die etwa vergessen?«
»Kommen sofort!« Britta eilte zurück, und Valentina beugte sich zu Sina vor: »Wenn Sie immer dafür sorgen, dass der Kaffee und die Kekse nicht ausgehen, werden wir uns beide blendend verstehen.«
»Ich werde es mir merken.«
»Sehr gut. Dann besteht ja absolut keine Gefahr, dass ich mich über Sie beim Chefarzt beschweren muss.«
Als Sina bei diesen Worten zusammenzuckte, kicherte Britta. »Du darfst nicht alles glauben, was Frau Beerenburg sagt. Sie scherzt sehr gern.«
»Stimmt. Ich gehöre nicht zu denen, die gleich zur höchsten Instanz laufen, um Dampf abzulassen und sich über jede Kleinigkeit zu beschweren.« Valentina griff nach einem Keks. »Ich beschwere mich immer erst, wenn ich wieder zu Hause bin.«
Sina war nun völlig verwirrt. So einer Frau wie Valentina Beerenburg war sie noch nie begegnet. Es gelang ihr einfach nicht, sie einzuschätzen. Wann meinte sie es ernst, wann machte sie einen Scherz?
Hilfesuchend sah sie zu Britta auf, die sich nur mühsam das Lachen verkneifen konnte. »Sehr schlau von Ihnen, mit Ihrer Beschwerde zu warten, bis Sie vor unserer Rache sicher sind.«
»Natürlich bin ich schlau! Was denken Sie denn! Und nun verschwinden Sie endlich, Britta! Ich bin mir sicher, Sie haben etwas Besseres vor, als einer alten Schachtel wie mir Gesellschaft zu leisten.«
»Alte Schachtel? Kokettieren Sie etwa mit Ihrem Alter?«
»Manchmal«, gab Valentina lachend zurück. »Manchmal fühle ich mich aber tatsächlich schon uralt. Das wäre ganz anders, wenn Sie mal wieder mit ihren beiden Kleinen vorbeikommen würden. Eine Stunde mit Ihren Kindern und ich fühle mich, als wäre ich einem Jungbrunnen entstiegen. Wir könnten wieder zusammen in die Cafeteria gehen und Eis essen.«
»Gerne, vielleicht schon morgen. Aber nur, wenn Sie es diesmal nicht übertreiben. Nur eine Kugel Eis für jeden. Mehr nicht!«
Valentina lachte. »Versprochen! Ich freue mich schon! Und nun laufen Sie endlich los. Schwester Sina und ich werden wunderbar miteinander auskommen.«
Sina hatte die zwanglose Unterhaltung zwischen Britta und Valentina Beerenburg aufmerksam verfolgt und war zu dem Schluss gekommen, dass ihre neue Patientin recht hatte: Sie würden tatsächlich wunderbar miteinander auskommen. Sina hätte vor Erleichterung am liebsten aufgelacht. Ihre ganzen Ängste und Sorgen waren völlig umsonst gewesen. Die nächsten zehn Tagen würden wunderschön werden. Sie würde sie genießen, und sie freute sich, in dieser Zeit eine sehr interessante Frau kennenlernen zu dürfen.
*
Als Sina am nächsten Morgen aufstand, war sie bester Stimmung. Sie freute sich auf den Beginn ihres Spätdienstes und darauf, Zeit mit ihrer neuen Patientin verbringen zu dürfen.
Noch vor dem Mittagessen fuhr sie mit dem Fahrrad zur Behnisch-Klinik. Es reizte sie nicht, zu Hause zu bleiben. Der strahlende Sonnenschein lockte sie nach draußen. Bis zu ihrem Dienstbeginn um zwei war genügend Zeit, um sich mit einem guten Buch in den Klinikpark zu setzen. Sie liebte diesen zauberhaften Ort, den Jenny Behnisch, die ehemalige Leiterin der Klinik, angelegt hatte. Jenny Behnisch hatte sich hier mit sehr viel Liebe und Sachverstand eingebracht und ihr Herzblut in die wunderschönen Staudenbeete und prachtvollen Solitärpflanzen gesteckt. So oft es Sina möglich war, zog sie sich hierher zurück und genoss die üppige Blütenpracht und die vielen lauschigen Plätzchen, die für Ruhe und Entspannung sorgten.
Sinas zweite Leidenschaft war das Radfahren. Wann immer es das Wetter zuließ, stieg sie aufs Rad um. Während andere nach dem Dienst auf den Bus warteten, schwang sie sich einfach auf ihr geliebtes Fahrrad und fuhr los. Die Bewegung tat ihr gut. Sie setzte Endorphine frei, die Sina in Hochstimmung versetzten und dafür sorgten, dass sie sich nach einem anstrengenden Dienst besser fühlte. Einen kleinen Regenschauer, der sie plötzlich überraschte, oder ein kräftiger Wind, gegen den sie mühsam ankämpfen musste, nahm sie dafür gern in Kauf. Auch die Mittagssonne, die heute die Temperaturen hochtrieb, hielt sie nicht vorm Radfahren ab. Aber sie brachte Sina ordentlich zum Schwitzen. Deshalb war sie froh, als sie die Klinik erreichte und ihr Rad abstellen konnte. Hier im Schatten war die frühsommerliche Hitze gut zu ertragen, und die Wasserflasche in ihrem Rucksack würde schnell für Linderung sorgen. Sie hatte den Rucksack bereits geöffnet, um sie herauszuholen, als sie angesprochen wurde.
»Ganz schön heiß heute, nicht wahr?«
»Hm«, erwiderte Sina nur und betrachtete den jungen Mann, der sein Sportrad neben ihr in den Fahrradständer schob, aufmerksam. Er war nur wenig älter als sie, recht groß mit einer athletischen Figur, die ihr verriet, dass er viel Sport trieb. Seine dunklen Haare trug er sehr kurz, genau so, wie Sina es mochte. Seine faszinierenden blauen Augen kamen ihr vertraut vor. Sie wusste, sie waren ihr schon einmal begegnet. Es war ein besonderer Farbton, der an klare, tiefgründige Seen erinnerte. Kleine Lachfältchen säumten sie ein, und sein Mund hatte sich zu einem breiten Grinsen verzogen. Er schien sich über irgendetwas prächtig zu amüsieren. Und im nächsten Moment wusste Sina auch, worüber: Sie hatte ihn die ganze Zeit angestarrt.
»Entschuldigung …«, stieß sie hervor und drehte sich hastig weg, um ihr Rad anzuschließen.
»Es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen musst«, sagte er. An seiner Stimme konnte sie hören, dass er lächelte.
Sina wünschte sich, dass ihr jetzt irgendeine originelle Antwort einfallen würde. Doch sie war so befangen, dass ihr Kopf wie leergefegt war. Es brachte nichts, angestrengt nach einer passenden, vielleicht sogar witzigen Bemerkung zu suchen. Für sie würde es keine geben. In solchen Momenten beneidete sie die Menschen, die nie um eine Antwort verlegen waren und stets das Richtige sagten. Sogar, wenn ihnen so ein toller Typ wie dieser gegenüberstand. Ihr gelang das nie. Und darum tat Sina das, was sie immer tat: Sie schwieg und vertraute darauf, dass er sich bald interessanteren Dingen zuwandte und sie schnell vergaß.
»Hast du Probleme mit deinem Schloss? Kann ich dir helfen?«
Warum ging er nicht einfach und ließ sie in Ruhe?
»Nein, alles bestens«, murmelte Sina, tief über ihr Fahrrad gebeugt.
»Sicher? Du brauchst schon eine Ewigkeit, um dein Rad anzuschließen. Vielleicht sollte ich es mal versuchen.«
»Nein!« Endlich richtete sich Sina wieder auf und drehte sich zu ihm um. »Danke, es ist alles in Ordnung«, sagte sie spröde und merkte, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss. Sie hoffte inständig, dass er diesen auffälligen Farbton auf die Hitze schob und nicht auf ihre Verlegenheit. Womöglich fiel er ihm ja auch gar nicht auf.
Er griff an ihr vorbei und zog ihre Wasserflasche aus dem offenen Rucksack. »Du musst etwas trinken.« Er deutete auf ihr Gesicht, während er weitersprach: »Du siehst aus, als wärst du überhitzt und würdest gleich kollabieren. Du bist schon ganz rot.«
»Ich kollabiere schon nicht.« Sina riss ihm die Flasche aus der Hand.
»Mir wäre es trotzdem lieber, wenn du gleich etwas trinkst.« Er zeigte auf ihre Flasche. »Bitte, nur um mich zu beruhigen. Vorher kann ich dich unmöglich allein lassen.«
Sina warf ihm einen ärgerlichen Blick zu, entschied sich aber nachzugeben. Vielleicht würde sie ihn dann endlich loswerden. Je länger er in ihrer Nähe war, umso verlegener wurde sie. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis ihm das auffallen würde.
Sie drehte den Flaschenverschluss ab, nahm einen großen, hastigen Schluck – und verschluckte sich prompt so heftig, dass ihr die Luft wegblieb und ein starker Hustenanfall sie schüttelte. Sofort sprang ihr der junge Mann zur Hilfe. Er nahm ihr die Flasche aus der Hand und klopfte sanft auf ihren Rücken.
Immer noch nach Luft japsend, wehrte ihn Sina ab. »Danke, es geht schon.«
»So klingst du aber nicht«, erwiderte er lachend und machte einfach weiter. Erst als der Husten nachließ und Sina wieder normal atmen konnte, hörte er auf.
»Vielen Dank«, wand sich Sina verlegen. »Es ist mir so peinlich …«
»Quatsch. Dafür gibt es keinen Grund. Ich bin übrigens Vincent.«
»Äh … Sina.«
»Ein schöner Name.« Er sah ihr zu, wie sie ihren Rucksack aus dem Fahrradkorb nahm. Die Aussicht, dass sie ihn hier gleich stehenlassen würde, störte ihn auf einmal. Sie gefiel ihm, ohne dass er es erklären konnte. Sicher, sie war sehr hübsch mit sanften braunen Augen, die den Farbton ihrer dunklen Haare widerspiegelten. Aber es gab viele schöne Mädchen in München. An ihrem Aussehen konnte es also nicht liegen, dass er den übergroßen Wunsch verspürte, sie besser kennenzulernen. »Arbeitest du in der Klinik oder besuchst jemanden?«, versuchte er, den Abschied hinauszuzögern. Doch leider schien sie andere Pläne zu haben.
»Arbeit«, erwiderte sie knapp, ohne ihn anzusehen. »Ich muss los.« Und schon entfernte sie sich mit eiligen Schritten von ihm.
Traurig und ernüchtert schaute er ihr nach. Schade, dass sie kein Interesse daran hatte, ihn näher kennenzulernen. Aber wahrscheinlich gab es längst eine Liebe in ihrem Leben. So ein Mädchen wie sie war bestimmt nicht mehr allein. Vincent hatte immer davon geträumt, dass ihm die Richtige eines Tages einfach über den Weg laufen würde. Sie würden sich sofort unsterblich ineinander verlieben und für immer zusammenbleiben. Seine Traumfrau würde mehr in ihn sehen als den schwerreichen Erben der Beerenburgs. Sie würde ihn lieben und nicht sein dickes Bankkonto. Doch wie konnte er sicher sein, dass es so war? Wie sollte er wissen, ob ein Mädchen, das ihm ihre Liebe gestand, es wirklich ehrlich mit ihm meinte? Angestrengt dachte Vincent darüber nach, während er sein Rad endlich anschloss. Er wusste, er konnte sich dessen nie ganz sicher sein. Mit Sina hätte es anders werden können. Für sie war er nur irgendein Unbekannter, dem sie zufällig begegnet war und den sie sekundenlang sprachlos angestarrt hatte, als würde sie auch diese besondere Verbindung zwischen ihnen spüren. Aber warum hatte sie sich dann so eigentümlich verhalten? Sie war seinem Blick ständig ausgewichen und hatte kaum ein Wort gesprochen. War er ihr egal oder war sie nur ein wenig schüchtern? Vincent ärgerte sich, dass er sich nicht die Mühe gemacht hatte, das herauszufinden. Beim nächsten Mal würde er …
»Blödsinn«, murmelte er plötzlich und rannte in die Klinik. Er hatte nicht vor, so lange zu warten, bis sie der Zufall wieder zusammenführen würde. Wenn er sich jetzt beeilte, konnte er sie vielleicht noch einholen.
*
Valentina Beerenburg hatte als junge Frau von einer großen Schar eigener Kinder geträumt. Doch leider hatte sich dieser Wunsch nicht erfüllt. Ludwig blieb das einzige Kind, dem sie das Leben schenken durfte. Sie war dankbar dafür, wusste sie doch, dass es viele Frauen gab, die es ungleich schwerer traf und die nie erfuhren, was Mutterglück bedeutete. Deshalb hatte sie nie mit ihrem Schicksal gehadert und sich an dem, was sie hatte, erfreut. Und spätestens mit der Geburt Vincents, ihres einzigen und heißgeliebten Enkels, fühlte sie sich gesegnet und reich beschenkt.
Die Verbindung zwischen ihr und Vincent war eng und liebevoll. Für ihn war es daher selbstverständlich, seine Großmutter in der Behnisch-Klinik zu besuchen und ihr ein wenig die Zeit zu vertreiben.
»Gibt es schon Befunde? Hat Dr. Norden schon mit dir gesprochen?«
»Dr. Norden spricht mehrmals am Tag mit mir«, erwiderte Valentina belustigt. »Und Befunde gibt es natürlich noch keine. Ich bin erst seit gestern hier. Das dauert alles seine Zeit.«
»Ja, natürlich. Ich hoffe nur, dass alles in Ordnung ist und …«
»Du nicht auch noch!« Unwirsch unterbrach sie ihn. Eine steile Falte erschien zwischen ihren Brauen, als sie fortfuhr: »Du benimmst dich schon genauso albern wie dein Vater. Ihr macht euch viel zu viele Sorgen um mich. Mir geht es blendend, und dieser Aufenthalt hier ist völlig unnötig.«
»Unnötig?« Vincent sah verwundert auf. »Aber warum kommst du dann jedes Jahr her?«
Valentina seufzte auf. »Weil dein Vater sonst gar keine Ruhe geben würde. Nur wenn ihm Dr. Norden schwarz auf weiß bescheinigt, dass ich mich bester Gesundheit erfreue, kann er es glauben. Das ist der einzige Grund, warum ich mich seit zehn Jahren regelmäßig hierher begebe.« Valentinas Unmut war verflogen, als sie ihrem Enkel gut gelaunt zuzwinkerte. »Außerdem genieße ich diese zehn Tage inzwischen sogar. Die meisten Schwestern kenne ich so gut, dass es mir vorkommt, als würde ich alte Bekannte wiedertreffen. Ich liebe diese kleinen Schwätzchen mit ihnen und lasse mich auch gern mal verwöhnen. Außerdem weiß ich, dass es dem Klinikhaushalt gut bekommt, wenn ein paar Privatpatienten wie ich für volle Kassen sorgen.«
»Eine Spende hätte es auch getan«, erwiderte Vincent grinsend.
»Ja, aber so macht mir das viel mehr Spaß. Und eine großzügige Spende gibt es zu Weihnachten noch obendrauf.« Valentina betrachtete ihren Enkel lächelnd. »Und nun hören wir endlich auf, von mir zu reden. Sag mir lieber, was es bei dir Neues gibt! Wann stellst du mir endlich ein Mädchen vor, das du wirklich liebst?«
»Ach, Omi, sobald mir eins begegnet, für das das zutrifft, bist du doch die Erste, die es erfährt. Aber bisher hat das noch nicht geklappt. Obwohl …«
»Obwohl?« Valentina beugte sich aufgeregt vor. »Warum sprichst du nicht weiter? Komm, lass mich nicht betteln!«
Vincent lachte. »Es gibt niemanden. Obwohl …« Er machte wieder eine Pause und ließ seine Großmutter zappeln, bis sie ihm scherzhaft mit dem Finger drohte.
»Wenn du noch einmal obwohl sagst, bekommst du einen Riesenärger, mein Freundchen!«
»Mein Freundchen? So hast du mich früher nur genannt, wenn ich etwas ausgefressen hatte.«
»Hören wir auf, von früher zu reden. Sag mir jetzt endlich, was los ist! Hast du dich verliebt?«
»Nein, tut mir leid, dich zu enttäuschen. Allerdings bin ich vorhin einem Mädchen begegnet, bei dem ich mir sehr gut vorstellen konnte, dass sie die Richtige ist.«
»Und? Wo ist sie? Warum hast du sie nicht gleich mitgebracht? Du hast sie doch hoffentlich nicht einfach gehen lassen!«
Vincent verzog den Mund. »Was blieb mir denn anderes übrig? Das Interesse war leider nur einseitig. Sie hat kaum mit mir gesprochen und ist mir am Ende einfach davongelaufen.«
»Na und? Du gibst doch sonst nicht so schnell auf! Du hättest ihr hinterherlaufen sollen!«
»Hab‘ ich doch. Aber dummerweise zu spät. Als ich in die Klinik kam, war sie schon verschwunden. Ich bin noch eine Weile umher gelaufen und habe sie gesucht. Aber ohne Erfolg. Sie war weg.«
»Hier in der Klinik, sagst du?«
»Ja, sie arbeitet hier. Die Chancen stehen also gar nicht schlecht, dass ich ihr doch noch mal begegne. Wenn das Schicksal es wirklich will …«
»Papperlapapp«, winkte Valentina ungeduldig ab. »Wenn ich nur dem Schicksal vertraut hätte, würde es dich wahrscheinlich gar nicht geben, mein Lieber. Du musst schon selbst aktiv werden.«
Sie stand auf und ging im Zimmer umher, während sie laut nachdachte: »Wir werden uns am besten mit Dr. Norden zusammensetzen. Du versuchst, das Mädchen so genau wie möglich zu beschreiben, und Dr. Norden muss dann schauen, auf welche Mitarbeiterin deine Beschreibung zutrifft. Das dürfte doch gar nicht so schwer sein. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir wenigstens einen Namen hätten oder …«
»Sina«, fiel ihr Vincent ins Wort. »Sie heißt Sina.«
Valentina blieb am Fenster stehen und sah ihn erstaunt an. Sollte etwa ihre Schwester Sina das Herz ihres Enkels berührt haben? Möglich wäre es durchaus. Sie war ein wunderschönes, liebes Mädchen. Ein wenig unsicher und schüchtern, doch das machte sie umso liebenswerter. Die Möglichkeit, dass Sina mit ihrem Enkel zusammenkam, gefiel ihr ausgesprochen gut. Aber vielleicht ging es ja gar nicht um ihre Sina. Wie häufig war dieser Name eigentlich?
»Ein Penny für deine Gedanken«, sagte Vincent schmunzelnd. »Du siehst aus, als würdest du gerade einen Plan aushecken.«
»Ich würde es nicht unbedingt einen Plan nennen, aber …« Sie stoppte mitten im Satz, als sie aus dem Fenster sah. Ihr bot sich ein herrlicher Blick auf den Klinikpark.
»Sag mal, Vince, wie sieht deine Sina eigentlich aus?«
»Meine Sina? So weit bin ich bei ihr noch lange nicht.«
Valentina winkte ab, die Augen starr nach draußen gerichtet. »Das ist doch nur noch eine Frage der Zeit. Hat deine Sina einen dunkelbraunen Zopf, ist sehr hübsch und trägt heute eine weiße, ärmellose Bluse?«
Neugierig geworden trat Vincent zu seiner Großmutter ans Fenster. Und da sah er sie. Das Mädchen, das ihm seit ihrer Begegnung nicht mehr aus dem Kopf ging, saß auf einer Bank im Schatten eines Baumes und las in einem Buch.
»Das ist sie«, rief er überrascht aus. »Woher hast du das gewusst?«
»Gewusst nicht, aber vermutet und gehofft. Sina ist eine der beiden Krankenschwestern, die sich hier um mich kümmern. Ich muss sagen, du hast einen exzellenten Geschmack, mein Lieber. Sie ist wirklich etwas Besonderes.«
Vincent grinste spöttisch. »Dann habe ich also deinen Segen?«
»Als ob es dir darauf ankäme.« Liebevoll knuffte sie ihm in den Oberarm. »Ihr jungen Leute habt doch euren eigenen Kopf und macht was ihr wollt. Auf meinen Rat würdest du doch eh nicht hören, jedenfalls nicht in Herzensangelegenheiten.«
Vincent setzte zu einer Erwiderung an, aber Valentina fiel ihm ins Wort: »Und das ist auch gut so. Jeder sollte nur auf sein Herz hören und nicht auf die Meinung anderer.«
»Welch weise Worte«, sagte Vincent und zog Valentina in seine Arme. »Dafür hast du dir einen Kuss verdient.«
Valentina Beerenburg wehrte ihren Enkel lachend ab, als er es mit der herzlichen Umarmung etwas übertrieb. »Schon gut, schon gut. Sieh lieber zu, dass du zu deiner Angebeteten in den Park kommst. Oder du wartest einfach hier, bis sie ihren Dienst antritt. Ich freue mich schon auf ihr überraschtes Gesicht, wenn sie dich bei mir sieht.«
»Ich weiß nicht so recht …« Vincent wurde plötzlich ernst. »Vielleicht ist es ganz gut, wenn sie mich hier nicht trifft. Ich würde gern mein Glück bei ihr versuchen, ohne dass sie weiß, wer ich bin.«
»Natürlich.« Valentina lächelte ihren Enkel verständnisvoll an. Sie wusste, warum ihm das so wichtig war. »Du kannst dich auf mich verlassen, Vince. Ich werde nichts verraten. Und nun geh endlich und leiste ihr Gesellschaft, bevor sie dir wieder wegläuft.«
»Drück mir die Daumen, Omi.«
»Das wird nicht nötig sein. Sei einfach du selbst und hab etwas Geduld mit Sina. Ich glaube, sie ist ein wenig unsicher und schüchtern.«
»Danke, Omi, für den Tipp. Ich werde mir Mühe geben.« Vincent war schon fast aus dem Zimmer raus, als er innehielt. »Ach, Omi, bitte tu mir den Gefallen und beobachte uns nicht von deinem Logenplatz aus.«
Valentina riss entrüstet die Augen auf. »Was denkst du nur von mir?«
»Nur das Beste. Das weißt du hoffentlich«, gab Vincent grinsend zurück. »Allerdings kenne ich deine unstillbare Neugier und deinen Drang, dich überall einzumischen.«
»Frechheit!«, rief Valentina ihrem Enkel hinterher. Dann beeilte sie sich, den schweren Sessel so ans Fenster zu schieben, dass es ihr möglich war, alles im Blick zu haben, ohne entdeckt zu werden.
*
Sina liebte die kleine Bank im Schatten der hochgewachsenen, ausladenden Kornelkirsche. Hier saß sie am liebsten, wenn sie nach einem anstrengenden Dienst abschalten wollte oder einfach Sehnsucht nach einem idyllischen, friedlichen Ort hatte. Die vielfältige Pflanzenpracht um sie herum, der betörende Duft von Blüten und Nektar und der Gesang der Vögel schafften es immer wieder, Kraft zu spenden oder trübe Gedanken zu verscheuchen. Selten fand man sie hier ohne ein Buch in den Händen, das sie fesselte und in ferne Welten oder romantische Liebesabenteuer entführte. Doch heute war es anders. Ihre Augen fest auf die schwarzen Buchstaben geheftet, war sie trotzdem unfähig, auch nur ein Wort aufzunehmen. Ihre Lektüre schaffte es nicht, sie auf andere Gedanken zu bringen und von dem abzulenken, was sie beschäftigte. Ständig musste sie an ihre Begegnung mit Vincent zurückdenken. Schritt für Schritt ging sie sie in allen Einzelheiten durch. Sie hatte sein Interesse gespürt, sie hatte es aus seinen Worten herausgehört und in seiner Mimik und den Augen gesehen. Wenn … ja, wenn sie nur ein klein wenig mutiger gewesen wäre, hätte mehr daraus werden können als eine flüchtige Begegnung, die schnell wieder in Vergessenheit geraten würde. Obwohl das für sie nicht zutraf. Ihr würde es nicht so bald gelingen, sein Lächeln aus ihrem Kopf zu bekommen.
Ihre Schüchternheit war ihr schon oft zum Verhängnis geworden. Bereits als ganz kleines Mädchen hatte sie eine unerklärliche Angst vor allem Fremden gehabt. Sie war nie so mutig gewesen wie ihre Freundinnen, die ohne Scheu Neues ausprobierten und mit jedem sofort ins Gespräch kamen. Es war nicht so, dass Sina sich gar nichts zutraute oder extrem kontaktscheu war. Es dauerte einfach nur ein bisschen länger, bis sie völlig unbefangen mit einer neuen Situation oder fremden Menschen umgehen konnte. Auf der Arbeit kannte sie dieses Problem glücklicherweise nicht. Die Patienten waren auf ihre Hilfe, ihren Zuspruch und Trost angewiesen. Es bereitete ihr überhaupt keine Schwierigkeiten, ihnen diesen zu geben. Sie tat es gern und immer aus vollem Herzen. Hier war es nicht wichtig, etwas von sich preiszugeben und zu offenbaren. Hier kam es nur darauf an, für andere da zu sein. Und das konnte sie besser als viele ihrer Kolleginnen. Doch wenn es galt, im privaten Umfeld mit einem Mann ins Gespräch zu kommen oder gar mit ihm zu flirten, versagte sie regelmäßig. Sie kam sich unbeholfen und linkisch vor und hatte schreckliche Angst, etwas Dummes zu sagen und sich unsterblich zu blamieren. Die meisten Männer machten sich nicht die Mühe abzuwarten, bis sie auftaute und mutiger wurde. Sie verloren schnell das Interesse an der zurückhaltenden Sina und wandten sich anderen Frauen zu. Die Enttäuschung, die sie dann verspürte, tat jedes Mal entsetzlich weh. Deshalb hatte sie gelernt, diesen deprimierenden Erfahrungen aus dem Weg zu gehen und sich an einen friedlichen Ort wie diesen zurückzuziehen.
»Es ist schön, dich hier wiederzusehen.«
Sina schreckte so hastig auf, dass ihr das Buch aus den Händen glitt.
»Hoppla«, rief Vincent lachend und hob es auf, bevor Sina überhaupt reagieren konnte. »Lyrik«, sagte er nachdenklich, als er den Einband sah. »Das ist schade.«
»Warum?«, fragte Sina zurück und ärgerte sich, dass sie dabei so zickig klang.
»Du bist vorhin so schnell verschwunden. Ich hatte angenommen, dass du dringend zur Arbeit musst. Was offensichtlich ein Irrtum war, denn du sitzt ja hier. Also muss es wohl an mir gelegen haben. Dann sehe ich das Buch in deinen Händen und bin erleichtert. Vielleicht ist es ja ein besonders spannender Thriller, den du unbedingt weiterlesen musstest oder eine herzzerreißende Liebesgeschichte, die dich nicht mehr loslässt.« Er seufzte übertrieben laut auf. »Aber ein Gedichtband? Nun gibt es keine Zweifel mehr. Ich habe dich vorhin vertrieben. Stimmt‘s?«
»Ich … nein …« Hilflos zuckte Sina die Schultern. Sie hatte keine Ahnung, was sie dazu sagen sollte. Er scherzte, das wusste sie. Trotzdem erwartete er eine Antwort von ihr. Sollte sie alles abstreiten oder ihm recht gebe? Oder ihm sagen, dass es ihn überhaupt nichts angeht, was sie hier tat oder welches Buch sie las? Doch nichts davon schaffte es über ihre Lippen. Wie so oft in ihrem Leben fehlten ihr die richtigen Worte. Ihr blieb nur, sich über ihre Sprachlosigkeit zu ärgern und tatenlos zuzusehen, wie dieser nette Mann gleich die Flucht antreten würde.
Vincent reichte ihr das Buch zurück. »Hast du etwas dagegen, wenn ich mich zu dir setze?« Er wartete ihre Antwort nicht ab, sondern nahm einfach Platz, während er munter weitersprach: »Es ist wirklich wunderschön hier. Ich war schon so oft in der Behnisch-Klinik und habe mir nie den Park angesehen. Erst jetzt wird mir klar, was ich versäumt habe.« Er streckte die langen Beine aus und sah sich um. »Leider habe ich von Blumen überhaupt keine Ahnung. Die Rosen dort drüben erkenne ich, aber dann hört’s auch schon auf bei mir.«
Je länger er sprach, umso entspannter wurde Sina. Sie fühlte sich nicht unter Druck gesetzt. Er erwartete nicht, dass sie ihm geistreich antwortete. Er redete einfach immer weiter, und mit jedem Wort, das er sagte, schwand Sinas Schüchternheit. Als er schließlich eine kurze Pause machte, war ihre Angst fast vollständig verschwunden.
»Es tut mir leid«, sagte sie. »Ich wollte dich nicht verletzen, es … es fällt mir sehr schwer, mit Menschen zu reden, die mir fremd sind.«
Vincent nickte, als wüsste er genau, wovon sie sprach. »Dann sollten wir dafür sorgen, dass wir uns endlich kennenlernen und uns vorstellen. Hast du etwas dagegen, wenn ich anfange? Nein? Also dann: Ich bin Vincent, vierundzwanzig Jahre alt, in München geboren und aufgewachsen. Ich habe einen Master in Wirtschaftswissenschaften und arbeite seitdem in der Firma meines Vaters mit, obwohl ich mir immer sicher war, dass das nichts für mich wäre. Ich wollte etwas Eigenes aufbauen, unabhängig sein, vielleicht irgendwo im Ausland leben.«
»Und trotzdem bist du hier«, sagte Sina leise.
»Ja, ich hänge einfach zu sehr an meiner Familie und bekomme schnell Heimweh, wenn ich unterwegs bin.« Er grinste sie schief an. »Klingt nicht besonders männlich, nicht wahr?«
»Es klingt so, als würdest du deine Familie wirklich sehr lieben. Mir gefällt das.«
»Tatsächlich? Toll!«
»Lebst du noch bei deinen Eltern?« Sina wunderte sich, wie leicht es ihr plötzlich fiel, mit ihm zu plaudern.
Vincent schüttelte den Kopf. »Nein, ich hatte mir während des Studiums eine kleine Wohnung in der Nähe der Uni gemietet. Sehr, sehr klein. Fast schon winzig und ohne jeglichen Komfort. Aber die Nähe zur Uni hatte mich damals überzeugt. Für die paar Jahre wird’s schon reichen, sagte ich mir damals. Und nun? Ich habe sie immer noch. Mir gefällt es dort, und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, sie jemals aufzugeben.«
»Das kann ich gut verstehen. Deine Wohnung ist zu deinem Zuhause geworden. Und ein Zuhause ist nicht austauschbar wie ein Paar Schuhe.«
»Ja! Das sehe ich ganz genauso!«
In der nächsten halben Stunde unterhielten sie sich, lachten zusammen und fühlten den wunderbaren Zauber, der in dieser Begegnung lag.
Irgendwann sagte Sina mit Bedauern: »Ich muss jetzt leider los. Mein Dienst beginnt gleich.«
Als Vincent sie angrinste, ergänzte sie lächelnd: »Diesmal wirklich.« Sie reichte ihm die Hand. »Es war schön, dich kennenzulernen, Vincent.«
»Ich würde das gern fortsetzen, Sina.« Er hielt ihre Hand weiterhin fest und sah sie bittend an. »Lass uns morgen Abend etwas unternehmen. Oder wir treffen uns am Nachmittag und gehen zusammen einen Kaffee trinken oder spazieren.«
»In den nächsten Tagen habe ich bis um zehn Spätdienst. Ab Samstag bin ich mit Frühdienst dran. Dann hätte ich auch mal am Abend Zeit.«
Vincent lachte glücklich auf. Er würde sie wiedersehen. Doch bis zum Wochenende konnte er unmöglich warten.
»Samstagabend klingt sehr gut. Ich freu mich darauf. Aber könnte es sein, dass du morgen Mittag wieder hier bist? So gegen zwölf? Auf dieser Bank?«
Sina lächelte. »Ja, das wäre durchaus möglich. Eigentlich ist es sogar ziemlich sicher. Ich liebe diese Bank.«
»Ich jetzt auch.«
*
Seit einigen Tagen fuhr Christina Rohde als Notärztin auf einem Rettungswagen mit. Ihr ständiger Begleiter, Fahrer und Sanitäter war Jens Wiener, dem sie schon oft begegnet war, wenn er Patienten in die Behnisch-Klinik gebracht hatte. Doch auf einem Rettungswagen – zumindest auf dem von Jens Wiener – herrschten andere Regeln als in einem Krankenhaus. Strenge Hierarchien gab es hier nicht, und der Umgangston war insgesamt formlos und locker.
»Übrigens«, hatte Jens gesagt, als sie zu ihrem ersten gemeinsamen Einsatz aufgebrochen waren. »Auf dem Wagen duzen wir uns. Kommst du damit klar?« Dabei hatte er sie aufmerksam gemustert, und Christina hatte gewusst, dass ihre Antwort die Zusammenarbeit in den nächsten beiden Wochen bestimmen würde.
»Warum nicht?«, hatte sie achselzuckend und betont beiläufig erwidert. »Ich bin Christina.«
In diesem Augenblick war das Eis zerbrochen, und einer guten Partnerschaft hatte nichts mehr im Wege gestanden.
Sie waren ein großartiges Team, wie Christina schnell feststellte. Bei der Versorgung der Notfälle ging ihr der erfahrene Rettungssanitäter kompetent und ruhig zur Hand. Sie wusste, sie konnte sich auf ihn jederzeit hundertprozentig verlassen.
Ihr gefiel die Arbeit, die niemals eintönig und langweilig wurde und sie oft vor große Herausforderungen stellte. Nicht immer ging es dabei um Leben und Tod. So wie bei ihrem aktuellen Fall, den sie gerade in die Behnisch-Klinik brachten.
Christina prüfte noch mal den Blutdruck ihres Patienten. »Alles bestens«, beruhigte sie ihn. »Ihre Werte sind in Ordnung. In wenigen Minuten kommen wir in der Behnisch-Klinik an. Dort wird man sich gut um Sie kümmern.«
Jens Wiener fuhr durch ein kleines Schlagloch, das er zu spät gesehen hatte. Sofort stieß der Mann auf der Trage einen jammervollen Laut aus und krümmte sich vor Schmerzen.
»Tut mir leid«, rief Jens durch die offene Glasscheibe in das Wageninnere.
»Das Schmerzmittel wirkt sicher bald.« Christina streichelte dem Mann mitfühlend die Hand. »Halten Sie noch ein bisschen durch. In Null-Komma-Nichts sind Sie Ihren entzündeten Blinddarm los, und dann wird es Ihnen schnell besser gehen.«
Christina richtete sich auf, um an Jens vorbei durch die Windschutzscheibe zu sehen. »Die Klinik ist in Sicht, Sie haben es fast geschafft.«
Nur wenig später kamen sie in der Notaufnahme an.
»Paul Hildebrandt, dreiundzwanzig, Verdacht auf akute Appendizitis«, rief sie Erik Berger zu, als er ihnen auf dem Flur entgegeneilte.
Auf den Weg in einen Behandlungsraum stellte sich Erik dem jungen Mann vor und erklärte dann: »Wir werden Sie zuerst gründlich untersuchen, um den Grund für Ihre Beschwerden herauszufinden.«
»Frau Doktor weiß das schon«, erwiderte Paul mit schmerzverzerrtem Gesicht. »Es ist der Blinddarm.«
»Frau Doktor nimmt an, dass es der Blinddarm ist«, stellte Berger richtig. »Für eine feste Diagnose entscheiden wir uns nach Abschluss der Untersuchung. Die stellen wir nicht in einem Rettungswagen.«
Christina rollte mit den Augen. »Natürlich nicht, Herr Berger.« Dann wies sie an: »Also dann: ein großes Blutbild, Urinstatus und Sonografie.«
Sie hatte Schwester Anna angesprochen, doch die rührte sich nicht, sondern warf nur einen unsicheren Blick auf Erik Berger. Gefährlich langsam drehte der sich zu Christina um. »Sagt wer?«, fragte er in einem Ton, der die Raumtemperatur merklich senkte.
»Sagt wer?«, wiederholte sie spöttisch. »Eine Fachärztin für Chirurgie, die weiß, wovon sie redet und was sie tut.«
»Aber nicht in meiner Aufnahme!«, donnerte Berger nun los. »Sobald Sie den Patienten in die Aufnahme bringen, bin ich der behandelnde Arzt und nicht Sie.«
»Seien Sie doch nicht albern! Ich bin Chirurgin und weiß am besten …«
»Irrtum, heute sind Sie nur eine Praktikantin, die auf einem Rettungswagen mitfährt. Also halten Sie endlich Ihren Mund, wie es alle folgsamen Praktikanten tun. Oder noch besser: Verschwinden Sie endlich.«
Christina wollte ihm gerade ordentlich die Meinung sagen, als ihr Jens einen Arm um die Schultern legte und sie sanft, aber bestimmt, in Richtung Tür schob. »Unsere Arbeit hier ist getan«, sagte er ruhig, und ehe Christina wusste, wie ihr geschah, stand sie auch schon auf der anderen Seite der Tür.
»Was sollte das denn?«, fauchte sie ihn aufgebracht an. »Du kannst mich doch nicht einfach da rauszerren, wenn Berger mal wieder einen auf tollwütigen Foxterrier macht.«
»Hör auf zu übertreiben. So schlimm war er gar nicht. Du hingegen …« Er zog die Augenbrauen hoch und sah sie bedeutungsvoll an.
»Was denn?«, gab Christina leise knurrend, aber gemäßigter zurück. »Ich kann mir doch nicht alles von ihm gefallen lassen. Er hat meine Diagnose vor dem Patienten infrage gestellt und mich dadurch lächerlich gemacht.«
Jens seufzte. »Er hat lediglich gesagt, dass weitere Untersuchungen gemacht werden müssen, bis zur sicheren Diagnosestellung. Das ist doch das normale Prozedere. Der Notarzt im Rettungsdienst stellt üblicherweise nur die Verdachtsdiagnose. Alles andere passiert in der Klinik. Und das ist dann nicht mehr unsere Aufgabe. Auf gar keinen Fall sagen wir hier, welche Untersuchungen gemacht werden sollen. Mit der Übergabe des Patienten ist unsere Arbeit getan. Du hast doch auch schon in der Aufnahme gearbeitet. Stell dir vor, jeder Notarzt, der dir einen Patienten bringt, würde dir sagen, was du zu machen hast. Du würdest – genau wie Berger – an die Decke gehen und ihm gehörig die Meinung sagen.«
»Vielleicht auch nicht!«, behauptete Christina kleinlaut, glaubte aber selbst nicht, was sie sagte. Und Jens Wiener erst recht nicht, wie sie an seinem frechen Grinsen feststellte. Sie drehte sich um und ging zum Ausgang. »Berger hat Schuld. Er hat angefangen!«
Hinter ihr lachte Jens laut auf. »Willkommen im Kindergarten, Frau Doktor!«
*
Es gab niemanden auf der Inneren, dem nicht auffiel, wie glücklich Sina seit einigen Tagen war. Das Lächeln in ihrem Gesicht brachte ihre Augen zum Leuchten. Sie war frisch verliebt, und alle sahen ihr das an. Heute war ihr letzter Spätdienst. Morgen würde sie Vincent wiedersehen – wie an jedem Tag, seit sie ihn kannte. Sie hatten sich immer mittags im Park getroffen. Am ersten Tag hatte Vincent einen prall gefüllten Picknickkorb mitgebracht, am nächsten Tag waren sie in die Cafeteria gegangen. Ihnen blieben zwei Stunden, um zu reden, zu lachen und Blicke zu tauschen, die mehr verrieten, als es Wörter vermocht hätten.
Sina zweifelte nicht an ihren starken Gefühlen für Vincent. Und sie war ihm auch nicht gleichgültig, obwohl er noch nicht von Liebe gesprochen hatte. Doch wenn er sie ansah, wusste sie es einfach.
Morgen Abend wollten sie ins Kino gehen und anschließend zum Essen in ein Restaurant. Es würde eine richtige Verabredung sein, die nichts mehr mit ihren zwanglosen Zusammentreffen im Klinikpark zu tun hatte. Morgen Abend würde sich alles ändern.
»Sie strahlen ja förmlich, meine Liebe«, wurde sie von Valentina Beerenburg begrüßt, als sie zu ihr ins Zimmer kam. »Ich glaube, hier ist jemand sehr verliebt.«
»Nein …«, stritt Sina das sofort verlegen ab. Aber dann lachte sie. »Sie haben recht, Frau Beerenburg, das bin ich. Ich bin verliebt.«
»Wie schön! Erzählen Sie mir von ihm! Wer ist der Glückliche?«
»Der Glückliche weiß noch gar nichts von seinem Glück.« Sina seufzte und überlegte, ob Valentina wirklich die passende Gesprächspartnerin für diese Art von Unterhaltung war. Doch dann zuckte sie die Schultern. Warum eigentlich nicht? Sie war nicht irgendeine Patientin der Behnisch-Klinik. Sie war die Frau, mit der Sina etliche Stunden am Tag verbrachte und der sie sich nah fühlte wie keiner anderen Patientin bisher. Über das Stadium, das sie nur von dienstlichen Dingen sprachen, waren sie längst hinaus. Seit Valentina Beerenburg sie an ihrem ersten Tag aufgefordert hatte, von sich zu erzählen, fühlte sich Sina sonderbar verbunden mit ihr. Es kam ihr deshalb falsch vor, sie nicht an diesen wunderbaren Neuigkeiten in ihrem Leben teilhaben zu lassen.
»Ich habe ihn erst vor drei Tagen kennengelernt.« Sina setzte sich zu Valentina. »Seitdem haben wir uns jeden Mittag vor meinem Spätdienst getroffen. Ich weiß, wie merkwürdig sich das für Sie anhören muss, wenn ich schon nach so kurzer Zeit von Liebe rede.«
Valentina lächelte sie warm an. »In meinen Ohren hört sich das überhaupt nicht merkwürdig an. Warum soll es merkwürdig sein zu wissen, dass einem der Richtige begegnet ist? Es ist doch schön, wenn es keine Zweifel gibt. Manchmal schlägt die Liebe eben wie ein Blitz ein und muss nicht langsam wachsen.« Sie langte über den Tisch und drückte Sinas Hand. »Ich freue mich von Herzen für Sie«, sagte sie mit belegter Stimme. »Und natürlich auch für den jungen Mann. Er darf sich glücklich schätzen, Ihr Herz erobert zu haben.«
Sina kam nicht mehr dazu, darauf antworten. Es klopfte an der Tür, und nach Valentinas gebieterischem Herein öffnete Ludwig Beerenburg, Valentinas Sohn, die Tür. Er begrüßte zuerst Sina mit einem freundlichen Lächeln. Dann gab er seiner Mutter einen Kuss auf die Wange. Sina zog sich sofort zurück, um nicht zu stören. Sie wusste, wie sehr Valentina die gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn genoss. Er kam jeden Tag vorbei, um nach ihr zu sehen, und brachte stets frische Blumen oder Konfekt mit. Das Verhältnis von Mutter und Sohn war innig und herzlich, und Sina kamen manchmal vor Rührung die Tränen, wenn sie erlebte, wie besorgt Ludwig Beerenburg um seine Mutter war.
Sina wollte gerade in den Pausenraum gehen, um sich einen Kaffee zu gönnen, als sich die Fahrstuhltüren öffneten. Vor Schreck blieb sie stehen und vergaß für einen Moment das Luftholen, als sie sah, dass Vincent aus dem Fahrstuhl trat. Was machte er hier? Wollte er etwa zu ihr?
Schnell eilte sie zu ihm, griff nach seinem Arm und zog ihn mit sich in den Pausenraum. Im Spätdienst waren nur wenige Schwestern im Dienst, sodass sie dort allein waren.
»Vincent, ich bin im Dienst und habe nicht viel Zeit für dich.«
»Das weiß ich, Sina.« Er wirkte angespannt, fast bedrückt, und sofort schoben sich dunkle Gewitterwolken in Sinas strahlend blauen Himmel. »Ich muss unbedingt mit dir reden. Es ist wirklich sehr wichtig.«
»Okay«, erwiderte Sina gedehnt. Vincent benahm sich anders als sonst. Irgendetwas bedrückte ihn. Und dass es mit ihr zu tun hatte, machte ihr Angst. War ihr Traum von der großen Liebe etwa vorbei, noch ehe er begonnen hatte?
»Ist es so wichtig, dass du nicht bis morgen warten kannst?«, fragte sie nervös.
»Ich muss das unbedingt heute loswerden, Sina.« Er griff nach ihrer Hand. »Du hast mich nie gefragt, warum ich damals, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, in der Behnisch-Klinik war.«
Sina überlegte kurz. »Das habe ich tatsächlich nicht. Aber warum spielt das plötzlich eine Rolle?« Als ihr ein möglicher Grund dafür einfiel, erschrak sie. Sina musste erst die Angst hinunterschlucken, bevor sie weitersprechen konnte: »Du … du bist doch nicht krank, oder?«
»Nein! Nein, das ist es nicht. Ich bin gesund, mir fehlt nichts. Ich war hier, weil ich jemanden besucht habe.«
»Deine Freundin? Frau?«, fragte sie spröde.
Vincent lachte leise. Doch er wurde schnell wieder ernst. »Nein, meine Oma. Ich habe meine Oma besucht. Du kennst sie übrigens sehr gut. Sie heißt …«
»Valentina Beerenburg!«, rief Sina. Jetzt wusste sie auch, warum ihr Vincents blaue Augen so vertraut waren. Es waren die gleichen Augen wie Valentinas.
Als er nur stumm nickte, fragte Sina verwirrt: »Aber ich verstehe nicht, warum du so ein Geheimnis daraus gemacht hast. Du hättest es mir sagen müssen!«
»Ja, vielleicht, aber ich wollte sicher sein, dass du in mir nicht nur einen Beerenburg siehst.«
»Einen Beerenburg? Wie meinst du das?« Dann verstand sie. Empört fuhr sie ihn an: »Du hattest Angst, dass ich nur auf dein Geld aus wäre? Wie kannst du so etwas von mir denken? Wenn ich mich in einen Mann verliebe, frage ich doch nicht nach seinem Kontostand!« Sie wollte ihm noch mehr sagen, aber Vincent zog sie einfach in seine Arme und küsste sie. Das kam so überraschend, dass sie einen Moment wie erstarrt war. Doch dann erwiderte sie seinen Kuss. Sie vergaß ihren Ärger über seine Zweifel. Sie vergaß alles um sich herum. Für sie gab es nur noch diesen besonderen Moment in den Armen des Mannes, den sie liebte. Als sie sich endlich voneinander trennen konnten, sah sie ihn überrascht an. »Du hast mich einfach geküsst.«
»Und du hast mir gesagt, dass du dich in mich verliebt hast.« Sanft fuhr er mit einem Finger die Konturen ihrer Lippen nach. »Ich habe mich auch in dich verliebt, ungefähr zwei Sekunden, nachdem ich dich zum ersten Mal gesehen habe.«
Sina lachte glücklich auf »Wirklich? Du liebst mich auch?«
»Natürlich, Sina, mein Liebling. Wer könnte dich nicht lieben? Du bist wunderschön, einzigartig, liebevoll und herzlich. Ich musste mich einfach in dich verlieben.«
Diesmal war es Sina, die ihn küsste. Vincent liebte sie! Nie war sie so glücklich gewesen wie in diesem Augenblick. Doch dann kamen ihr Bedenken. »Was wird deine Großmutter dazu sagen? Meinst du, es stört sie, wenn wir zusammen sind?«
»Ganz sicher nicht.« Vincent entschied sich für die Wahrheit. »Sie weiß doch schon längst von uns. Ich hatte ihr von unserer ersten Begegnung erzählt. Sie war es, die mir den Weg zu dir gewiesen hat. Ich glaube, wir werden sie sehr, sehr glücklich machen, wenn wir ihr von unserer Liebe erzählen. Wollen wir gleich zu ihr gehen?«
»Nein!«, wehrte Sina hastig ab. »Das wäre sicher keine so gute Idee. Dein Vater ist gerade bei ihr.«
»Er weiß auch schon Bescheid«, erwiderte Vincent leichthin. Als er ihr entsetztes Gesicht sah, lachte er: »Sie alle wissen es schon längst. In meiner Familie gibt es keine Geheimnisse. Wir tragen halt unser Herz auf der Zunge.«
»O je«, entfuhr es Sina. Wie sollte sie bloß in diese Familie passen?
»Es klingt schlimmer, als es ist. Du wirst dich mit der Zeit daran gewöhnen«, beruhigte sie Vincent und gab ihr einen Kuss auf die Nasenspitze. »Sei einfach so, wie du bist, und sie werden dich lieben. Meine Oma liebt dich jetzt schon.« Er strich ihr sanft eine Haarsträhne zurück und sagte weich: »Und ich sowieso.«
Sina blieb es erspart, Ludwig Beerenburg als Vincents offizielle Freundin gegenüber zu treten. Erleichtert atmete sie auf, als Vincents Vater nur Minuten später die Station verließ. Auch für Vincent wurde es Zeit aufzubrechen. Mit einem langen, süßen Kuss verabschiedete er sich von ihr, und Sina eilte zurück zu ihrer Patientin.
Valentina empfing sie mit einem verschmitzten Lächeln.
»Mein Enkel hat also die Karten auf den Tisch gelegt.«
»Ja, endlich. Kaum zu glauben, dass Sie die ganze Zeit davon gewusst haben.« Sina klang ein wenig verletzt. »Und ich habe Ihnen sogar mein Herz ausgeschüttet und von meiner Liebe zu Vincent erzählt.«
»Bitte verzeihen Sie mir, Sina. Ich wäre lieber ehrlich zu Ihnen gewesen, aber ich hatte Vincent versprochen, ihm etwas Zeit zu verschaffen. Er wollte erst sicher sein, dass Sie ihn meinen und nicht sein Vermögen. Ich hoffe sehr, dass Sie das verstehen können.«
»So richtig verstehen kann das wohl nur jemand, der bereits schlechte Erfahrungen gemacht hat. Es muss schlimm sein, wenn man sich immer fragen muss, ob die Liebe echt ist. Oder die Freunde.«
»Ja, das ist es. Aber diese Lektion haben wir doch alle lernen müssen, nicht wahr?« Valentina klopfte auf den Platz neben sich auf dem gemütlichen Sofa. »Und nun setzen Sie sich endlich. Sie müssen mir alles ganz genau erzählen. Ich will jede Kleinigkeit wissen.«
Sina lachte, als sie sich zu Valentina setzte. »Vincent hat mich schon vorgewarnt, dass mich das erwarten würde.«
»Alles halb so schlimm. Sie werden sich schon daran gewöhnen, Sina.«
»Ja, das sagte Vincent auch.« Sie erwiderte Valentinas warmes Lächeln. »Und ich denke, es wird mir sehr gefallen.«
*
Aufgeregt lief Sina in ihrer kleinen Wohnung zwischen Bad und Kleiderschrank hin und her. In wenigen Minuten würde Vincent sie abholen. Für ihn wollte sie so gut aussehen wie nie zuvor in ihrem Leben. Sie hatte sich ein luftig-leichtes Sommerkleid in einem zarten Gelbton und passende Riemchensandalen gekauft. Sie war beim Friseur gewesen und hatte sich sogar zu einem professionellen Make-up, das ihre großen Augen und ihre sinnlichen Lippen betonte, überreden lassen. Das Ergebnis war beeindruckend, auch wenn ihr diese wunderschöne junge Frau im Spiegel noch etwas fremd vorkam.
Sina warf einen letzten prüfenden Blick in ihr Bad. Das Waschbecken blitzte, die Handtücher waren sauber. Auch an ihrem Zimmer, das ihr als Wohn- und Schlafraum diente, gab es nichts auszusetzen. Es war klein, aber sehr gemütlich und heimelig. Genau so, wie Sina es liebte. Und Vincent hoffentlich auch. Es war ihr nicht nur wichtig, was er von ihr dachte, sondern auch von ihrer Wohnung. Sie war ein Teil von ihr und ein Abbild ihrer Persönlichkeit. Sina fiel ein, was er ihr von seiner kleinen Studentenbude erzählt hatte. Aus seinen Worten hatte sie herausgehört, wie sehr er sie liebte. Und plötzlich wünschte sie sich, dass er auch ihre Wohnung lieben würde. Sie wollte, dass er sich hier wohlfühlte, sie wollte ihn – mehr als alles andere auf der Welt. Sie fieberte dem Moment entgegen, in dem Vincent kommen würde, um sie in seine Arme zu schließen, sie zu küssen und ihr zu sagen, wie sehr er sie liebt.
Ihr Frühdienst in der Klinik war heute langsamer vergangen als an allen anderen Tagen. Sie hatte sich kaum auf ihre Arbeit konzentrieren können, weil sie ständig an Vincent denken musste. Natürlich war das Valentinas Aufmerksamkeit nicht entgangen. Sie hatte sich köstlich darüber amüsiert und ihr aus ihrer eigenen verliebten Jugendzeit erzählt. Als sich Sina zum Dienstende von ihr verabschiedete, hatte Valentina sie spontan in ihre Arme geschlossen und ihr einen wunderschönen Abend gewünscht.
Endlich klingelte es, und Sina lief zur Wohnungstür und riss sie auf. Sie sah die Bewunderung in seinen Augen, als sein Blick über ihren Körper glitt. »Du siehst atemberaubend aus«, murmelte er und fast im selben Augenblick fand sie sich in seinen Armen wieder. Unter seinem heißen Kuss, der zärtlich begann und schnell leidenschaftlicher wurde, zerschmolz sie fast. Die Zeit blieb stehen, es gab nur noch sie und ihn.
»Wir sollten lieber aufbrechen«, raunte er ihr leise zu. »Es sei denn, du möchtest den Film und das Abendessen ausfallen lassen.« Seine Worte klangen dabei so hoffnungsvoll, dass Sina lachend den Kopf schüttelte. »Es wäre schade um die Kinokarten und das leckere Essen.« Sie küsste ihn und sagte dann voller Liebe: »Wenn du mich nachher nach Hause bringst, kannst du aber gern noch auf einen Kaffee reinkommen.«
Vincent hatte den Film ausgesucht, und Sina stellte schnell fest, dass er die perfekte Wahl getroffen hat. Er war eine gelungene Mischung aus Spannung, Humor und Liebe. Genau das, was Sina mochte. Und Vincent anscheinend auch. Er amüsierte sich genauso gut wie sie. Obwohl es ihr manchmal äußerst schwerfiel, sich auf das Geschehen auf der Leinwand zu konzentrieren. Sie konnte Vincents Nähe nicht ignorieren. Der Duft seines dezenten Aftershaves war in ihrer Nase, und sie bekam jedes Mal eine Gänsehaut, wenn er gedankenverloren über ihre Hand strich oder diese an seinen Mund führte, um sie zu küssen.
»Es ist nicht weit bis zum Restaurant, höchstens zehn Minuten«, sagte er, als sie das Kino verließen. »Das Auto könnten wir hier stehenlassen.«
»Dir ist nach einem kleinen Spaziergang?«
Vincent zog sie an sich und küsste sie. »Mir ist danach, dich zu küssen, wann immer ich möchte.«
Sina nickte wissend. »Das geht bei einem Spaziergang natürlich besser als beim Autofahren.«
»Du bist nicht nur wunderschön, sondern auch sehr klug.« Vincent küsste sie wieder. Er seufzte, als er den Kuss schließlich beendete. »Vielleicht sollte ich lernen, mich ein wenig zurückzuhalten. Wir werden es sonst nicht mehr rechtzeitig bis zum Küchenschluss schaffen. Es sei denn …« Er küsste sie erneut. »Also falls du keinen Hunger hast, könnten wir auch gleich zum Kaffee übergehen.«
»Tut mir leid, aber ich bin am Verhungern. Der Kaffee muss noch warten.«
Vincent war einsichtig. Er konnte sich gedulden, auch wenn es ihm sehr schwerfiel. Doch das Wissen, dass sie noch ein ganzes, gemeinsames Leben vor sich hatten, half ihm dabei. Noch nie hatte er so empfunden. Er liebte sie, heftiger als er es je für möglich gehalten hätte. Für Sina spielte es keine Rolle, dass er der Erbe des Beerenburg-Imperiums war. Sie sah nur ihn, den Mann, den sie aus tiefstem Herzen liebte.
Vincent hatte nicht nur bei der Auswahl des Films Geschmack bewiesen, sondern auch bei der des Restaurants.
»Hier war ich schon einmal mit Freunden essen«, sagte sie begeistert. »Es ist traumhaft schön, und das Essen ist ausgezeichnet.«
»Ich weiß, und ich freu mich, dass es dir auch so gut gefällt wie mir. Es ist schön, dass wir den gleichen Geschmack haben.«
»Und wenn dem nicht so wäre?«, fragte sie ihn neckend, als der Ober sie zu ihrem Tisch führte. »Würdest du mich dann nicht mehr lieben?«
»Dich nicht mehr lieben?« Vincent schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass ich das könnte.«
Sina strahlte ihn glücklich an. Es war der perfekte Abend mit dem perfekten Mann, der immer zu wissen schien, was er sagen musste, um ihr Herz zum Klopfen zu bringen.
Der Wein war köstlich und das Essen so gut wie in ihrer Erinnerung. Sie aßen, tranken, lachten und sprachen über alles, was ihnen in den Sinn kam. Es war schon spät, als sie schließlich aufbrachen.
»Lass uns noch einen kleinen Umweg machen«, bat Sina. »Es ist eine wundervolle Nacht.«
»Aber nur, weil du ein Teil davon bist«, erwiderte Vincent weich.
Eng umschlungen schlenderten sie die Straßen entlang. Es war immer noch angenehm warm, obwohl es inzwischen weit nach Mitternacht war. Sie genossen die laue Sommernacht und ihr Zusammensein. Ihre Liebe war jung und voller romantischer Gefühle. Nichts konnte ihre tiefe, innige Verbundenheit oder das übergroße Glücksgefühl stören. Weder die wenigen, späten Spaziergänger, noch der leichte Nieselregen, der plötzlich einsetzte. Sie hatten sich und ihre Liebe und fühlten sich wundersam behütet – auch ohne Regenschirm. Trotzdem war dies das Signal, ihren langen Spaziergang zu beenden und sich auf den Rückweg zu machen.
Der Parkplatz hinterm Kino, auf dem Vincents Wagen stand, war fast leer. Der letzte Film war längst vorbei, alle anderen Kinobesucher waren inzwischen fort. Nur ein dunkler, alter Transporter stand noch neben Vincents Wagen.
Vincent öffnete Sina die Beifahrertür.
»Es war ein traumhafter Abend, Vincent. Vielen Dank.«
»Ich hoffe, er ist noch nicht zu Ende«, erwiderte Vincent lächelnd.
Sina legte ihm ihre Arme um den Nacken und küsste ihn. »Nein, das ist er nicht. Auf dich wartet noch der versprochene Kaffee.«
»Ich liebe Frauen, die ihre Versprechen halten.«
»He!«, rief Sina und tat empört. »Für dich darf es nur noch eine Frau geben, die du liebst!«
Vincent lachte. Dann legten sich seine Lippen auf ihren Mund. Für ihn gab es nur Sina. Keine andere Frau würde je wieder diese tiefen Gefühle in ihm auslösen können.
Hinter ihm öffnete sich geräuschvoll die Seitentür des Transporters. Vincent kam nicht mehr dazu, sich umzudrehen. Kaltes Metall drückte sich an seinen Hals. Eine Waffe, dachte er sofort. Das Entsetzen, das er in Sinas Augen sah, bestätigte seine schreckliche Vermutung.
»Nur eine falsche Bewegung und ich knall euch beide ab.«
Vincent zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass es der Mann in seinem Rücken ernst meinte. »In Ordnung! Nimm dir einfach meine Brieftasche und verschwinde«, sagte er ruhig, trotz der Panik, die er spürte. Er setzte darauf, dass es diesem Typen nur um die schnelle Kohle ging und er sie in Ruhe lassen würde, sobald er hatte, was er wollte.
»Halt‘s Maul, Beerenburg.« In dem Moment, als Vincent seinen Namen hörte, wusste er, dass dies kein simpler Überfall war. »Los, rein in den Transporter! Beide!«
Vincent sah die schreckliche Angst in Sinas Augen, und wünschte, er könne irgendetwas tun, um sie ihr zu nehmen.
»Lass sie gehen! Sie hat nichts damit zu tun. Hier geht es doch nur um mich.«
Die Waffe bohrte sich tiefer in Vincents Hals. »Bist du taub? Ihr sollt einsteigen! Sofort!«
Alles in Vincent sträubte sich, diesem Befehl zu folgen. Fieberhaft suchte er nach einem Ausweg. Er wusste, waren sie erst einmal im Wagen, gab es keine Hoffnung mehr, diese Entführung zu verhindern. Vielleicht könnte er den Kidnapper hinhalten? Womöglich tauchten andere Nachtschwärmer auf und schlugen allein mit ihrer Anwesenheit den Verbrecher in die Flucht. Doch das war so gut wie aussichtslos. Es war spät, niemand verirrte sich mitten in der Nacht auf einen abgelegenen, leeren Parkplatz hinter einem Kino, das längst geschlossen hatte. Sollte er es einfach auf einen Kampf ankommen lassen? Doch die Gefahr, dass dieser Kerl seine Waffe benutzen könnte, war groß. Und wenn er es trotzdem riskierte?
Während sich Vincents Gedanken überschlugen, kam ein weiterer Mann hinter dem Transporter hervor. Er trug eine schwarze Maske über dem Gesicht und zischte seinem Komplizen zu: »Nicht so laut! Verdammt! Du brüllst hier noch die ganze Gegend zusammen!« Dann hob er die Hand und richtete eine Waffe auf Sina. Höflich, fast freundlich sagte er zu Vincent: »Geben Sie meinem Freund bitte Ihr Handy, Herr Beerenburg. Und dann sollten Sie endlich einsteigen. Sie wollen doch sicher nicht, dass diese Sache hier unschön für Ihre kleine Freundin endet.«
Vincent gab widerstandslos sein Telefon ab. Er würde alles tun, was sie von ihm verlangten, wenn nur Sina nichts geschah. »Nehmen Sie Ihre Waffe runter. Lassen Sie sie in Ruhe. Ich werde keine Schwierigkeiten machen. Aber bitte, lassen Sie meine Freundin gehen. Sie nützt Ihnen nichts.«
»Einverstanden, Herr Beerenburg«, sagte der Mann zu Vincents Überraschung und großer Erleichterung. Dann zeigte er auf die Tür des Transporters. »Wenn ich bitten darf.«
»Nein!«, rief Sina mit tränenerstickter Stimme, als sich Vincent von ihr wegdrehte. Dann spürte er einen kräftigen Schlag in seinem Rücken und stürzte durch die offene Tür in die Dunkelheit des Transporters. Er hörte, wie Sina aufschrie. Im nächsten Augenblick landete sie neben ihm auf dem harten Boden, und die Tür wurde schwungvoll zugeschmissen. Vincent nahm die zitternde Sina in seine Arme. Diese Mistkerle hatten sie nicht gehenlassen!
Sekunden später dröhnte das laute Geräusch des Motors zu ihnen, und sie fuhren los.
»Es wird alles gut, Sina, mein Liebling«, sagte Vincent leise. »Keine Angst, es wird alles wieder gut.« Er zog sie dichter an sich heran und hoffte, dass sie ihm genug vertraute, um ihm glauben zu können. »Ich lass nicht zu, dass dir etwas geschieht. Ich passe auf dich auf.«
*
Valentina Beerenburg wurde von der Sonne geweckt, die in ihr Zimmer schien. Es war schon fast acht, bemerkte sie erstaunt, als sie auf die Uhr sah. Das war äußerst seltsam! Normalerweise kam Sina pünktlich um sieben herein, um sie zu wecken. Das war eine feste Abmachung, die auch an einem Sonntag galt. Valentina mochte es, wenn der Tag früh begann. Sie hielt nichts davon, lange zu schlafen. Dass es heute trotzdem geschehen war, konnte nur eins bedeuten: Sina war noch gar nicht zum Dienst erschienen. Sie hatte verschlafen!
Valentina lächelte, meinte sie doch den Grund dafür zu kennen. Dann schüttelte sie missbilligend den Kopf. Vincent hatte keinen guten Einfluss auf Sina, wenn sie seinetwegen ihre Pflichten vernachlässigte. Sie würde sich ihren Enkel später gehörig zur Brust nehmen. Doch was sollte sie jetzt machen? Nach einer anderen Schwester klingeln? Nein, das kam nicht infrage. Erstens wollte sie keine andere Schwester um sich haben, und zweitens wüssten dann alle, dass Sina nicht da war. Womöglich bekäme sie dadurch einen Haufen Ärger.
Valentina griff nach ihrem Handy und rief Vincent an. Wenn sie sich nicht arg täuschte, waren Vincent und Sina in diesem Moment zusammen und verschwendeten keinen Gedanken an die vernachlässigte Großmutter in der Behnisch-Klinik.
»Vince, mein Lieber, ich fürchte, ich muss dir dafür die Ohren langziehen.« Noch amüsierte sich Valentina über die beiden Verliebten, doch schnell wurde sie zunehmend unruhiger, während sie dem einsamen Klingelton des Telefons lauschte. Warum ging Vincent nicht ran?
Als es an ihrer Tür klopfte, atmete sie auf. Sina! Endlich! Doch es war nicht Sina, die hereinkam.
»Schwester Lore!«, rief Valentina verärgert aus. »Was machen Sie denn hier? Wo ist Schwester Sina?«
Unter den harschen Worten ihrer Patientin zuckte Lore zusammen. Sie war alles andere als ein ängstlicher Typ, aber Valentina Beerenburg flößte ihr großen Respekt ein.
»Schwester Sina ist noch nicht da«, sagte sie kleinlaut und so leise, dass Valentina sich anstrengen musste, um sie zu verstehen. »Ich soll mich um Sie kümmern, bis sie kommt.«
»Bis sie kommt? Wann ist das? Hat sie sich bei Ihnen gemeldet? Wissen Sie überhaupt, wo sie ist?«
»Nein … nein … Ich … Also niemand weiß etwas«, stotterte Lore unbeholfen.
»Bin ich die Einzige, die das sonderbar findet?«
»Äh … nein. Sina verspätet sich nie. Ich weiß auch nicht, was los ist.«
»Schon gut, schon gut.« Valentina wedelte mit der Hand. »Sie können jetzt gehen. Ich komme allein klar, bis Schwester Sina kommt. Falls nicht, kann ich ja immer noch klingeln.«
Lore nickte und sah zu, dass sie da rauskam. Auf dem Flur lehnte sie sich gegen die Wand und atmete tief durch.
»So schlimm?«, fragte Pfleger Tobias. Er hörte sich nicht besonders mitfühlend an, und als Lore aufsah, konnte sie sehen, dass er sich nur mühsam das Lachen verkniff.
»Ja, lach du ruhig«, schimpfte sie leise. »Du musst ja auch nicht rein zu diesem … diesem Drachen.«
»Drachen? Ich habe Frau Beerenburg immer als ausgesprochen höflich und freundlich erlebt. Außer dir hat niemand Probleme mit ihr.«
»Ja, ja. Nun liegt es also an mir!«, gab Lore beleidigt zurück.
Tobias seufzte auf. »Natürlich liegt es an dir, und das weißt du auch. Nur durch dein dummes Getratsche bist du bei Frau Beerenburg in Ungnade gefallen.«
»Was hab’ ich denn schon Schlimmes getan?«, jammerte Lore kläglich. »Wir tratschen doch alle mal. Was ist denn da so furchtbar dran?«
»Wenn ich dir das erst erklären muss, bist du wohl ein hoffnungsloser Fall. Mit deinem Gerede hast du üble Gerüchte in Umlauf gebracht.«
»Gerüchte? Du tust ja gerade so, als hätte ich mir alles nur ausgedacht!«
»Alles vielleicht nicht! Aber deinen Ruf als größte Tratschtante der Behnisch-Klinik hast du nicht zu Unrecht. Du kannst nicht alles weitererzählen, was du zu hören bekommst. Das Zauberwort heißt Diskretion! Schlag nach, wenn du nicht weißt, was es bedeutet.«
Unter Tobias’ strengem Blick lenkte Lore schnell ein:
»Ich bemühe mich ja. Wirklich! Ich reiß mich doch schon zusammen und will mich auch bessern. Aber weißt du, wie blöd das ist, wenn dir diese alten Geschichten immer wieder vorgeworfen werden?«
»Dass dir Frau Beerenburg zeigt, wie sauer sie immer noch auf dich ist, darfst du ihr nicht verdenken. Sieh es einfach als deine gerechte Strafe an.«
Trübsinnig sah Lore ihrem Kollegen nach, als er wieder an seine Arbeit ging. Gerechte Strafe? Vor allem war es eine entsetzliche Strafe, die sie hier wegen Sina erleiden musste. Wo steckte sie bloß?
*
Nach dem Regen in der letzten Nacht schien die Sonne wieder kräftig vom strahlend blauen Himmel. Das herrliche Wetter sollte sich heute den ganzen Tag halten, und Daniel Norden bekam Lust auf einen Ausflug ins Grüne.
»Wir könnten gleich nach dem Mittag losfahren«, sagte er zu Fee und griff nach seiner Kaffeetasse. »Wenn ich es mir recht überlege, haben wir schon lange keinen Sonntagsausflug mehr gemacht.«
»Es ist schon eine Weile her«, gab ihm Fee recht. »Und ich halte das für eine ausgezeichnete Idee. Noch besser wäre sie, wenn wir noch vor dem Mittag losfahren würden. Essen könnten wir dann auch unterwegs. Irgendwann später. Wir sind ja gerade erst mit dem Frühstück fertig geworden.«
Auf dem Terrassentisch stand noch immer ein Teil des Frühstückgeschirrs. Sie ließen es sich heute gutgehen. Die Woche war anstrengend gewesen, und es hatte keinen einzigen Tag gegeben, an dem Fee oder Daniel pünktlich Feierabend machen konnten. Ein geruhsames, ausgiebiges Sonntagsfrühstück, nachdem sie lange geschlafen hatten, war dafür die passende Entschädigung.
»Ich bin mit allem einverstanden, was du vorschlägst, Feelein.« Er hielt sein Gesicht in die Sonne und schloss die Augen. »Ich bin jetzt schon ein sehr glücklicher Mann.«
Fee lachte, doch sie wurde sofort ernst, als Daniels Telefon klingelte. »Die Klinik?«, fragte sie, als er es in die Hand nahm und aufs Display schaute.
»Nein, es ist Ludwig Beerenburg.« Daniel ging ran. Sein Gesicht wurde ernst, während er den Worten seines Anrufers lauschte. Leider konnte Fee aus dem Wenigen, das Daniel sagte, nicht heraushören, worum es ging. Aber sie spürte, dass es einen schwerwiegenden Grund für Beerenburgs Anruf gab, und machte sich augenblicklich Sorgen.
»In Ordnung, Herr Beerenburg, wir treffen uns dann bei Ihrer Mutter. Ja, ich fahre sofort los.« Daniel beendete das Gespräch und stand auf.
»Was ist los? Ist etwas mit Valentina?«
Daniel zog die Stirn kraus. »Er wollte mir am Telefon nichts Genaues sagen. Er war völlig außer sich und meinte, dass etwas Schreckliches geschehen sei. Er will, dass ich dabei bin, wenn er es seiner Mutter erzählt. Für den Fall, dass sie die Nachricht nicht verkraftet.«
»Ich komme mit. Vielleicht kann ich irgendwie helfen.«
»Danke, Fee. Ich habe das ungute Gefühl, dass dein psychologischer Beistand nötig sein wird.«
Obwohl sie sofort losfuhren, war Ludwig vor ihnen da. Völlig aufgelöst tigerte er auf dem Stationsflur der Inneren auf und ab. »Endlich!«, rief er aus, als Fee und Daniel aus dem Fahrstuhl traten.
»Was ist los?«, fragte Daniel statt einer Begrüßung.
»Das erfahren Sie, wenn wir bei meiner Mutter sind. Dann brauche ich mich nicht zu wiederholen und spare kostbare Zeit. Außerdem …« Er sah sich gehetzt auf dem Flur um und senkte die Stimme. »Außerdem ist es besser, wenn wir keine Zuhörer haben.«
Die Sache wurde immer mysteriöser, und Fees Unruhe wuchs. Doch sie sah ein, dass es nichts brachte, Ludwig Beerenburg zu drängen. Sie würden warten müssen, bis er im Beisein seiner Mutter über das sprach, was ihn so aufwühlte.
»Ludwig! Was machst du denn hier?«, rief Valentina überrascht aus. Dann wanderte ihr Blick zu Fee und Daniel Norden, und eine unerklärliche Angst schnürte ihr die Kehle zu. Auf einmal ergab alles einen Sinn. Auf einmal wusste sie, warum Sina nicht zum Dienst gekommen war.
»Vincent!« Die Stimme drohte ihr zu versagen. »Was ist mit ihm passiert? Ein Unfall? Ist er … ist er verletzt?«
»Nein, er hatte keinen Unfall. Er …« Hilflos sah Ludwig zu Fee und Daniel.
»Herr Beerenburg«, sagte Fee mitfühlend. »Bitte sagen Sie uns, was geschehen ist. Sie müssen es hinter sich bringen. So schwer es ihnen auch fallen mag. Wir können Ihnen nicht helfen, wenn wir nicht wissen, was los ist.«
»Ludwig, so sprich doch endlich!« Valentina schluchzte, und Fee setzte sich schnell zu ihr und legte tröstend einen Arm um sie.
»Bitte setzen Sie sich auch, Herr Beerenburg.« Daniel wartete, bis Ludwig saß. Noch immer schwieg er. Egal, was diesen Mann quälte, es musste so furchtbar sein, dass er es nicht schaffte, es laut auszusprechen. Daniel nahm auf dem Sessel Platz und sprach eindringlich auf Ludwig ein: »Erzählen Sie bitte, warum Sie uns hergebeten haben. Ich nehme an, es geht um Vincent.«
Ludwig nickte. Dann öffnete er endlich seinen Mund. »Ja, es geht um Vince … Er … er wurde entführt.«
»Nein!«, schrie Valentina auf.
»Ich habe heute in der Früh einen Anruf von den Entführern bekommen. Vincent und Schwester Sina sind in ihrer Gewalt.«
»Schwester Sina?«, fragte Daniel verständnislos nach.
»Ja, die beiden sind ein Paar«, erklärte Ludwig. »Haben Sie das nicht gewusst?«
»Nein, aber das spielt auch keine Rolle. Wichtiger ist, dass die Sache schnell vorbei ist. Wie soll es nun weitergehen? Welche Forderungen stellen die Entführer? Was sagt die Polizei?«
»Die Entführer wollen zehn Millionen haben. Und die Polizei …« Ludwig schüttelte den Kopf. »Die Polizei weiß von nichts. Ich habe sie nicht informiert und werde das auch nicht tun.«
»Das meinen Sie hoffentlich nicht ernst«, entfuhr es Daniel. Er war entsetzt. Zwei Menschen wurden entführt, und die Polizei wurde herausgehalten. Das konnte nicht gut ausgehen! »Hören Sie, Herr Beerenburg. Ohne Polizei wird das nicht funktionieren. Niemand von uns weiß, wie diese Entführer ticken oder wozu sie imstande sind. Die Polizei kennt sich aus, sie wird …«
»Nein!« Ludwig wurde energisch. »Die Entführer haben klare Bedingungen gestellt. Sie haben damit gedroht, Vincent zu …« Er musste erst Kraft sammeln, um weitersprechen zu können. »Sie werden ihm etwas antun, wenn sie merken, dass die Polizei Bescheid weiß. Es ist meine Entscheidung. Ich werde nichts unternehmen, was das Leben meines Sohnes gefährden könnte.«
»Und was ist mit dem Leben von Schwester Sina?«, fragte Fee behutsam. »Sie können diese Entscheidung nicht nur für Ihren Sohn fällen. Auch Sinas Leben ist in Gefahr.«
»Wenn Sie meinen«, erwiderte Ludwig knapp.
»Was soll das heißen?« Fee sah ihn verwirrt an, als sie begriff, was Ludwig Beerenburg damit andeutete. »Wollen Sie etwa behaupten, dass Sina kein Entführungsopfer ist?«
»Ich behaupte gar nichts. Ich finde es nur seltsam, dass mein Sohn entführt wird, kurz nachdem er mit Sina zusammengekommen ist. Und noch seltsamer ist, dass sie bei ihm war, als es passierte. Wer weiß, vielleicht haben wir uns alle in ihr getäuscht. Vielleicht ist sie eine Komplizin und hat Vincent in eine Falle gelockt.«
»Jetzt reicht es aber endgültig, Ludwig!«, herrschte Valentina ihren Sohn an und wischte sich hastig die Tränen fort. »Bei allem Verständnis für dich und deinen Kummer, hör sofort auf, so einen Blödsinn zu reden!«
»Mama, ich …«
»Schluss jetzt!«, blaffte sie und erstickte seinen unbeholfenen Erklärungsversuch im Keim. »Sina ist ein liebes Mädchen und genau wie unser Vince nur ein bedauernswertes Opfer. Du reißt dich jetzt gefälligst zusammen. Es ist wichtig, dass du dich nicht in haltlose Verdächtigungen flüchtest, sondern vernünftig reagierst. Und dann werden wir überlegen, was zu tun ist, damit die beiden unbeschadet aus der Sache rauskommen.« Valentina Beerenburg hatte zu ihrer alten Stärke zurückgefunden. Den Moment der Schwäche hatte sie überwunden. In dieser Krise war sie ihrem Sohn überlegen. Sie war diejenige, die jetzt einen kühlen Kopf bewahrte und sich nicht von ihren Ängsten beherrschen ließ. Zumindest nicht in diesem Augenblick. Für verzweifelte Tränen war später noch genügend Zeit.
»Ich stimme Ihnen zu, Dr. Norden«, sagte sie so, dass Ludwig nicht wagte zu widersprechen. »Wir werden mit der Polizei reden müssen. Allein sind wir dieser Geschichte nicht gewachsen.«
»Aber wenn die Entführer das erfahren …«, versuchte Ludwig, seiner Mutter das Vorhaben auszureden.
»Sie dürfen es nicht erfahren.« Valentina wandte sich an Daniel Norden. »Sie kennen doch bestimmt jemanden bei der Polizei, dem wir uns anvertrauen können und auf dessen Diskretion wir bauen dürfen.«
Daniel nickte erleichtert. Er war froh, dass diese unliebsame Diskussion endlich zu Ende war und die Vernunft Einzug gehalten hatte. »Natürlich, Frau Beerenburg. Ich denke, Oberkommissar Björn Lange ist genau der richtige Mann dafür.«
Zum Glück war es für Daniel ein Leichtes, Björn Lange an diesem Sonntagvormittag zu erreichen. Er hatte den Kommissar vor einigen Monaten kennengelernt, als die Polizei einem Hehler auf der Spur gewesen war. Björn Lange hatte seine Arbeit gut gemacht und den Verbrecher verhaftet. Zu Björns beruflichem Erfolg hatte sich auch ein sehr persönlicher gesellt: Während der Verbrecherjagd hatte er das Herz von Steffi Seidel erobert, die in der Behnisch-Klinik als Kunsttherapeutin arbeitete. Seitdem waren die beiden ein Paar, und Daniel wusste, wo Steffi war, konnte auch Björn Lange nicht weit sein.
Steffis Telefonnummer hatte Fee in ihrem Handy abgespeichert. Wie vermutet, erreichte Daniel den Polizisten bei Steffi. Mit kurzen, knappen Sätzen informierte er ihn über das Geschehen. Anschließend fühlte er sich schon um einiges leichter, so, als wäre er eine schwere Bürde losgeworden. In Björns Fähigkeiten hatte Daniel vollstes Vertrauen. Er hatte ihn bei der Arbeit erlebt und war sich sicher, wenn es einer schaffen konnte, dann der Münchner Oberkommissar.
Zum Glück sahen das Valentina und Ludwig Beerenburg nicht anders, als sie ihn kennenlernten. Daniel sah die Erleichterung und Zuversicht in ihren Augen, nachdem Björn mit einigen Kollegen eingetroffen war. Ludwig schien plötzlich froh, das Heft aus der Hand geben zu können.
Björn Lange verschaffte sich einen ersten Überblick und fragte dann: »Die Geldübergabe ist für morgen Nachmittag geplant?«
Ludwig nickte. »Bis dahin habe ich die zehn Millionen von der Bank bekommen. Gegen Mittag wollen sich die Entführer bei mir melden und mir die genaue Zeit und den Ort für die Übergabe mitteilen.« Er rieb sich die müden Augen. »Ich weiß nicht, wie ich die Zeit bis dahin durchstehen soll. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, was mein Sohn gerade ertragen muss.« Mit einem Seitenblick zu Fee und Daniel fügte er schuldbewusst hinzu: »Und Schwester Sina.«
»Wir werden diese Männer schnappen, und sie werden ihre gerechte Strafe bekommen«, versprach Björn.
Es gelang Ludwig kaum, die Tränen zurückzuhalten, als er sagte: »Ich … ich will nur meinen Sohn wiederhaben. Lebend, gesund! Bitte! Die Entführer dürfen nicht erfahren, dass wir Sie eingeschaltet haben.«
»Von uns erfahren sie erst, wenn wir ihnen die Handschellen anlegen.« Björn Lange zeigte auf seine Kollegen. »Niemand von uns trägt eine Uniform. Es deutet absolut nichts darauf hin, dass wir von der Kripo sind. Wir werden im Hintergrund agieren, unsere Ermittlungen durchführen, und Sie werden einfach so tun, als würde es uns gar nicht geben. Einverstanden?« Als Ludwig und Valentina nickten, begannen die Polizisten ihre Arbeit.
*
Vincent sah auf seine Uhr, die er am Handgelenk trug. Wenigstens die hatten ihm die Entführer gelassen. Es war Montag, kurz nach elf. Draußen schien wahrscheinlich die Sonne, sinnierte Vincent. In diesem fensterlosen Kellerraum, der nur von einer altersschwachen Glühbirne an der Decke Licht bekam, konnte er nur ahnen, was außerhalb ihres Gefängnisses vor sich ging. Ein Gefängnis, in dem sie seit mehr als dreißig Stunden eingesperrt waren. Es roch muffig und nach feuchten Wänden. In dem kargen Raum stand nur ein altes Metallbett mit einer durchgelegenen, fleckigen Matratze. Ein kleiner, wackliger Holztisch, ein Stuhl – mehr nicht. Für Vincent der Beweis, dass es nicht geplant war, Sina zu entführen. Es ging immer nur um ihn, den milliardenschweren Erben. Sina war ein Kollateralschaden. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und das nur, weil er sich in sie verliebt hatte. Das hatte sie nicht verdient, sagte er sich immer wieder. Die Ängste, die sie ausstand, den Kummer, den sie erleiden musste –, all das hatte sie nicht verdient.
Vincent hatte keine Ahnung, wo sie waren. Die Fahrt in dem Transporter hatte fast zwei Stunden gedauert. Als sie endlich anhielten und sie aussteigen mussten, war es so finster gewesen, dass er nichts von seiner Umgebung erkennen konnte. Wahrscheinlich waren sie irgendwo auf dem Land, auf einem Gehöft. Es hatte nach frisch gemähtem Gras gerochen, und der Himmel war so sternenklar gewesen, wie man ihn in einer Großstadt wie München nie zu sehen bekam.
Nicht mehr lange, zog es ständig wie ein Mantra durch Vincents Kopf, wenn seine Angst unerträglich wurde. Nicht mehr lange. Von den Entführern wusste er, dass am Nachmittag die Geldübergabe stattfinden soll. Danach würde man sie freilassen. Vincent glaubte fest daran. Er musste es einfach glauben. Nur so würde es ihm gelingen durchzuhalten. Es gab einiges, was dafür sprach, dass es gut für sie ausgehen würde. Sie hatten nie die Gesichter ihrer Entführer zu sehen bekommen. Wenn sich die beiden Männer blicken ließen, um ihnen das Essen zu bringen, trugen sie stets ihre schwarzen Gesichtsmasken. Ein gutes Zeichen, wie Vincent fand. Wenn die Entführer vorhätten, sie zu töten, würden sie ihre Gesichter nicht verbergen.
Vincent fragte sich manchmal, wie ihre gesichtslosen Kidnapper aussahen. Der Größere der beiden war ein rechter Hüne. Fast zwei Meter groß, massig mit einem schweißglänzenden Stiernacken. Der Mann fürs Grobe, wie Vincent ahnte. Der kleinere Entführer unterschied sich nicht nur in Größe und Statur grundlegend von ihm. Er schien zudem der Kopf des Duos zu sein. Er traf die Entscheidungen, sein Komplize führte sie aus.
Vincent saß auf dem Bett, den Rücken an die Wand gelehnt. Sina hielt er in seinen Armen. Vor einer Stunde war sie endlich eingeschlafen, und er war froh darüber. So konnte er den Schmerz und diese große Angst in ihren Augen nicht mehr sehen. Die Angst, die auch ihn immer wieder in heftigen Wellen erfasste. Geräuschvoll atmete er aus. Nicht mehr lange, beruhigte er sich, nicht mehr lange.
Sina regte sich. Schlaftrunken blinzelte sie ihn an. »Gibt es etwas Neues? Wie spät ist es?«
»Gleich zwölf. Wir haben es bald geschafft.«
Sina nickte stumm. Es gelang ihr nicht, Vincents Optimismus zu teilen. Würden sie die Entführer wirklich freilassen, wenn sie das Geld in ihren Händen hielten? Oder würden sie ihre unliebsamen Zeugen beseitigen?
Sie blinzelte schnell die Tränen fort, die ihr die Angst in die Augen trieb. Sie wollte nicht weinen, nicht schon wieder. Vincent hatte es auch so schon schwer genug.
»Es tut mir so leid, Sina«, sagte er unglücklich. »Du solltest nicht hier sein.«
»Du auch nicht! Niemand sollte das! Und nun hör auf, dich mit Schuldgefühlen zu quälen. Ich dachte, das hätten wir endlich hinter uns gelassen.« Sie reckte sich, um ihm einen leichten Kuss zu geben. In den vergangenen Stunden hatten sie nichts anderes getan, als sich zu trösten, Mut zuzusprechen und über Schuld und Nichtschuld zu diskutieren.
»Die Entführung hat nichts mit dir zu tun«, begann Vincent erneut. »Ich bin derjenige, den sie haben wollten. Du wurdest hier reingezogen. Durch meine Schuld.«
»Vincent, es reicht!«, fuhr Sina ihn so ungeduldig an, dass Vincent sie erstaunt ansah. »Das kannst du doch nicht ernsthaft glauben!« Sie zeigte aufgebracht auf die Kellertür. »Diese beiden Verbrecher da draußen sind die Täter. Dich trifft keine Schuld und mich auch nicht!«
»Warum solltest du denn schuld sein?«
Sina seufzte betrübt auf. »Als du in meiner Wohnung den Vorschlag gemacht hast, aufs Kino und Essen zu verzichten und dafür lieber daheim zu bleiben, habe ich es abgelehnt. Es wäre alles ganz anders gekommen, wenn ich es nicht getan hätte.«
»Sina …«, begann Vincent. Doch Sina hob die Hand, um ihn zu stoppen.
»Und später? Als wir aus dem Restaurant kamen? Ich wollte diesen Umweg machen, um noch länger mit dir durch das nächtliche München zu spazieren. Wären wir gleich zum Parkplatz zurückgegangen, wäre er nicht so menschenleer gewesen, und diese Typen hätten uns dort nicht schnappen können.«
»Dann hätten sie es woanders getan. Diese Entführung war keine spontane Idee. Sie haben sie lange im Voraus geplant. Es ist also völlig verrückt, dass du dir deswegen ernsthaft Gewissensbisse einredest.«
Sina lächelte ihn an. »Ja, das Gleiche gilt auch für dich. Also, ist jetzt endlich Schluss damit? Wenn du weiterhin auf deine Schuldgefühle bestehst, werde ich das auch tun.«
Vincent küsste sie. Vielleicht half das ja, um sich einzureden, dass Sina recht hatte. Und um zu vergessen, dass sie nur seinetwegen diese großen Ängste ausstehen musste. Er wusste, wie sehr sie litt. Und er wusste, wie sehr sie sich bemühte, um das vor ihm zu verbergen. Dafür liebte er sie noch mehr, als er es ohnehin schon tat. Falls das überhaupt möglich war.
Sina zuckte in seinen Armen zusammen, als vom Gang her Schritte zu hören waren. Kurz darauf wurde die Tür aufgerissen. Ihre Entführer waren zurückgekehrt.
»Mittagessen und Toilettenpause!«, donnerte die Stimme des Hünen durch den Raum. Er stellte ein Tablett auf dem Tisch ab, während sein Komplize die Gefangenen mit einer Waffe in Schach hielt.
»Wer will zuerst aufs Klo?«, fragte der Kleine.
»Ich«, sagte Sina mit zittriger Stimme und stand auf. Diese Toilettengänge waren furchtbar, aber sie ließen sich nicht vermeiden. Am anderen Ende des Kellers gab es einen kleinen Verschlag mit einer übelriechenden, dreckigen Toilette und einem Waschbecken, das nicht minder schmutzig war. Einer der beiden Entführer begleitete sie dabei und wartete dann davor, bis sie ihr Geschäft verrichtet hatte. Ja, es war entwürdigend und demütigend. Aber es gab nichts, was Sina dagegen tun konnte, und deshalb schluckte sie ihren Stolz und ihre Scham hinunter. Sie fügte sich in das Unvermeidliche und brachte es einfach hinter sich. Sie wusste nicht, wie sehr Vincent sie dafür bewunderte. Er stand mit ihr auf und begleitete sie zur Tür, bis ihn die Waffe des Kleinen stoppte.
»Halt! Bleib schön hier stehen!« Zu seinem Komplizen sagte er: »Pass auf ihn auf. Ich bin gleich mit seiner Freundin zurück.«
»He, warum darf ich eigentlich nie mit der Süßen gehen?«
»Das weißt du ganz genau! Die Kleine bedeutet nur Ärger. Also halt dich von ihr fern!«
»Warum muss ich immer das machen, was du willst? Was spricht denn gegen ein bisschen Spaß? Das wäre ein schöner Extra-Bonus für mich!«
»Hör endlich auf mit diesem Blödsinn. Wir halten uns an den ursprünglichen Plan. Fünf Millionen sollten dir als Bonus wohl reichen.«
Sina sah ängstlich zu Vincent hinüber. Es gefiel ihr überhaupt nicht, dass ihre Entführer stritten. Und dass sie dafür der Grund war, gefiel ihr noch weniger. Vincent lächelte sie an, und Sina wusste, dass er sie damit nur beruhigen wollte. Er stand keine zwei Meter von ihr entfernt. Wenn sie ihre Arme ausstrecken würden, könnten sie sich berühren. Und im Moment gab es nichts, was sich Sina mehr wünschte.
»Stell dich nicht immer so an«, blaffte der Riese jetzt. »Gönn mir doch mein Vergnügen. Sie ist doch wirklich eine ganz Süße.« Er griff nach Sina, doch bevor er sie berühren konnte, schlug sie seine Hand weg. Vincent hielt jetzt nichts mehr auf seinem Platz. Er stürzte sich auf den Entführer, um ihn von Sina abzulenken. Wenn es ihm zudem gelingen würde, die Pistole des Mannes zu erringen, standen ihre Chancen für eine Flucht nicht schlecht. Sie wären frei, und Sina müsste keine Angst mehr haben.
Die Entführer hatten nicht mit Vincents Angriff gerechnet. Unter der Wucht des Aufpralls klappten dem Hünen die Beine weg, und er fiel zusammen mit Vincent auf den Boden. Dort rangen sie miteinander, während Sina und der andere Entführer schockiert danebenstanden. Plötzlich erfüllte ein ohrenbetäubender Lärm den Kellerraum. Sina wusste sofort, was er bedeutete: ein Schuss! Es wurde geschossen!
»Vincent!«, schrie sie auf. Sie starrte auf die Männer, die nun regungslos vor ihr auf dem Boden lagen, bis Bewegung in das Knäuel kam. Fassungslos sah sie zu, wie der Entführer den leblosen Körper Vincents von sich rollte.
»Nein!«, schrie Sina und stürzte zu ihm. Dass der Kleine mit seiner Waffe fuchtelte und sie anbrüllte stehenzubleiben, bekam sie gar nicht mit. Sie wollte nur noch bei Vincent sein. Weinend kniete sie neben ihm und streichelte sein bleiches Gesicht. »Bitte nicht, Vincent, Liebling, bitte stirb nicht. Bitte!«
»Mach ich nicht«, brachte Vincent mühsam hervor und schlug endlich seine Augen auf. Er lebte!
»Rufen Sie einen Arzt!«, brüllte Sina ihre Entführer an. »Wir brauchen sofort einen Arzt!« Doch keiner der Männer machte Anstalten, dieser Aufforderung nachzukommen.
»Bitte!«, flehte Sina nun weinend. »Sie wollen doch nicht, dass er stirbt! Bitte, helfen Sie ihm! Er braucht einen Arzt!«
Endlich rührte sich der Kleine. »Los, du Idiot«, schnauzte er seinen Komplizen an. »Hol den Verbandskasten aus dem Auto!«
Den Verbandskasten? Entsetzt schüttelte Sina den Kopf. Ein Verbandskasten würde ihrem Liebsten nicht das Leben retten. Das konnte nur ein Arzt. Vincents Hemd war von Blut durchtränkt. Die Kugel steckte in seiner linken Schulter und hatte – so wie es aussah – etliche Blutgefäße zerfetzt, aus denen reichlich Blut floss. Wenn er nicht bald in ein Krankenhaus käme, würde er verbluten.
»Hören Sie!« Sina sah zu dem Mann auf, der immer noch seine Waffe auf sie richtete. »Wenn er stirbt, nützt er Ihnen nichts mehr. Nur wenn er am Leben bleibt, kommen Sie zu Ihrem Geld.«
»Ruhe!«, schnauzte er sie an.
Doch Sina wollte nicht ruhig sein. Sie wollte, dass Vincent in ein Krankenhaus kam, dass er überlebte. »Ich weiß, dass Sie seinen Tod nicht wollen. Sie sind keine Mörder. Sie wollen nur schnell an ganz viel Geld kommen. Bitte lassen Sie nicht zu, dass er hier verblutet. Bitte, ich flehe Sie an. Sorgen Sie dafür, dass er in eine Klinik kommt. Sie haben dann doch immer noch mich. Eine Geisel reicht Ihnen doch. Vincent wird alles tun, um mich hier rauszuholen. Sie werden auch für mich das Geld bekommen.«
»Sie scheinen sich Ihrer Sache ja sehr sicher zu sein«, höhnte der Mann. »Wie lange sind Sie mit ihm zusammen? Eine knappe Woche? Glauben sie wirklich, dass Sie ihm zehn Millionen wert wären?«
»Halten Sie den Mund!«, presste Vincent mühsam hervor. »Halten Sie endlich Ihren Mund! Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie reden! Ich würde alles für Sina tun. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie sich für mich opfert und meinen Platz einnimmt. Also halten Sie endlich Ihren Mund!«
Der Große kam schnaufend zurückgelaufen und warf den Verbandskasten neben Vincent auf den Boden. Sina starrte darauf. Sie glaubte nicht, dass dieser kleine, schwarze Kasten oder ihre Fähigkeiten als Krankenschwester reichen würden, um Vincents Leben zu retten. Aber ihr blieb nichts anderes übrig, als es zu versuchen.
»Helfen Sie mir, ihn aufs Bett zu legen«, sagte sie mit kraftloser Stimme. »Er kann hier nicht auf dem kalten Boden liegenbleiben.«
*
»Herzlichen Glückwunsch!«, sagte Jens Wiener grinsend, als er mit Christina Rohde die Notaufnahme verließ. »Du hast diese Patientenübergabe geschafft, ohne dich mit Berger anzulegen. Du machst große Fortschritte.«
»So schlimm bin ich gar nicht!«, protestierte Christina mit einem verlegenen Lachen.
»Nein, nur bei Berger. Was hat dieser Mann nur an sich, dass er dich immer wieder auf die Palme bringt?«
»Das fragst du jetzt nicht ernsthaft, oder?«
»Nein, mach ich nicht«, erwiderte Jens glucksend. »Wir kennen ihn doch alle gut genug, um zu wissen, dass es meistens an ihm liegt.«
Sie wollten gerade die Klinik verlassen, als Jens anhielt. »Was hältst du davon, wenn ich uns Kaffee und Kuchen aus der Cafeteria besorge? Wenn wir wieder auf der Wache sind, haben wir uns eine kleine Pause verdient.«
»Hört sich super an. Ich bin auf alle Fälle dabei. Brauchst du Hilfe?«
»Nein, das schaff ich allein. Du kannst schon zum Wagen gehen.«
Christina sah dem davoneilenden Rettungssanitäter lächelnd nach. Sie mochte ihn und seine fröhliche Art. Er brachte sie zum Lachen, und das konnten nicht viele Männer von sich behaupten. Meistens lösten sie ganz andere Gefühle in ihr aus. So wie Erik Berger, dem sie am liebsten …
›Stopp!‹, rief sie sich zur Ordnung und zwang sich, an etwas anderes zu denken. Sie wollte sich nicht mehr über diesen unmöglichen Kollegen aufregen oder auch nur einen Gedanken an ihn verschwenden.
Sie verließ die Behnisch-Klinik über den abseits gelegenen Seiteneingang. Er führte zur Einfahrt für die Rettungswagen und war für den normalen Besucherverkehr nicht zugänglich oder einsehbar. Dadurch konnten schwerkranke Patienten auf den kürzesten Weg in die Aufnahme gebracht werden, ohne den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein.
Als Christina am Wagen ankam, stutzte sie. Die Seitentür stand offen. Hatten sie etwa vergessen, sie zu schließen? Beim Näherkommen schoss ihr der Schreck in die Glieder. Im Wagen sah es aus, als wäre ein Tsunami hindurchgefegt. Alle Schubladen waren herausgerissen worden, ein Teil des Inhalts lag auf dem Boden zerstreut, vieles fehlte. Diebe! Sie musste die Polizei rufen! Als sie herumfuhr, um nach vorn zum Funkgerät zu laufen, sah sie sich plötzlich zwei vermummten Männern gegenüber, die Pistolen auf sie richteten.
»Keinen Mucks, Frau Doktor!«, zischte ihr der Kleinere von beiden zu. »Sie halten jetzt schön den Mund und kommen mit uns mit!«
Unfähig sich zu rühren, blieb Christina an ihrem Platz stehen. Wie das Kaninchen die Schlange starrte sie die Pistolenläufe an. Als sie unsanft am Oberarm gepackt und fortgezogen wurde, wehrte sie sich nicht. Erst als sie vor einem dunklen Transporter stand und in das Innere des leeren Laderaums blickte, kehrten ihre Lebensgeister zurück. Sie durfte da nicht einsteigen! Sie durfte da auf gar keinen Fall einsteigen!
Sie riss sich los und versuchte fortzurennen. Doch ohne Erfolg! Eine grobe Männerhand legte sich ihr von hinten auf den Mund. Dann wurde sie einfach hochgehoben und ins Wageninnere geworfen, bevor sich die Tür mit einem lauten Knall schloss.
Berger schmiss wütend den Hörer aufs Telefon. »Die Polizei kommt sofort.« Dann brüllte er Jens Wiener an: »Wie konnten Sie das nur zulassen? Sie …«
»Was ist hier los?« Daniel Norden kam atemlos in die Notaufnahme gestürzt. Vor einer Minute hatte Schwester Anna völlig aufgelöst bei seiner Assistentin angerufen und von einer Entführung gesprochen. Daniel war sofort losgerannt. Hatte es sich etwa herumgesprochen, dass Sina und Vincent Beerenburg entführt wurden?
»Was hier los ist?« Erik Berger war außer sich. »Dieser Mann«, wild mit den Armen fuchtelnd zeigte er auf Jens Wiener, der leichenblass und sichtbar geschockt auf einem Stuhl saß. »Dieser Mann hat zugelassen, dass irgendwelche Kerle Christina Rohde entführt haben.«
»Zugelassen?«, verteidigte sich Jens. »Was sollte ich denn machen? Als ich aus der Klinik kam, habe ich gerade noch gesehen, wie diese Typen sie in den Transporter warfen. Und dann sind sie auch schon losgeprescht. Ich bin noch hinterhergerannt, aber was konnte ich schon zu Fuß ausrichten?«
»Die Verfolgung aufnehmen! Was sonst? Sie haben einen Rettungswagen mit Blaulicht und …«
»Moment!«, rief Daniel so laut, dass alle zusammenzuckten. »Frau Rohde wurde entführt? Wurde die Polizei verständigt?«
»Ja«, sagte Berger und rang mühsam um Fassung. »Ich habe auch eine Beschreibung des Wagens durchgegeben. Sie leiten sofort die Fahndung ein. Außerdem kommen sie gleich her, um die Aussage unseres Helden hier aufzunehmen.«
»Greifen Sie mich schon wieder an? Jetzt reicht’s aber.«
»Ja, das sehe ich auch so!« Daniel legte alle Autorität, zu der er fähig war, in seine Worte. »Sie halten jetzt beide sofort den Mund und lassen mich wenigstens eine Minute in Ruhe nachdenken.«
Diesen Ton waren die beiden Männer von dem stets so besonnenen Chefarzt nicht gewohnt. Verblüfft schwiegen sie und warteten ab, ohne sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen.
Daniel brauchte nicht lange, um einen Entschluss zu fassen. Er zeigte auf die beiden Männer: »Sie kommen jetzt mit mir. Und Sie, Schwester Anna, informieren mich, sobald die Polizei eintrifft. Wir sind auf der Inneren.«
Auf den Weg zur Inneren ließ sich Daniel alle Einzelheiten erzählen. Dann berichtete er von Vincent Beerenburg und Schwester Sina.
»Sie glauben an einen Zusammenhang«, schlussfolgerte Erik sofort richtig.
»Natürlich. Zwei Entführungsfälle innerhalb weniger Tage kann kein Zufall sein. Ich bin mir sicher, dass das die Herrschaften von der Kripo genauso sehen.«
Erstaunt riss Erik die Augen auf, als sie Valentina Beerenburgs Zimmer betraten. Hier erinnerte nicht mehr viel an ein Patientenzimmer. Auf sämtlichen Tischen und Abstellflächen standen Computer, Drucker und andere Geräte, von denen er noch nicht mal wusste, wofür sie gut waren. Mehrere Männer, die eindeutig keine gewöhnlichen Besucher waren und auch nicht zum Klinikpersonal gehörten, bevölkerten den Raum. Mittendrin Valentina Beerenburg, mit Fee Norden an einer Seite und ihrem Sohn Ludwig an der anderen. Und es gab noch jemanden, der ihm kein Fremder war.
»Ich kenne Sie«, sagte Erik zu Björn Lange. »Sie lagen mal bei mir in der Aufnahme mit einem leichten Schädeltrauma.«
»Stimmt. Guten Tag, Herr Berger.« Björn sah fragend zu Daniel Norden. »Ich nehme an, es gibt einen triftigen Grund, warum Herr Berger und Herr …«
»Wiener«, stellte sich Jens schnell vor.
»… und Herr Wiener hier sind.«
Daniel nickte. »Ja, es gab schon wieder eine Entführung. Eine Ärztin wurde entführt, zusammen mit der halben Ausrüstung des Rettungswagens. Ihre Kollegen sind zwar schon informiert, aber ich war mir sicher, dass Sie das wissen wollen.«
»Erzählen Sie mir genau, was passiert ist! Jede Einzelheit!« Björn Lange lauschte angespannt den Worten des Rettungssanitäters. Leider war es nicht viel, was Jens Wiener zu sagen hatte. Er war zu spät gekommen, vollbepackt mit zwei Kaffeebechern und einem Kuchenpaket. Bis er begreifen konnte, was dort draußen überhaupt geschah, fuhr der Transporter auch schon los. »Ich habe mir das Nummernschild gemerkt. Ihre Kollegen haben es schon bekommen.«
»Gut«, erwiderte Björn. »Obwohl es sicher gefälscht oder gestohlen ist.«
»Was bedeutet das alles?« Ludwig war aufgesprungen. »Seit Stunden warten wir vergeblich auf einen Anruf der Entführer. Die Geldübergabe sollte längst erledigt sein! Und nun das! Erst mein Sohn und jetzt diese Ärztin. Warum wird denn eine Ärztin entführt? Es muss etwas Schreckliches passiert sein!«
»Dass diese beiden Entführungsfälle zusammenhängen, ist nicht erwiesen, Herr Beerenburg.« Björn Lange klang nicht so überzeugt, wie er es sich wünschte. Er wusste das, deshalb konnte er auch gleich ehrlich sein und offen sagen, was er von den neuen Entwicklungen hielt. »Aber im Moment müssen wir davon ausgehen.«
Valentina schluchzte leise auf.
»Noch ist nicht alles verloren, Frau Beerenburg«, sprach Fee beschwörend auf sie ein. »Mag sein, dass jemand verletzt ist und dass deswegen Frau Dr. Rohde entführt wurde. Wenn dem so ist, dann haben die Verbrecher mit Frau Rohde eine gute Wahl getroffen. Sie ist eine hervorragende Ärztin, der ich jederzeit mein Leben anvertrauen würde.«
*
Christina Rohde gehörte nicht zu den Frauen, die still litten und alles über sich ergehen ließen. Niemand durfte sie einfach so kidnappen und wie einen Sack Zement in den Laderaum eines Transporters werfen. Sie war wütend auf diese Männer, die ihr das angetan hatten. Aber sie war auch wütend auf sich, weil sie es ihnen so leicht gemacht hatte. Diese Wut ließ sie jetzt raus. Sie trommelte mit beiden Fäusten an die dünne Blechwand, die den Laderaum vom Fahrgastraum trennte. Dabei brüllte und schimpfte sie, so laut sie konnte, obwohl sie wusste, dass das nichts an ihrer Lage ändern würde. Aber es ging ihr damit besser, und sie fühlte sich weniger hilflos und ohnmächtig. Irgendwann gab sie schließlich auf. Sie hatte sich die Knöchel wundgeschlagen, und der Hals tat ihr vom Schreien weh. Auf ihrer Stirn ertastete sie eine schmerzhafte Beule und verschorftes Blut. Sie musste sich den Kopf gestoßen haben, als die Männer sie in den Wagen geworfen hatten. Zu allem Überfluss stiegen ihr nun auch noch Tränen in die Augen. Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Sie wollte nicht weinen und in Selbstmitleid zerfließen. Sie war eine Kämpfernatur und kein verschüchtertes Rehlein. Diesen beiden Verbrechern gönnte sie nicht den Triumph, sie zum Weinen zu bringen. Dafür war sie viel zu wütend auf diese Kerle!
Die Wut, die sie jetzt fühlte, tat ihr gut. Mit ihrer Wut kam sie klar, mit Angst und Panik nicht. Sie atmete tief ein und suchte dann in ihren Jackentaschen nach einem Taschentuch, um ihre Tränen zu trocknen. Als ihr dabei ein fester Gegenstand in die Hand fiel, hätte sie vor Freude fast aufgelacht. Was für Idioten!, dachte sie mit einem hämischen Grinsen. Kommen noch nicht mal auf die Idee, meine Taschen zu durchsuchen.
Glücklich holte sie ihr Handy raus und wählte den Polizei-Notruf.
Sina betrachtete kummervoll den Verband. Er war schon wieder durchgeblutet, und Vincent ging es immer schlechter.
»Schau nicht so besorgt«, sagte er schleppend. »Es … es wird alles gut werden … Das hab’ ich … dir doch versprochen.«
»Ja, natürlich.« Sina tupfte ihm vorsichtig den kalten Schweiß vom Gesicht. Dann umfasste sie sein Handgelenk und kontrollierte unauffällig seinen Puls. Er war kaum noch tastbar und raste furchtbar schnell. Vincent hatte durch den Blutverlust einen Schock erlitten. Er würde nicht mehr lange durchhalten, sollte nicht bald Hilfe kommen.
Als sie seinen Verband wechselte, dämmerte er wieder weg. Das geschah jetzt immer häufiger. Seine Wachphasen waren nur noch kurz, und er war zu schwach, um die Augen offenzuhalten oder zu sprechen.
Die Entführer hatten sich nicht mehr blicken lassen. Sie hatten Vincent aufs Bett gelegt und waren dann verschwunden. Sina fiel es immer schwerer zu glauben, dass diese Entführung ein glückliches Ende nehmen würde. Wie sollte das möglich sein, wenn Vincent starb? Hastig wischte sie ihre Tränen fort. Sie durfte nicht weinen. Wenn Vincent die Augen aufschlug, sollte er keine Tränen sehen, sondern Zuversicht. Sie wollte ihm Hoffnung geben, auch wenn es keine mehr gab.
Sie hörte Schritte und erkannte den tiefen Bass des Hünen. Noch nie war sie so froh gewesen, seine Stimme zu hören. Sie hatten sie hier nicht vergessen! Sie waren zurückkommen!
Sina sprang auf, als die Tür aufging, und sah sprachlos zu, wie Frau Dr. Rohde unsanft in den Raum gestoßen wurde. Dann folgten mehrere Taschen und Rucksäcke, die eindeutig zur Ausstattung eines Rettungswagens gehörten. Nach nur wenigen Sekunden schloss sich die Tür wieder, und die Männer waren fort.
Sofort sprang Christina auf, schnappte sich die erstbeste Notfalltasche und sprintete zum Bett hinüber, auf dem Vincent regungslos lag.
»Sind Sie okay?«, fragte sie Sina.
»Ja … ja. Aber Vincent …«
»Ich seh schon. Ein Durchschuss? Gibt es eine Austrittswunde auf dem Rücken?«
Sina schüttelte den Kopf. »Nein. Die Kugel steckt noch drin, und die Blutung will einfach nicht aufhören.«
»Darum kümmere ich mich sofort. Suchen Sie in den Taschen nach Ringerlösung und Infusionsbesteck. Wir legen ihm zuerst einen Zugang und geben ihm Flüssigkeit. Danach hol ich die Kugel raus und versorge die Wunde. Chirurgisches Besteck ist auch in einer Tasche. Sie müssen mir assistieren. Meinen Sie, Sie stehen das durch?« Christina warf der jungen Schwester einen prüfenden Blick zu. »Sie sehen aus, als würden Sie gleich zusammenklappen. Sie haben bestimmt Einiges durchmachen müssen.«
»Ich werde klarkommen. Um mich brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Kümmern Sie sich bitte nur um Vincent.«
»In Ordnung.« Christina wusste, sie würde sich auf Sinas Worte verlassen können. Der Mann, den Sina liebte, war in Gefahr. Ihm musste jetzt geholfen werden. Alles andere hatte Zeit. Das galt auch für Christina. Sie verbot sich, über ihre eigene prekäre Lage nachzudenken. Im Moment war sie kein Entführungsopfer, sondern Ärztin, in deren Händen ein Menschenleben lag. Auch wenn ihre Nerven blanklagen, musste sie Ruhe bewahren. Ihr Pflichtgefühl und ihr starker Wille halfen ihr dabei. Später, wenn sie wieder zu Hause war, würde sie sich erlauben, alles herauszulassen, was gerade in ihr brodelte. Dann war der richtige Moment für Tränen, Angst und Verzweiflung. Aber jetzt noch nicht. Jetzt war sie nur eine Notärztin.
Als die Arbeit getan war, wagte Sina, die Frage zu stellen, die sie am meisten beschäftigte: »Wird er durchkommen?«
»Ja, ganz sicher.« Christina zog ihre Handschuhe aus und warf sie auf den Boden. »Haben Sie noch einmal den Blutdruck gemessen.«
»Hundert zu sechzig.«
»Sehr gut, es wird langsam. Die Blutung wurde gestoppt, die Wunde ist versorgt. Er bekommt erst mal genügend Flüssigkeit, um einen Teil des Blutverlusts auszugleichen. Sobald wir in der Klinik sind, braucht er noch ein oder zwei Blutkonserven. Den Rest übernimmt sein Körper. Er ist jung und stark. Er wird es schaffen. Noch wirkt die leichte Narkose, die ich ihm gegeben habe. Wenn er wieder wach wird, liegt er bereits in einem Klinikbett.«
»Wer weiß, wann das sein wird.« Sina klang dabei so traurig und verzweifelt, dass Christina sie einfach einweihen musste.
»Bald«, flüsterte sie Sina zu. »Sehr bald. Die Polizei wird jeden Augenblick hier eintreffen.«
»Aber niemand weiß, wo wir sind.«
Christina lächelte. »Irrtum. Unsere Kidnapper sind zum Glück nicht die Hellsten. Sie hatten mich in ihren Wagen geworfen, ohne mir mein Handy abzunehmen. Ich habe noch während der Fahrt mit der Polizei telefoniert und ihnen meinen Live-Standort geschickt. Sie werden sicher bald hier sein.«
Die Worte der Ärztin zauberten ein Lächeln in Sinas Gesicht. Kurz darauf drangen laute Rufe und Polizeisirenen an ihr Ohr. Nur Minuten später wurde die Kellertür aufgesperrt, und sie wurden befreit.
Sina und Christina blieben bei Vincent, als ihn zwei Sanitäter auf eine Trage legten und nach draußen brachten. Dort herrschte Hochbetrieb. Überall standen Streifenwagen, deren blaue Rundumleuchten bizarre Lichtreflexe an den abendlichen Himmel sandten. Sina gelang ein kurzer Blick auf die beiden Männer, in deren Gewalt sie fast zwei Tage verbracht hatten. Sie trugen jetzt Handschellen, und Sina sah zum ersten Mal ihre unverhüllten Gesichter. Merkwürdig, dachte sie. Wenn sie ihnen irgendwo auf der Straße oder im Supermarkt begegnet wäre, hätte sie sie für ganz normale, gesetzestreue Bürger gehalten. Ihr wäre nie der Gedanke gekommen, dass dies zwei Schwerverbrecher waren, die sich nicht scheuten, Unschuldige zu entführen und deren Leben in Gefahr zu bringen.
Soeben fuhr ein weiteres Polizeiauto auf den Hof des alten Bauernhauses, dicht gefolgt von einem zweiten Rettungswagen. Die Menschen, die jetzt ausstiegen und zu ihnen liefen, kannte sie. Ludwig Beerenburg erreichte sie zuerst.
»Wie geht es meinem Sohn?«, fragte er atemlos. »Wie schlimm ist es?«
»Er hat eine Schussverletzung, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr und wird sich sicher schnell erholen«, beantwortete Christina Rohde seine Fragen. »Ihr Sohn wird jetzt in die Behnisch-Klinik gebracht. Wenn Sie möchten, können Sie mitfahren.«
»Natürlich!« Ludwig sprang sofort in den Rettungswagen. Er griff nach Vincents Hand und drückte sie. Dann strich er ihm über die Wange und sprach leise auf ihn ein. Auch wenn Sina nicht verstand, was er seinem bewusstlosen Sohn sagte, wusste sie doch, dass dies ein besonderer Moment war, der nur Vater und Sohn gehörte. Für sie war hier kein Platz. Selten war sie sich so fremd und überflüssig vorgekommen wie in diesem Augenblick. Sie wollte sich traurig abwenden, als Ludwigs Stimme sie aufhielt: »Schwester Sina! Wo wollen Sie denn hin?«
Ludwig Beerenburg hielt ihr eine Hand entgegen und sagte weich: »Worauf warten Sie noch? Kommen Sie endlich! Sie wollen meinen Sohn doch sicher nicht allein lassen.«
Mit einem glücklichen Lächeln griff Sina nach Ludwigs Hand und nahm ihren Platz an Vincents Seite ein.
Mit dem zweiten Rettungswagen waren Erik Berger und Daniel Norden angekommen. Sie ließen sich von Christina Rohde alles Nötige sagen, dann sprang Daniel zu Vincent in den Wagen. »Ich fahre hier mit«, entschied er. »Sie, Frau Rohde, nehmen mit Herrn Berger den anderen Wagen. Während der Fahrt kann sich Herr Berger Ihre Wunde ansehen.«
»Meine Wunde?«, fragte Christina verblüfft.
Daniel tippte sich an die Stirn und wies anschließend auf Christina. »An Ihrem Kopf, Frau Kollegin.« Dann fiel die Tür zu, und der Wagen setzte sich in Bewegung.
Christina rührte sich nicht von der Stelle. Sie starrte dem davonfahrenden Rettungswagen hinterher und versuchte zu begreifen, dass es nun an der Zeit war loszulassen. Die Entführung war vorbei, ihr war nichts geschehen, und auch Vincent Beerenburg würde aus dieser Geschichte unbeschadet herauskommen. Es war alles getan, und sie konnte nun endlich aufatmen. Doch das war schwerer, als sie dachte. Sie konnte nicht einfach einen Knopf drücken, um aus dem Gefahrenmodus herauszukommen.
»Kommen Sie, Frau Rohde.« Eine Hand legte sich auf ihren Oberarm, um sie sanft zum anderen Rettungswagen zu lenken. Sie brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass diese Hand und die mitfühlende, weiche Stimme zu Erik Berger gehörten. Verwirrt sah sie ihn an.
»Wir fahren jetzt in die Klinik«, erklärte er ihr nachsichtig, als spreche er mit einem kleinen Kind.
Unwillig schüttelte Christina seine Hand ab. »Natürlich!«, sagte sie dann schroff und stieg in den zweiten Rettungswagen ein. Als Berger von innen die Tür schloss und sich zu ihr setzte, sagte sie: »Wenn Sie mir einen Spiegel besorgen, kann ich mich allein um die kleine Schramme kümmern. Ich brauche Ihre Hilfe nicht.«
»Hätte ich auch nie angenommen«, erwiderte Berger gelassen, ohne eine Miene zu verziehen. Er griff nach einem Fläschchen mit Wunddesinfektion und einer Mullkompresse und machte sich einfach an die Arbeit. Mit einer Sanftheit, die sie nie bei ihm vermutet hätte, tupfte er ihre Wunde ab. »Es ist nur eine oberflächliche Verletzung«, erklärte er ihr dann. »Ein Pflaster reicht aus.«
»Hm«, erwiderte Christina nur. Sie schämte sich dafür, aber sie genoss seine Fürsorge. Es tat ihr gut zu wissen, dass es hier jemanden gab, der sich ihrer annahm. Bei dem sie sich sicher und behütet fühlte. Instinktiv wusste sie, auf Berger konnte sie sich verlassen. Er würde sich um sie kümmern und nicht zulassen, dass man sie wieder entführte. Sie war ihm dankbar dafür, dass er ihre Verletzung versorgte, dass er ihr dieses Pflaster auf die Stirn klebte und dann, ohne ein Wort zu verlieren, nach ihren Händen griff. Ihre Augen folgten seinem Blick, und erst jetzt sah sie, dass ihre Fingerknöchel blutig waren. Und plötzlich kehrten die Erinnerungen mit voller Wucht zurück. Sie war wieder in diesem dunklen Transporter gefangen und schlug panisch auf eine Blechwand ein, die sie von ihren Entführern trennte. Die Wunden, die dabei entstanden waren, hatte sie nicht bemerkt. Sie hatte keinen körperlichen Schmerz gefühlt, nur diese schreckliche Angst.
Und während sie nun Erik Berger zusah, wie er ihre Wunden versorgte, war die Angst wieder da. Sie war so heftig und präsent, dass Christina meinte, nie wieder unbeschwert und fröhlich sein zu können. Ihr fiel nicht auf, dass sie zu weinen begann. Erst als Erik sie in seine Arme zog, bemerkte sie ihre tränennassen Wangen. Sie wollte diese Tränenflut, die unaufhörlich aus ihren Augen strömte, stoppen. Aber es gelang ihr nicht. Irgendwann gab sie es auf. Sie sah ein, dass es viel einfacher war, sich ihren Gefühlen hinzugeben und sich laut schluchzend an Bergers Brust auszuweinen, als diese übergroße Angst in ihrem Innern zu unterdrücken. Es tat so gut, alles aus sich herauszulassen.
Erik ließ sie während der gesamten Fahrt nicht los. Er hielt sie fest in seinen Armen und gab ihr so Halt und Sicherheit. Nie hatte sich Christina so geborgen gefühlt wie hier, in diesem Rettungswagen. Ein Teil von ihr wollte, dass diese Fahrt nie aufhörte und sie für immer und ewig hier sitzenbleiben könnte.
Als sie vor der Behnisch-Klinik anhielten, hatte sie sich beruhigt, und ihre Tränen waren versiegt. Erst jetzt löste sie sich aus Bergers Umarmung.
Verlegen sah sie ihn an. In seinen Augen entdeckte sie eine Wärme und Anteilnahme, die sie dort nie vermutet hätte. Das brachte sie so durcheinander, dass es ihr unmöglich war, einen klaren Gedanken zu fassen. Erst als die Tür von außen aufgerissen wurde und Jens Wiener in den Wagen sprang, löste sich ihre Starre. Sie ließ es dankbar zu, dass Jens sie an sich drückte, und schaffte sogar ein leises Lachen.
»Mann, Doktorchen, bin ich froh, dich wiederzusehen«, rief Jens erleichtert aus. »Lass dich mal anschauen!« Er schob sie ein wenig von sich und musterte sie. »Hm, du siehst aus, als hätte dich eine Elefantenherde überrannt. Nichts, das man nicht mit einer Gesichtstransplantation wieder hinbekommen könnte.«
»Frechheit«, rief sie lachend und ließ sich von ihm aus dem Wagen helfen. Draußen blieb sie stehen und blickte zurück. Erik Berger saß noch immer auf seinem Platz und sah sie an.
»Danke!«, sagte Christina leise.
Erst jetzt rührte er sich. Spöttisch verzog er den Mund. »Ich habe nur meine Arbeit gemacht, Frau Kollegin. Mit einem Spiegel hätten Sie das sicher auch allein hinbekommen.«
Nachdenklich musterte sie ihn, dann atmete sie erleichtert auf. Zwischen ihnen hatte sich nichts geändert, sie waren wieder in der Normalität angekommen und konnten sich noch immer nicht leiden. Als Jens sie mit sich fortzog, war alles wieder beim Alten.
Erik Berger sackte auf seinem Platz zusammen und stierte minutenlang vor sich hin. Als ein Rettungssanitäter kam, stand er auf, um in die Notaufnahme zurückzukehren. Es wurde Zeit, an die Arbeit zu gehen. Zeit für das, was in seinem Leben zählte.
*
Valentina Beerenburg sah sich ein letztes Mal in dem Zimmer um, das in den vergangenen zehn Tagen ihr Zuhause gewesen war. Ihre Tasche war gepackt, und sie wartete jetzt nur noch auf Ludwig, der sie abholen wollte.
Doch statt Ludwig kam Schwester Lore ins Zimmer. »Ihr Sohn ist gerade gekommen, Frau Beerenburg. Er hat die Nordens auf dem Flur getroffen und spricht jetzt mit ihnen.«
»Dann sollte ich mich am besten dazugesellen.« Valentina griff nach ihrer Handtasche, während Lore die prall gefüllte Reisetasche übernahm.
Daniel lächelte, als er Valentina sah. »Sie wollen uns also wirklich verlassen, Frau Beerenburg.«
»Möchten Sie, dass ich bleibe?«, gab Valentina augenzwinkernd zurück. »Ich fürchte, ich werde Ihnen einen Korb geben müssen. So gut es mir auch bei Ihnen gefällt, ich bin froh, wieder nach Hause zu kommen. Zehn Tage reichen.«
»Recht haben Sie«, erwiderte Daniel. »Bei Ihrem ausgezeichneten Gesundheitszustand haben Sie in einer Klinik auch nichts verloren.«
Ludwig nahm die Tasche hoch, die Schwester Lore abgestellt hatte. Mit der freien Hand verabschiedete er sich von Fee und Daniel. »Vielen Dank für alles. Hätten Sie uns in der schweren Zeit nicht zur Seite gestanden, wäre es für uns ungleich schwerer gewesen, das durchzustehen.«
»Es ist alles gut ausgegangen, nur darauf kommt es an«, sagte Fee. »Vincent erholt sich gut von seiner Verletzung. Auch die seelischen Wunden werden verblassen. Er und Sina werden das schaffen.«
»Davon bin ich fest überzeugt«, entgegnete Valentina sofort. Zu Daniel sagte sie: »Es war übrigens sehr nett von Ihnen, Sina ein paar freie Tage zu gönnen, damit Sie sich von den Ereignissen erholen kann.«
»Und von Ihnen war es sehr nett gewesen, dass Sie in der Zeit mit Schwester Lore vorliebgenommen haben.«
Valentina winkte ab. »Ach, sie ist ja eigentlich eine ganz Nette. Es war also kein großes Opfer. Aber nun wird’s Zeit für mich. Ich möchte noch einen kleinen Zwischenstopp in der Chirurgie einlegen, um mich von unseren beiden Turteltauben zu verabschieden.«
Daniel lachte. »Sie gehen also davon aus, dass Sie Sina im Zimmer Ihres Enkels antreffen werden.«
»Selbstverständlich! In den letzten Tagen war Sina fast ununterbrochen bei ihm. Warum sollte sich das ausgerechnet heute geändert haben?«
Und tatsächlich trafen Valentina und Ludwig in Vincents Zimmer auch auf Sina, die an seinem Bett saß und seine Hand hielt.
»Sie verwöhnen den Jungen zu sehr, meine Liebe«, sagte Valentina schmunzelnd. »Wenn Sie so weiter machen, lässt er Sie nie wieder gehen.«
»Ich hätte nichts dagegen«, erwiderte Sina und erschrak angesichts ihrer mutigen Worte.
Valentina und Ludwig lachten, während sich Vincents Blick bei Sinas Geständnis noch mehr verklärte und er sich nichts sehnlicher wünschte, als Sina endlich in seine Arme zu schließen und zu küssen.
»Ich hätte auch nichts dagegen«, sagte er zärtlich und hatte nur noch Augen für seine Liebste. Für Ludwig und Valentina war dies das sichere Zeichen, dass sie hier überflüssig waren. Mit einem äußerst zufriedenen Lächeln zogen sie sich zurück. Vincent wartete kaum das Schließen der Zimmertür ab, um Sina endlich wieder zu küssen.
»Übertreib es nicht.« Sina streichelte ihm sanft über die Wange. »Du musst dich noch ein wenig schonen.«
»Mir geht es gut, mein Liebling. Und das habe ich nur dir zu verdanken. Wenn du nicht gewesen wärst …«
»Nein, das stimmt nicht«, unterbrach ihn Sina überrascht. »Ich habe doch gar nichts getan. Frau Dr. Rohde war es, die die Blutung gestoppt und die Kugel entfernt hat.«
»Ja, aber sie hat mir nicht das Leben gerettet. Das warst nur du. Du hast an meinem Bett ausgeharrt, du hast mir gesagt, dass ich dich nicht verlassen soll. Wenn du nicht …« Er musste schlucken. »Wenn du nicht bei mir gewesen wärst, hätte ich es nicht geschafft. Ich hätte aufgegeben und nicht gekämpft. Aber so … ich hatte doch gerade erst meine große, meine einzige Liebe gefunden. Die wollte ich nicht verlieren. Für dich und für unsere Liebe wollte ich am Leben bleiben. Ich liebe dich so sehr.«
»Ich liebe dich auch.« Sina blinzelte schnell die Tränen fort. Sie wollte jetzt nicht weinen, auch wenn es Freudentränen waren. Sie wollte nur ihren Vincent und das große Glück, das er ihr schenkte.