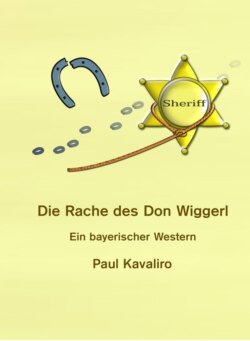Читать книгу Die Rache des Don Wiggerl - Paul Kavaliro - Страница 8
ОглавлениеBegegnungen
Wie weit hatte es Ludwig in der Untersuchung schon vorangeschafft? Nachdenklich ließ er die Notizen in seinem Büchlein Revue passieren. Nun, die geraden Wege zum Ziel hatte er abgeklappert: Ein Verdächtiger hatte sich weder auf dem Überwachungsvideo noch in der Untersuchung des Dorfsheriffs verfangen. Also blieben nur die verschlungenen Pfade. Sonst war das hier auch kein richtiger Fall, wie man ihn im Krimi oder im Western zu sehen bekam. Letzterer fing ja auch nicht gleich mit dem finalen Duell von Gut und Böse an, sondern die Handlung entwickelte sich und die große Schießerei gab es erst am Schluss.
Ludwig dachte sich, dass er als Nächstes Präsenz auf der Ranch zeigen – schließlich machten das Leute mit „Verantwortlicher“ im Titel so – und dabei weiter beobachten sollte. Und er fragte dann dabei den einen oder anderen nach Details. Hoffentlich ließ sich daraus nach und nach ein Bild konstruieren, das auf die Beweggründe der nächtlichen Aktion hinwies. Schließlich stellte so ein Pferdediebstahl keinen spontanen Freinacht-Streich dar oder wurde von irgendwelchen streunenden Banditen ausgeführt. Dann hätte es mehr dieser Vorfälle gegeben, auch außerhalb der Genglkofener Gegend. Und insbesondere hätte man dann nicht bei der gut ausgebauten Ranch mit ihren Überwachungskameras angefangen, sondern dort, wo die Früchte tiefer hingen.
Also fuhr Ludwig am Morgen mit dem Jeep auf der Ranch vor und sah sich den Pferdebetrieb an. Da wurde gefüttert und ausgemistet, gesattelt und geputzt, da wurden Pferde zum Reiten nach draußen geführt und wieder zurück in den Stall gebracht. Da gab es die Reiter, die mit froher Miene auf ihr Pferd stiegen. Später kehrten sie mit Enttäuschung, weil der Reitspaß schon vorbei war, wieder aus der Wolke 7 der Pferdeträumerei auf den Boden der Tatsachen zurück und widmeten sich anschließend der Pferdepflege.
Alles schien normal hier. Und langweilig. Ludwig gähnte. Er sollte sich einen Kaffee holen, nahm er sich vor und wollte sich gerade in Richtung Elviras Empfang wenden.
„Hallo Ludwig“, hörte er da eine Stimme hinter sich. Sie klang sanft, seidenweich – und weiblich. Er war jetzt von einem auf den anderen Moment hellwach, auch ohne Kaffee. Barbara!
Er schnellte herum. Da stand sie tatsächlich: DIE Barbara. Ludwigs Augen überflogen ihr Gesicht und ihren Körper in rasender Eile, jeden Eindruck wie ein Schwamm aufsaugend. Sie war reifer geworden. Er verglich sie mit seinem Bild von ihr, das er von früher innerlich abgespeichert hatte. Und er musste sagen, dass sie noch schöner aussah. Ihre jugendliche, schlanke Statur war einer erwachsenen, aber immer noch eleganten gewichen. Und die weiblichen Rundungen waren – Ludwig musterte sie atemlos – eindrucksvoll. Und das bildete noch einen schwachen Ausdruck für so viel Attraktivität.
Ludwig kam zu sich. Oh ja, er sollte endlich mal was sagen! „Hallo“, stammelte er. Und auch wenn er es nicht zugeben wollte: Die Aufregung packte ihn, wie damals als Halbstarker. „Hallo, Barbara“, vervollständigte er, jetzt schon mit etwas festerer Stimme. Sie musste ja sonst denken, dass er sich nicht mehr an ihren Namen erinnerte, oder – noch schlimmer – sie gar nicht mehr erkannte.
Doch damit hatte Barbara nicht ernsthaft gerechnet. Dafür standen sie sich früher einfach zu nahe, wenn auch nicht derart nah, dass man es „intim“ nennen konnte.
„Du hütest also unsere Pferde“, scherzte sie und lachte dabei, „wie ein Cowboy.“
Ludwig gestand ihr die Vereinfachung zu: „Kann man so sagen.“
„Und du fängst den Pferdedieb, wie im Wilden Westen?“, fragte sie weiter, so als wollte sie seine Entschlossenheit checken.
„Lässt Toni das fragen?“, rutschte es Ludwig heraus und er biss sich sofort auf die Lippen. Warum denn gleich so garstig? Und dann musste er auch noch diesen Toni ins Bild zerren. Tja, der symbolisierte eben immer noch ein Stück weit ein rotes Tuch; der war an allem schuld, der hatte ihm doch die Barbara weggeschnappt.
„Nein, ich interessiere mich selbst“, erwiderte sie und die Scherzhaftigkeit wich aus ihrer Stimme.
„Natürlich, natürlich“, beschwichtigte Ludwig und ärgerte sich, dass er so ganz und gar nicht cool rüberkam. Es saß im gleichen Dilemma wie früher auch. Er fand einfach nicht den Schalter von bemüht zu selbstsicher. Und auch diese Unterhaltung entglitt ihm. Er versuchte, sich zu fangen. „Ich habe schon auf den Videos etwas gefunden und den Bentheneder habe ich auch schon besucht“, verwies Ludwig auf seine guten Taten.
„Ach, den gibt’s noch?“, fragte Barbara und fand spielerisch zurück in den leichten Ton.
Ludwig nickte. „Ich werde eure Pferde schon finden, ich muss mich noch umsehen“, verwies er auf die Zukunft, um zu verdeutlichen, dass er einem Plan folgte.
„Na dann will ich dich nicht lange aufhalten“, sagte Barbara und wandte sich bereits zum Gehen.
„Oh, ich wollte dich nicht vertreiben!“, setzte Ludwig hastig hinterher. So ein Mist, die Unterhaltung war immer noch am Rutschen. Krampfhaft versuchte er, sie festzuhalten.
„Passt schon“, hauchte Barbara und entschwand wie jemand, der wusste, dass man ihm Blicke nachschickte.
Und Ludwig blickte noch eine ganze Weile. Da hatte er sich über all die Jahre nun so schön von Barbara entwöhnt und – zack – eine Begegnung und schon kam alles wieder: die Schwärmerei, die Aufregung, die Anziehungskraft.
Ludwig hatte damals in der Jugend den Eindruck gewonnen, dass seine Gefühle der Zuneigung sich durchaus nicht in einer Einbahnstraße bewegten, sondern dass da ein Anflug von Erwiderung in Barbaras Augen schimmerte. Zu blöd nur, dass sie sich damals nicht Toni Kohlbayrs vereinnahmendem Charme entziehen konnte.
Bevor alles zusammenbrach und Ludwig in die Staaten zog, da gab es einen Moment, einen ganz speziellen: Sie standen sich gegenüber und unterhielten sich und Barbara kam ihm auf einmal nahe, ihr Gesicht rückte vor seines, seine Augen konnten sonst gar nichts mehr von der Welt sehen, und ihre Lippen näherten sich. Ludwig fieberte auf den erotischen Moment hin, auf die Erfüllung, auf den Kuss. Doch Barbara hielt kurz davor inne und die sinnliche Seifenblase zerplatzte. Danach herrschte für eine lange Zeit Flaute auf Ludwigs Meer der Liebe.
Doch als er schon eine Weile in den USA lebte, da kam wieder eine sanfte Brise auf. Er wollte sich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, aber er hatte auch mal eine Frau. Keine Ehefrau. Eine Freundin? Mehr als das. Eine Lebensabschnittsgefährtin? Ja, so ungefähr. Carrie hieß sie, Carrie Whitworth.
Sie war sein größter Irrtum. Aber dieses Gefühl stellte ebenfalls keine Einbahnstraße dar, es ging vielmehr in beide Richtungen, denn auch sie sah Ludwig als ihren schlimmsten Missgriff an. Die Beziehung hielt nicht lange. Und der traurigste Teil davon war ihre gemeinsame Tochter: Callista. Nein, nicht Callista als Mensch war das Traurige, wie konnte ein Kind das auch jemals sein? Bitter war, nein noch schlimmer: niederschmetternd war, dass er nicht mit ihr zusammensein konnte. Sie lebte drüben, in den USA. Ludwig blieb kaum mehr ein Teil ihres Lebens. Höchstens noch in spärlichen Erinnerungen, manchmal. Aber er hatte sie schon lange nicht mehr gesehen. Nach dem Beziehungs- Aus mit Carrie zogen die beiden weg und obwohl Ludwig nie einen großartigen „Dad“ abgegeben hatte, so schloss sich für ihn dadurch auf schmerzhafte Art ein Zeitfenster, in dem er mit seinem Kind gemeinsame Momente, Erlebnisse und Entwicklung teilen konnte.
Carrie wünschte keine Besuche und Ludwig fühlte sich unsicher, ob er trotzdem den Willen dazu aufbringen sollte. Denn er grübelte überdies, ob seine Gastspiele mehr Schaden als Nutzen anrichteten. Sie konnten das Kind mehr durcheinanderbringen, als sein Gemüt aufzuhellen, nachdem die Nabelschnur nun einmal durchschnitten war.
Ludwig blieb zurück, knietief in der Tristesse des Single-Lebens. Bis soeben, denn die Begegnung mit Barbara hatte etwas in ihm entflammt, das er in der Asche seiner Beziehungsdramen verbrannt geglaubt hatte. Der Gedanke, wieder in Barbaras Nähe zu sein, wärmte Ludwig behaglich das Herz, wie das ein guter Glühwein im Winter schaffte – zusammen mit einem angenehm benebelnden Gefühl auf den Schultern des schwachen, weichen Alkohols. Ludwig war trunken davon, versuchte die kalifornische Tristesse zu vergessen und die bayerische Chance zu umarmen: Er wollte Barbara zeigen, was für ein Kerl er war – wie ein Cowboy, der mit der Peitsche knallte, um auf sich aufmerksam zu machen.
Und tatsächlich, mit Barbara hielt die Dynamik Einzug in Ludwigs Dasein. Er tankte aus der Begegnung mit ihr Energie und Hingabe – gleichsam für ihre Person wie für seine Aufgabe. Alles ging leichter von der Hand – die Beobachtungen auf der Ranch, die Gespräche hier und da.
Und noch etwas brachte die weibliche Begegnung in Bewegung: Jetzt hatte er den zwei wundesten Punkten seiner Vergangenheit und ihren Personifizierungen in Toni und in Barbara nun schon gegenübergestanden. Da konnte er sich vor dem Rest der alten Bekanntschaft mittlerweile auch wieder sehen lassen. Es ging ja nur um ein Gespräch und nicht um ein Duell.
Also griff er zum Telefon und rief seinen alten Bekannten Benny an. Der brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass Ludwig nicht mehr jenseits des Großen Teiches weilte. Scheinbar hatte er ihn, angemessen zu dieser riesigen Distanz, genauso weit in seinen Erinnerungen nach hinten gestellt.
Aber Benny schaffte es dann doch, Ludwig wieder hervorzukramen. In seiner Stimme schwang auch etwas Erleichterung mit, so als ob ein übles Kapitel endlich zu einem guten Ende kam – ein Kapitel, mit dem er ein schlechtes Gewissen verband.
„Recht so“, dachte sich Ludwig, standen doch Benny und Peter damals bei der Konfrontation am Kino nur herum, anstelle ihm zur Seite zu springen.
Na gut, das war angesichts von Tonis Präsenz hier in der Gegend auch ein bisschen viel verlangt. Genau wie in einer typischen Westernszenerie verfügten die Mächtigen auch hier über ihr Terrain und konnten schalten und walten, wie sie wollten. Und dieser Bereich umfasste eben nicht nur die eigene Ranch, sondern auch die nächste Stadt oder das umliegende Dorf gliederten sich, zumindest moralisch, in diesen Besitz ein. Dagegen konnten nur große Westernhelden anstinken. Und weder Ludwig noch Benny waren große Helden gewesen, zumindest im bisherigen Teil der Geschichte.
Ludwig freute sich spitzbübisch bei dem Gedanken, dass er der Story jetzt noch weitere Kapitel hinzufügen konnte. Ob sich sogar das Kräfteverhältnis verschieben ließe? Warum nicht? Jeder durfte ein Held werden!
„Soll ich Peter Bescheid sagen?“, holte ihn Benny aus seinen spitzbübischen Gedanken zurück in die Gegenwart. Nach dem Höhenflug setzte er gemächlich wieder zur Landung an, allerdings zu gemächlich. „Hallo?“, drängte Benny, als die Antwort ausblieb und ihm das alles zu lange dauerte.
„Ach ja, den Peter, ja klar, warum nicht?“, stimmte Ludwig zu und war erleichtert, dass ihm der zweite Telefonanruf erspart blieb. Den Leuten persönlich gegenüberzutreten lag ihm tausendmal mehr, als sich nur fernmündlich in Erinnerung zu bringen.
Sie verabredeten sich noch für den gleichen Abend im Wirtshaus. Ludwig nahm diese Spontaneität als Zeichen der Offenheit seiner Person gegenüber: Wenn man jemanden als unliebsame Erinnerung zur Seite kehren wollte, dann machte man einen Termin in 14 Tagen aus, wobei sich bis dahin noch auf magische Weise Verhinderungsgründe ergeben konnten. Eine kurzfristige Verabredung hingegen suggerierte ein von Freude angetriebenes Wiedersehen. Erleichtert atmete Ludwig durch, als er nach dem Gespräch den Hörer auflegte.
Den Rest des Tages verbrachte er auf der Ranch. Als Sicherheitsmensch musste er schließlich Präsenz zeigen, so wie er sich das vorgenommen hatte. Aus der Distanz schaute er sich die Leute an, beurteilte sie, teilte sie ein. Da gab es zum Beispiel die Bediensteten. Natürlich vermochte es Ludwig nicht, ihnen in die Seele zu schauen. Aber er konnte sie beobachten, ihre Handlungen, ihre Körpersprache, ob irgendwas verdächtig wirkte, ob sie etwas im Schilde führten. Das war natürlich nicht gleich auf den ersten Blick zu entschlüsseln. Er musste also geduldig sein.
Und dann gab es da noch die Kunden, die Reiter und die Pferdekäufer. Die stufte er bis auf weiteres als harmlos ein und ihm erschien das schlüssig: Wenn einem Pferdefreund hier etwas nicht passte, dann konnte er prinzipiell auf einen anderen Hof wechseln.
Natürlich gab es Stammkundschaft auf der Ranch und die waren den Kohlbayrs auch am liebsten. Unzufriedene Kunden hingegen konnten einfach weiterziehen. Das ländliche Leben forderte ohnehin Beweglichkeit und zu Fuß oder mit dem Fahrrad kamen hier vergleichsweise wenige an. Man war vielmehr motorisiert – entweder selber oder, bei jungen Tierenthusiasten, die Eltern. Nicht jeder hatte einen Jeep, so wie Ludwig, aber die Straßen standen gut ausgebaut bereit und auch ein VW Lupo schaffte es spielend ohne Achsbruch zu den Reiterhöfen, selbst wenn sie keine super Zufahrt hatten so wie die Ranch. Dass sich bei all dieser Flexibilität ein derart großer Streit entwickelte, dass Kunden aus Rache Pferde auf der Ranch stahlen, das konnte sich Ludwig bei aller Fantasie nicht vorstellen.
Erst recht galt das, wenn Besitzer ihre Tiere nur hier einstellten. Bei Verdruss nahmen die ihr eigenes Pferd und machten sich von dannen. Fremde Rösser eigneten sie sich deswegen noch lange nicht an.
Aber trotzdem wollte Ludwig wachsam bleiben.
Die Sache mit der Präsenz auf der Ranch sah er als eine der obersten Pflichten. Es wäre schon blöd, wenn unter seiner Obhut weitere Tiere verschwanden. Also musste er sich zeigen, damit die Diebe, so sie noch weitergehende Pläne hegten, sehen konnten, dass da jemand Ausschau hielt und dass sie kein einfaches Spiel hatten. Dann blieben sie hoffentlich fern, die Pferde dafür hier und Ludwig ebenso – er behielt seinen Job. Also schritt er möglichst präsent über das Terrain, schaute hierhin und dorthin, inspizierte Tore und Türen, Weidezäune und Schlösser.
Auch wenn er es nicht gerade darauf anlegte, ein „Rancher“ zu werden, so entfaltete das Pferdeambiente doch eine Wirkung auf ihn. Aus Spaß nahm er sich daher jetzt öfter ein Seil mit, das er auf der Ranch vor der Müllabfuhr gerettet hatte, das man aber noch gebrauchen konnte. Und er übte damit den Lassowurf, wie ein echter Cowboy, einfach nur aus Spaß. Einen Weidezaunpfosten traf er im Laufe der Zeit ganz gut, in durchschnittlich acht von zehn Versuchen. Aber ein bewegliches Ziel, etwa einen richtigen wilden Mustang? Dafür musste er noch viel trainieren. Er wollte das tun, solange es Spaß machte und er Zeit hatte. Kein Zwang. Kein Stress.
Zwischendurch sinnierte er über die Metamorphose, die die Pferde in ihrer Zweckbestimmung im Laufe der Geschichte hingelegt hatten: vom ungestümen Wildfang über das Arbeitstier, das Karren bewegte, zum Kriegsgefährt, das sich an geharnischten Rittern den Buckel krumm schleppte und nach einiger Zeit sogar Kanonen zog, weiter zum Transportmittel, das als Motor Postkutschen vorantrieb, bis ihm die Eisenbahn und später das Auto den Rang abliefen. Heute war das Pferd Sportgerät, Luxusgut und ein stiller Freund.
Hatte es jetzt endlich den Stellenwert erreicht, den es verdiente? Sah man sich die Ranch an, dann konnte man das sagen. Von den Bediensteten hier wurde es gehegt und von den Reitern, die ihm manche Karotte zusteckten, wurde es verhätschelt. Schöne perfekte Welt, wie im Bilderbuch vom Ponyhof. Und Ludwig sicherte denselben mit Präsenz und Kontrollen ab, damit die Ranch auch diese Oase der unbeschwerten Freude blieb, als die sie in der Landschaft leuchtete.
Nur der Vorfall mit den verlorenen Pferden störte. Er fühlte sich an wie ein Kratzer im ansonsten perfekten Lack der Pferdegesellschaft. Und Ludwig war aufgerufen, den zu reparieren. Er spürte die Verantwortung. Er fühlte die Last. Und er zweifelte mit der Zeit am gewählten Ansatz.
Seine Gegenwart hier auf dem Hof war schön und gut, aber kam er wirklich voran? Die fehlenden Pferde standen ja gerade nicht hier auf der Ranch. Sie tummelten sich irgendwo da draußen. Doch wo genau hielt man sie fest? Er hatte noch keine heiße Spur und erhielt auch nicht einen entscheidenden Hinweis von Toni oder vom Dorfsheriff. Und den Rest der möglichen Figuren hatte er noch gar nicht beleuchtet, somit konnten die auch nichts abwerfen. Also war es höchste Zeit, sich dem „Rest“ zu widmen, zum Beispiel Benny und Peter, mit denen er sich am Abend verabredet hatte.
Er traf die beiden im Wirtshaus, wie vereinbart. Das Lokal „Neuwirt“ hieß immer noch so, obwohl es schon lange nicht mehr neu war. Ludwig kannte das Etablissement unter keinem anderen als diesem Namen. Doch jede Tradition musste irgendwann mal angefangen haben. Und in Bayern gab es viele Gebräuche, weil sie eben auch lange anhielten. Neue Anfänge gab es hingegen weniger. Man folgte nicht blindlings jedem frischen Trend. Die Dinge mussten erst ihren Sinn beweisen und in den Köpfen der Mehrheit überzeugen. Nur neu zu sein, das reichte nicht aus.
Dafür gab es Verlässlichkeit. Und so brauchte Ludwig auch nicht lange, um einen kurzen Anflug von Zweifel herunterzuschlucken, ob denn Benny und Peter wirklich zum Treff erschienen. Wenn man hierzulande etwas zusagte, dann stand man auch dazu. Die flatterhafte moderne Welt dagegen erlaubte Absagen quasi inklusive der Einsparung von Peinlichkeiten wie etwa der Begründung von Angesicht zu Angesicht: Eine Nachricht per Messenger oder SMS reichte und man hatte sich der Verabredung entledigt.
Hier in der bayerischen Prärie tickten die Uhren indessen anders. Die Maxime lautete: ein Mann, ein Wort. Und deshalb saßen Benny und Peter schon da, als Ludwig die Wirtsstube betrat. Er hatte sich vorbereitet: Er hatte sich das Aussehen der Freunde in Erinnerung gerufen, damit er sich die Verlegenheit ersparte, die beiden nicht gleich im ersten Versuch zu erkennen.
Zum Glück gelang Ludwig die Identifikation der „Verdächtigen“ auf Anhieb, auch wenn die Zeit Spuren in ihren Gesichtern hinterlassen hatte. Es folgte eine freudige Begrüßung mit festem Händedruck und Schulterklopfen. In der großen Stadt wäre – unter Frauen – ein Bussi auf die Wange links und rechts fällig gewesen. Aber zum Glück stand hier nicht die flatterhafte Stadt, sondern Genglkofen aus echtem Schrot und Korn, und zum Glück waren sie alle Männer – nix da mit Bussi. Umarmung als die nächst-herzlichere Begrüßung ging auch nicht als statthaft durch. Eine solche Geste hätte sie in den landläufig schwerwiegenden Verdacht gebracht, mit dem Hang zum gleichen Geschlecht veranlagt zu sein oder zumindest mit diesem Hang zu sympathisieren. So etwas war nur in der Stadt modern. Hier draußen herrschte dagegen das Prinzip: Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Also war man gefälligst stinknormal und stolz darauf: Händedruck statt unmännlichen Verrenkungen. Wem das nicht passte, der sollte doch woandershin gehen. So einfach war das! Oder so schwer – je nach Veranlagung.
Benny und Peter gehörten bereits hierhin und Ludwig befand sich gerade dabei, wieder zurückzukommen. Also gelang die Begrüßung. Nach dem einleitenden Hallo und dem ersten Prost musterte er die beiden, denn nach ein paar Bieren war die Gelegenheit für einen frischen Eindruck verstrichen und er konnte sich nicht mehr konzentrieren.
Benny und Peter sahen immer noch den beiden Lausbuben ähnlich, die sie waren, als Ludwig damals die Kurve kratzte und über den Großen Teich verschwand. Nur die Zeit hatte hier und da ihre Prägung den Gesichtern aufgedrückt. Sie hatte Bennys Backen aufgeblasen, wo früher fahle Wangen saßen. Er trank sein Bier mit Genuss, das konnte Ludwig sowohl am Tisch beobachten als auch an Bennys Figur und der geschätzten Taillenweite ablesen. Generell schien Benny die lebenswerten Seiten des Daseins zu begrüßen. Er sprach von den Kindern und vom Urlaub, vom guten Essen und von all den tausenden Sorten von Getränken, die er schon ausprobiert hatte. Wäre er nicht Handwerker und als solcher stets in rastloser Bewegung, dann fiele seine Leibesfülle noch größer aus. So vermittelte er aber einen fitten Eindruck – stabiler Körperbau, aber geschmeidig. Mehrmals klopfte er Peter auf die Schultern und nannte ihn „Bohnenstange“.
Das passte. Peter blieb der dürre Schlaks, der er schon früher war. Wo Bennys Pausbacken dem Gesicht Struktur gaben, da hatte bei Peter das Leben Furchen gezogen. Seine Falten gaben ihm einen angestrengten Gesichtsausdruck. Nur wenn er lachte, da formierten sie sich zu tausend kleinen Linien von Humor und Freundlichkeit. Peter konnte man eben nicht so leicht in eine Schublade stecken und darum ging es ja heute auch nicht. Wenn er erzählte, dann von seiner Arbeit, dass er jeden Tag eine gute Strecke in die City fahren musste und dass er oft im Dunkeln aufbrach und auch erst wieder in der Finsternis zurückkehrte. Von Frauen, Kindern, Familie gab es keine Signale zu empfangen. Also brach er früh als Single auf und kehrte auch als solcher zurück. Und jemand musste ja in der Quote liegen, sonst gäbe es in diesem Lande nicht derart viele Alte und nicht genug Junge. Die Bevölkerungspyramide ließ grüßen.
Als das Gespräch auf die Rubrik „Frauen“ kam, da winkte Ludwig nur ab. Was sollte er hier von Carrie erzählen? Er sei geschieden, sagte er, um das Thema abzukürzen. Damit hatte er seine Ruhe. Die wollte Peter auch haben und schaute demonstrativ weg.
„Haha“, prustete Benny und klopfte Peter Bohnenstange jetzt wieder auf die Schulter. „Du könntest jemanden wie meine Frau gebrauchen. Die gibt stets gut auf mich acht.“
Ruhe am Tisch.
Sollte das eine Provokation gegenüber den Weiberlosen sein? Widerlich, dieser Benny Frauenversteher! Ludwig und Peter setzten ihre Biergläser an, um den aufkeimenden Ärger hinunterzuspülen.
Doch sie prusteten ihren Schluck beinahe wieder hinaus, als Benny trocken dazusetzte: „Sie passt stets auf, dass es mir nicht zu gutgeht.“
Überschwängliches Lachen folgte. Ja, so etwas hatte Ludwig in Kalifornien gefehlt, genau diese Art Wirtshausfrohsinn. Jetzt prosteten sie einander zu in dem beseelten Gefühl, dass jeder von ihnen sein Päckchen zu tragen hatte. Das einte sie.
Das Eis war gebrochen, die Unterhaltung floss locker und angenehm – genau wie das Bier, das sie eines nach dem anderen bestellten. Ludwig bezahlte am folgenden Tag mit Kopfschmerzen dafür, das wusste er jetzt schon. Aber für Reue hatte er morgen noch genug Zeit. Heute ließ er die Sau raus!
Doch bevor er sich vollends dem Strudel der Vergnüglichkeit hingab, erinnerte er sich daran, dass dieses Gespräch nicht nur den vorrangigen Zweck des Wiedersehens erfüllte. Es sollte ihn vielmehr auch auf dem Pfad der Erkenntnis voranbringen, was den Pferdediebstahl anbetraf und wie die Genglkofener Welt aussah und was sie im Innersten zusammenhielt.
Also wartete er auf eine Gelegenheit, das Gespräch an sich zu ziehen, und die kam, als Peter fragte, wie es drüben in den Staaten so lief.
„Ja, ich hatte ja einen großen Abgang hier ...“, wählte Ludwig als Einstieg, mit Selbstironie gespickt.
Betretenes Schweigen am Tisch. Aber er konnte das nicht anders machen: Ludwig musste dieses im bisherigen Abend tunlichst gemiedene Geschehnis, das die Genglkofener Welt vor vielen Jahren in eine ungewohnte, aber schnell wieder abflauende Aufregung versetzte, kurz anschneiden, um das einfach hinter sich zu bringen. Insgeheim hatten sich Benny und Peter etwas zurechtgelegt, eine Ausflucht, einen flotten Spruch, eine Erklärung, wie sie es damals erlebten. Aber sie kamen gar nicht dazu, ihre aus dem schlechten Gewissen geborenen Floskeln aufzusagen, denn Ludwig hüpfte locker darüber hinweg: „… da fiel der Anfang drüben nicht schwer.“ Das war glatt gelogen, denn Ludwig ging nicht mit einem Masterplan über den Großen Teich, sondern sah sich um und lauerte auf eine Gelegenheit, ohne zu wissen, wie die genau aussah. Aber sie ergab sich, und zwar als Überwacher. Das wurde zu seinem Beruf, nachdem er zunächst mit einem Jugendaustausch in die Staaten startete und sich anschließend entschloss zu bleiben. Benny staunte, dass Ludwig sogar eine Qualifikation als Waffenträger besaß. Peter hingegen schwieg dazu, denn die US-amerikanische Fülle an Schießgeräten und der Stolz darauf kamen ihm suspekt vor.
„Egal, jetzt bin ich zurück“, schloss Ludwig seinen kurzen Abriss des inzwischen Geschehenen, in etwa so, wie man in einer Fernsehserie den Inhalt der letzten Folge zusammenfasste, bevor die Handlung weiterging.
„Und jetzt? Hast du schon was? Eine Arbeit?“, fragte der tätigkeitsfokussierte Peter.
„Ja“, antwortete Ludwig und ließ die anderen beiden für einen Moment genussvoll schmoren.
Benny machte eine ungeduldige Handbewegung. Ludwig möge doch die Gnade haben, weiter zu erzählen.
„Ich kläre den Pferdediebstahl auf Tonis Ranch auf“, prahlte er auf den Flügeln des Biergenusses, der ihn zur Übersteigerung trieb.
Und er schlug mit seiner Ansage zwei Fliegen mit einer Klappe: Erstens galt eine Tätigkeit bei Toni automatisch als ehrwürdig, gediegen, über alle Zweifel erhaben und das hatte er hiermit ausgesprochen. Tonis Mitarbeiter besaßen das Ansehen von nützlichen Rädern im Getriebe, von Teilen eines großen Plans. So etwas musste einfach etwas taugen. Darüber gab es keine zwei Meinungen.
Zweitens war damit auch die Frage beantwortet, ob er Toni nach dem persönlichen Inferno am Kino damals und der anschließenden Bedrohungs-Verhaftung schon wieder getroffen, gar mit ihm gesprochen oder – quasi als Krone – sich sogar mit ihm ausgesöhnt hatte. Nun, das Letztere war sogar für Ludwig noch nicht entschieden. Aber er befand sich jetzt in der komfortablen Lage, darauf nicht direkt eingehen zu müssen, sondern darüber die Gedanken der beiden anderen arbeiten lassen zu können. Sicher taten sie auch ihr Übriges, um die Neuigkeiten zu verbreiten: Ludwig und Toni hatten das Kriegsbeil begraben.
Offen blieb dabei die Frage, was heller strahlte – dass „Wiggerl“ zu Kreuze kroch oder dass Toni ihn großzügig in seiner „erweiterten Familie“ aufgenommen hatte. Für Ludwig stand die Antwort darauf fest: Er ließ Tonis Glanz auf sich scheinen, ohne sich zuvor in den Dreck geworfen zu haben.
Ludwig hatte unverhofft noch eine dritte Fliege erlegt: Er hatte das Gespräch auf Toni gelenkt.
Reflexartig brach sich die allgegenwärtige Toni-Verehrung Bahn: Ja, der hatte was geschafft. Der hatte aus etwas Großartigem etwas noch Großartigeres gemacht. Die Ranch war nicht einfach nur ein Pferdehof, sie war eine Art Mega-Ranch und konnte spielend in der neuen Zeit mithalten, in der gediegenes Arbeiten und die Erhaltung des eigenen Status nicht mehr ausreichten. Vielmehr schien nur der gut genug zu sein, der immer einen Schritt voranging, der sich nicht mit „gut“ zufrieden gab, sondern sich auf den Weg zu „besser“ machte. Und das passte auf den Toni und auf seine Frau, die Barbara, die offensichtlich gleichermaßen gut zu ihm passte.
Ludwig nickte nur bestätigend zu all der überschäumenden Anerkennung. Alles andere hätte auch nichts gebracht. Oder hätte ihm hier in der Stube irgendeiner auf die Schulter geklopft und gesagt, dass er und die Barbara ein schönes Paar abgaben? Wohl kaum. The Winner Takes It All. Das blieb ein ewig junger Spruch. Und er galt im Silicon Valley genauso wie in Genglkofen.
Die Verehrung für Toni fiel entsprechend aus: allgegenwärtig.
Aber der bayerische Geist hatte auch eine starke kritische Ader und die absolute Harmonie ging ihm gegen den Strich. Manche sagten auch Nörgelei dazu, aber die waren – selbstredend – allesamt elende Saupreißn. Diese Ader zeigte sich zu Ludwigs Belustigung auch hier, nämlich als das Gespräch auf Tonis Cowboyhut kam. Peter und Benny bogen sich schier vor Lachen. Eine derartige Verbeugung vor dem großen Western-Klischee kam ihnen total abgehoben und unfreiwillig komisch vor. Beseelt vom Alkoholgehalt des guten bayerischen Bieres schütteten sie Lachsalve um Lachsalve aus. Ludwig schaute erst einen Moment, dann nahm er einen herzhaften Schluck aus seinem Glas und stimmte ein. Für ihn bildete das eine genauso unverhoffte wie angenehme Art der Frustbewältigung. Zum ersten Mal seit langem lachte er über Toni. Und das lauthals und in aller Öffentlichkeit! Er musste weit zurückdenken, wann er sich das letzte Mal über den großen Boss von Genglkofen erheitert hatte. Hatte er das überhaupt jemals? Es erschien sinnlos, darüber nachzudenken. Das Bier vernebelte zusehends seine Sinne und sorgte für schlechtes Erinnerungsvermögen, aber dafür für jede Menge Frohsinn. Die drei Saufkumpane lachten, was das Zeug hielt.
„Hatte Toni eigentlich Feinde?“ Ludwig warf die Frage im Moment des höchsten Überschwangs ein und hoffte auf einen letzten Funken Gedächtnis bei den beiden Zuhörern. Er stand kurz davor, vollkommen betrunken zu sein, und musste noch schnell die offenen Haken auf seiner mentalen Checkliste setzen.
Es schallte nur ein noch lauteres Gelächter zurück. Wer sollte sich mit Toni anlegen? Das war die groteskeste Frage, die man in der bayerischen Prärie jemals stellen konnte. Die brauchte keine Antwort.
Und ob er die Pferde selber geklaut hatte, um sie „inoffiziell“ anders zu nutzen? – Noch lauteres Gelächter. Ja warum sollte jemand seine eigenen edlen Gäule zur Seite schaffen? Etwa, um sie in den Zeiten von Fleischskandalen heimlich unter die Lasagne zu mischen? So ein Schmarrn!
Der Wohlgeschmack des Fleisches kam in keinem Pferdeprospekt vor, das die Ranch ausgab, um sich bei der Kundschaft anzudienen. Das war eine Frage, die derart weltfremd klang, dass sie von einem anderen Stern zu kommen schien. Ludwig lachte mit, als hätte er sie aus Spaß gestellt.
Toni wollte aus seinem Betrieb ein Vorzeigeprojekt machen, am liebsten mit Zertifikat, wie man das heutzutage eben machte. Er stand als der Strahlemann mit der unbefleckten Weste da. Warum sollte er da irgendein Risiko eingehen? Eine selbst inszenierte Pferdeentführung zum Beispiel: Solche Vorfälle verschafften einem keine gute Publicity.
Fast schien es Ludwig, als konnte er auch aus dieser Unterhaltung nicht viel Neues zum Fall mitnehmen.
Doch dann ließen Benny und Peter in ihrer Bierseligkeit wenigstens ein paar Gerüchte raus, die sie aufgeschnappt hatten. Es hieß zum Beispiel, dass der Toni Angebote für die Ranch bekäme – von irgendwelchen Spekulanten, die den Hof zu einer Erlebniswelt mit Hotels à la „All Inclusive“ einschließlich Reit- und Westernvergnügen ausbauen wollten. Darauf hatte der Toni scheinbar keinen Bock, hieß es ferner. Er war ein echter Cowboy (die Erinnerung an seinen abgefahrenen Hut brachte neue Lachsalven hervor) und er hielt die Zügel lieber selber in der Hand. Spekulanten konnten gerne woanders das Zepter oder das Lasso schwingen. Doch auf der Ranch nicht, niemals. Da waren sich Benny und Peter einig.
Damit war der Ernst vollends aus dem Fenster geworfen. Die drei Kumpane tranken noch weiter, als ob es kein Morgen gab, bis der „Neuwirt“, der eigentlich ein Alter war, sie nett, aber mit Bestimmtheit ins Freie bat. Die stattliche Rechnung strich er mit Wohlgefallen ein. Sie könnten gerne wiederkommen, mit frischem Hunger und Bierdurst, wann immer sie wollten.
Letzterer war auf unbestimmte Zeit vertagt, das wurde Ludwig am nächsten Tag klar. Er war nur das dünne US-Bier gewohnt und ein ehrlicher, bayerischer Gerstentrank, der haute ganz anders rein. Nein, heute passte ihm kein Hut. Auf den gestern schon befürchteten Kopfschmerz war Verlass und er wich an diesem Tag auch nicht von seiner Seite. Also blieb er im Bett liegen. Es war Wochenende und es gab gewiss nicht gleich einen Volksaufstand, wenn er erst am späten Nachmittag auf der Ranch nach dem Rechten sah.
Nachdem das Wochenende mit Ausschlafen und sporadischer Routineüberwachung auf der Ranch verstrichen war, saß Ludwig am Montag wieder fest im Sattel. Es konnte nicht schaden, neben der stumpfen Bewachung den Ranch-Betrieb etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und dabei insbesondere zu schauen, wer da ein und aus ging: Leute, die zum ständigen Geschäft gehörten und Gäste, eventuelle sogar besondere Gäste.
Und wie der Zufall es wollte, wurde er noch am selben Tage fündig. Da erschienen nämlich ein paar Herren im auserlesenen Anzug und mit noch feineren Manieren. Sie meldeten sich bei Elvira Karl am Empfang an und ließen ihre Umgangsformen Glanz verbreiten: Sie umschmeichelten die ältere Dame mit allerlei Lächeln und „bitte“ und „danke“ und „gnädiger Frau“, dass diese sich umdrehte, ob denn tatsächlich sie gemeint war und nicht irgendeine Berühmtheit, die zufällig hinter ihr stand. Aber ein flüchtiger Blick offenbarte, dass sie die einzige in Frage kommende Zielperson im Raum darstellte – Ludwig abseits an der Kaffeemaschine war unverdächtig – und so erblühte sie wie eine Prärieblume, der ein unverhoffter Regenguss neues Leben einhauchte.
Ludwig wandte sich unbemerkt ab, nachdem er die Herren kurz gemustert hatte. Er wollte nicht auffallen. Er sollte aber den Empfang im Auge behalten und die Männer bei ihrem Abgang erneut beobachten. Ein Vorher-nachher-Vergleich konnte aufschlussreich sein, insbesondere lieferte er Hinweise und Anknüpfungspunkte für Nachfragen bei den Ranch-Mitarbeitern, was denn diese Leute um alles in der Welt hier zu schaffen hatten. Wie Reiter oder wie anderweitige Pferdeexperten sahen sie nämlich nicht aus. Ludwig schlich bedächtig wie ein Scout auf Spurensuche weiter. Er ließ dabei den Sichtkontakt zum Empfang nicht abreißen.
Kaum eine Stunde war vergangen, da kam Bewegung in die Sache. Anton, der Sohn des Hauses, hatte seinen Auftritt. Er expedierte die eleganten Herren nämlich hinaus und geleitete sie sanft, aber nachdrücklich zu ihrem edlen Gefährt. Vom Glanz wie noch bei ihrem Eintreffen konnte man nichts mehr sehen, denn das Lächeln hatte sich aus den Gesichtern der Männer verabschiedet. Scheinbar hatten sie nicht bekommen, wonach sie suchten.
Ludwig setzte sich unterdessen in Richtung Empfang in Bewegung, denn er wollte die frische Gelegenheit nutzen herauszubekommen, was hier gespielt wurde.
Die feinen Herren hatten inzwischen ihre edle Limousine bestiegen. Sie hielten Anton noch flüchtig einen Zettel hin, vermutlich eine Visitenkarte. Der lehnte aber höflich ab und half zur Bekräftigung beim Schließen der Autotür. Dann hob er bei der Abfahrt zum Gruß die Hand, wie jemand, der nicht unfreundlich sein wollte, der aber auch klarmachte, dass jetzt eine zügige Abreise auf dem Programm stand. Als sich die Gäste entfernt hatten, atmete Anton sichtbar durch.
In diesem Moment pirschte sich Ludwig an ihn heran: „Hallo, Anton!“
„Hallo, Herr Donner“, grüßte Anton brav zurück.
Dieser Bursche war wirklich ein Vorbild an Ausgeglichenheit.
„Na, aufdringliche Vertreter abgewimmelt?“, fragte Ludwig scheinheilig, als handelte es sich um Leute, die den neuesten Staubsauger angepriesen hatten und die man mit knapper Not des Feldes verweisen konnte.
„Ja, kann man so sagen“, erklärte Anton unverbindlich.
Verflixt, musste man dem Jungen alles aus der Nase ziehen? Ludwig wollte versuchen, ihn aus der Reserve zu locken. Doch wie?
„Staubsauger?“ Ihm fiel nichts Besseres ein. Irgendetwas musste er sagen, um Antons Mitleid mit seiner Unwissenheit herauszufordern und um die gewünschte Information herauszukitzeln.
„Projektentwickler“, ließ Anton aufblitzen und schwang sich auf zu gehen. Damit sendete er das Signal aus, dass Ludwig keine langen Erklärungen erwarten konnte. Aber in seinem Kopf machte es Klick und er verband das Wort Projektentwickler von soeben mit dem Wort Spekulant, das er gestern im Wirtshaus von Peter und Benny durch den Nebel des Alkohols hindurch gehört hatte.
„Ah, das sind die, die die All-Inclusive-Ranch entwickeln wollen“, spekulierte Ludwig, setzte dazu ein wissendes Lächeln auf und alles auf eine Karte.
Anton überlegte.
Ludwig lauerte.
Jetzt entschied sich, ob sich der Junge ihm gegenüber eher verschlossen oder offen gab.
„Ja, kann man so sagen“, sagte Anton abermals und Ludwig ärgerte sich, dass das anscheinend seine Lieblingsantwort darstellte. Aber immerhin kam er dem Ziel näher: Das mit den Spekulanten oder Entwicklern, wie auch immer man die nennen wollte, war bestätigt.
Und Anton buchte das Gespräch bis hierhin ebenfalls unter Sieg ab, denn er hatte kein Wörtchen gesagt, was dieser oberschlaue Donner-Frager nicht sowieso schon zu wissen schien.
Ludwig erinnerte sich an den alten Spruch aus einem Vorgesetzten-Training, das er mal belegte: Wer fragt, der führt. Und so trachtete er danach, das Katz-und-Maus-Spiel noch ein kleines Stück fortzusetzen: „Aber das wollt ihr nicht.“
Anton nickte: „Warum auch? Wir können die Ranch selber gut führen.“ Er machte eine ausladende Geste nach der Art: Sehen Sie sich doch um, wie alles am Schnürchen läuft!
Jetzt nickte Ludwig und er nahm dem jungen Anton ab, dass er mit dem älteren Toni in diesem Punkt auf einer Wellenlänge lag. Anton hatte ja auch die Visitenkarte der Projektentwickler abgewehrt. Damit schien die Spekulanten-Sache geklärt, zumindest fürs Erste.
Womöglich hatten die Männer im feinen Zwirn ja auch ein Angebot abgegeben und das lag einfach noch zu niedrig? Geld regierte die Welt und mit genug Anreiz war alles möglich, wenn’s sein musste, dann eben auch später.
Und da Ludwig nun schon einmal im Gespräch mit Anton stand, wollte er noch nachbohren, ob die beiden Kohlbayr-Männer immer so ein Herz und eine Seele waren, wie es den Anschein hatte. Ein guter Statiker suchte auch nach Rissen im Gebäude. Und eine Kluft nach außen zu zeigen, das war eben nicht gerade Tonis Art. Also musste Ludwig hier bei seinem Sohn Anton forschen.
„Sie sind die rechte Hand Ihres Vaters?“, sagte er halb als Frage und halb als Feststellung. Und er verwendete das formalere Sie, schließlich war dieser junge Mann hier schon 23 Jahre alt und ein informelles Du hätte die Art vereinnahmender Vertraulichkeit suggeriert, die sich Ludwig nicht gern nachreden lassen wollte. Er arbeitete als unabhängiger Ermittler und unbedarftes Zwischenmenscheln stellte dabei nur einen Stolperstein dar. Also lieber auf Distanz bleiben. Ludwig war fest auf ein „Ja, das kann man so sagen“ als Antwort gefasst.
Aber Anton konnte überraschenderweise auch anders: „Ich gebe mir alle Mühe.“
„Und Sie machen immer alles, was ihr Vater vorgibt?“, marschierte Ludwig entschlossen weiter auf dem Weg der Informationsbeschaffung. Im gleichen Moment bereute er aber seine Frage, denn die taugte mehr als Vorwurf denn dem Zwecke des Erkenntnisgewinns.
Doch Anton brachte das nicht aus dem Gleichgewicht: „Er sagt, wo’s langgeht.“ Er warf damit wieder so einen Satzbrocken hin, der keine Neuigkeiten hervorbrachte.
Da Ludwig jetzt schon einmal auf der Provokationsschiene fuhr und sich unbeliebt gemacht hatte, konnte er auch da bleiben: „Und wenn Sie mal woandershin wollen als er?“
Anton lächelte nur milde: „Sie wissen doch: Ein Kohlbayr kennt Räson.“
Und jedes Familienmitglied musste offensichtlich bis zu seinem 18. Geburtstag alle Kohlbayr-Sprüche auswendig lernen, schoss es Ludwig durch den Kopf. Aber dieser junge Mann gab entweder einen so guten Diener ab, dass zwischen ihn und seinen Vater kein Blatt passte oder er war derart aalglatt, dass das schon Respekt abverlangte.
Ludwig wusste nicht so richtig, was er mit ihm anfangen sollte. Die Kohlbayrs beendeten ja eine Auseinandersetzung oft auch dadurch, dass sie polterten und damit klarmachten, dass eine Entgegnung zwecklos war. Diesem Mittel hatte sich der junge Anton hier zum Glück noch nicht bedient. Er verkörperte damit doch einen Fortschritt in der Familienchronik, dachte sich Ludwig. Und er ließ den Jungen ziehen. Ob sich Anton Kohlbayr Nibelungen-treu gegenüber seinem Vater gab oder einfach eine elegante Klinge schwang, das konnte er später noch herausfinden. In jedem Falle musste Toni stolz auf seinen Sohn sein.
Wenn Ludwig hingegen an das Verhältnis zu seiner Tochter Callista dachte, dann kam das Wort „Stolz“ in dieser Erinnerung nicht vor. Nicht für ihn und nicht für sie. Das war zwar nicht immer so gewesen, aber es ergab sich im Laufe der Zeit.
Carrie und Ludwig bekamen Callista einfach so, ohne großen Plan. Das lag mittlerweile über 19 Jahre zurück. Aber da sie damals nun einmal auf dem Wege waren, Eltern zu werden, ließen sie es zu und Callista betrat diese Welt und nahm sie in Besitz. Ihr Name verhieß ihr, „die Schönste“ zu sein, und ein liebliches Kind war sie ohne Zweifel.
Doch die Zeit verstrich schnell, in der allein der Liebreiz des Kindes eine Familie wie eine dicke Eisschicht über dem tiefen Wasser der Meinungsverschiedenheiten trug. Callista war gescheit, lernte sprechen und entwickelte, ihrer Mutter gleich, einen ausgeprägten Sinn für Widerworte. Den setzte sie konsequent ein. Reibereien mit den Eltern blieben unausweichlich.
Jahre später, am Ende der Entwicklung, stellte Ludwig für sie eine Art Nichts auf zwei Beinen dar.
Dabei fing alles gut an und sie hatte als Kind zu ihm aufgeschaut, so wie all die Kleinen zu ihren scheinbar allwissenden Vätern aufschauen. Doch die Bereitschaft seiner Tochter, ihn zu achten, zerstörte Ludwig ungewollt, aber dafür nachhaltig. Er behandelte sie stets als Kind. Hatte sie eine Frage, tat er überlegen und erklärte es ihr, so gut er es eben verstand. Doch mit der Zeit wurden ihre Fragen kniffliger und Ludwigs bequemes Polster der Überlegenheit schmolz immer weiter ab. Wenn er dann etwas nicht wusste oder die Diskussion ihm einfach zu lästig vorkam – ja, diese Göre konnte einem schier Löcher in den Bauch fragen – da raunzte er ungnädig: „Das verstehst du noch nicht!“ Dieser Satz brannte sich in Callistas Kopf ein.
Lag das echt an ihr? Eigentlich nicht, denn sie wollte doch gerne alles wissen und verstehen! Warum behandelte er sie also so? So kindisch, so lieblos.
Überdies war Callista der geborene Weltverbesserer. Schon früh entwickelte sie grüne Ansichten, von der Bewahrung der Natur. Zwar interessierte sich jedes Kind für Tiere und für den Naturschutz, aber Callista meinte es wirklich ernst. Als Teenager vermeldete sie beim Abendessen, dass die Industrie und ein paar Gauner sowie ihre Unterstützer aus der Politik die Bürger am Gängelband durch die Arena führten. Vielleicht hatte sie das aufgeschnappt. Vielleicht war sie auch selber darauf gekommen. Beispiel gefällig? Die Fischfangquoten. Das vermittele doch alles nur einen schönen Schein, sagte sie. Dabei sollte man lieber gar keine unschuldigen Fische mehr aus dem Wasser ziehen. Ludwig erdreistete sich, sie zu fragen, was sie denn sonst bitteschön zu essen gedachte.
„Algen!“, fauchte sie trotzig.
Ludwig nervte das dann regelmäßig, denn alternative Ansichten fand er teuer bis störend. Hatten diese grünen Revoluzzer überhaupt einen Plan, wie man all ihre schöne Ökologie bezahlen sollte? Callista war nicht um eine Antwort verlegen: Nachhaltigkeit ist am billigsten und in der Zukunft wird das die Menschheit schon einsehen.
Dabei war sich Ludwig sehr sicher darin, dass er die Erfüllung dieser Prophezeiung nicht mehr miterlebte und er bezweifelte, dass es selbst Callista schaffte.
Ludwig meinte es ja nur gut und versuchte, seine Tochter mit Hilfe seiner langweiligen Normalität zu bremsen. Auch wollte er ihren Idealismus zügeln, denn er glaubte an sein eigenes gutes Werk und an den Schutz vor Naivität. So gab er ihr die folgende Weisheit mit: „Glaubst du denn, alle Leute sind einfach so, wie sie sind, gut und hilfsbereit und tun alles für dich? Nein, das tun sie nicht. Sie denken auch an sich, an ihren Vorteil und du musst ihnen einen Köder hinwerfen, um sie aus der Reserve zu locken.“ Er wollte ihr damit die Mechanismen der Wirtschaft andeuten, die Verquickung mit der Politik, den Vorgang des Nehmens und Gebens, von Arbeitsplätzen und Wählerstimmen. Und bei all dem kamen eben auch Konstruktionen wie zum Beispiel Fischfangquoten heraus. Damit musste man sich abfinden. Doch Callista war niemand, der sich abfand.
Nein, die beiden fanden einfach keinen Draht zueinander. Sie waren wie zwei Pole eines Magneten. Sie gehörten zwar zur gleichen Sache, aber sie stießen sich gegenseitig ab. Er war mehr der Beschützer des Status quo. Sie war hingegen der unruhige, forschende, verändernde Geist.
Zuletzt interessierte sie sich für Journalistik, was ins Bild passte. Aber sie konnte inzwischen alles und nichts sein, sie hatte doch ein sprunghaftes Wesen.
Callista hatte ihren Vater endgültig aus ihrem Herzen ausziehen lassen, als sie eines Tages mit ansehen musste, wie er im Keller des Hauses, in dem sie wohnten, in ihren Augen unschuldige Käfer tottrat. Die hatten nämlich in seinem Weltbild in einem Untergeschoss nichts zu suchen. Callistas Welt sah anders aus, sie wollte die Käfer in einem Marmeladenglas zusammensuchen und hinaustragen. Sie glaubte daran, dass man sich mit der Natur arrangieren konnte und dass man sie nicht unterpflügen musste.
„Humbug!“, stieß Ludwig gleich Ebeneezer Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte hervor, denn diese Art Umweltschutz hielt er für übertrieben und sie dauerte ihm einfach zu lange. Er wollte auf seine Art für Nachhaltigkeit sorgen, und zwar für dauerhafte Freiheit des Kellers von Käfern. Und dabei ließ er sich nicht aufhalten, nicht einmal von einem heulenden Kind.
Ludwig kratzte sich heute noch am Kopf, wenn er daran zurückdachte. Oh, das war keine Sternstunde gewesen. Grün hatte er sich seitdem nicht verfärbt, aber den fundamentalen Streit von damals wegen ein paar kleiner Käfern bereute er. Da schaute sie wieder um die Ecke, die kalifornische Tristesse.
Da sprach ihn eine sanfte Stimme an. Sie zog ihn aus dem Sumpf der Erinnerung und brachte ihn in die bayerische Gegenwart zurück: „Hallo Ludwig“. Neben ihm stand Barbara.
Sie wollte wissen, wie er zurechtkam.
Er war sich nicht schlüssig, ob sie sich in diesem Augenblick um ihn als Menschen oder um ihn als Ermittler sorgte. Sein Herz hoffte auf Ersteres, sein Verstand wettete auf Letzteres. „Ach, ich komm’ schon klar“, antwortete er, was ihm als Allgemeinplatz für den Einstieg passend erschien. „Ich habe doch nette Gesellschaft“, setzte er hinzu, um eine zarte Brücke zu bauen. Das geriet eine Spur zu schmalzig.
Tatsächlich huschte der Anflug eines Lächelns über Barbaras Gesicht. Es währte nur einen Moment.
„Und die Pferde?“, wandte sie das Gespräch dem geschäftlichen Aspekt ihrer Beziehung zu.
„Ich komme voran“, erklärte Ludwig und unterdrückte seine Enttäuschung über die zu kurze persönliche Sequenz in ihrem Gespräch. „Ich habe mich mit einigen Leuten außerhalb der Ranch unterhalten und hier trifft man ja auch so allerlei ...“, blieb er vage und der Gedanke schoss ihm durch den Kopf, dass Barbara Ludwigs Gespräch mit Anton über die Projektentwickler bemerkt hatte und jetzt sicherstellen wollte, dass er auch die passende Take-Home-Message mitnahm, dass er quasi „das Richtige“ dachte.
„Der Hof ist alles für uns“, sagte Barbara und Ludwig fühlte sich in seiner Vermutung bestätigt. „Wir werden ihn nicht verkaufen, an Projektentwickler oder an sonst wen“, stellte sie klar. Sie sprach, als säße sie auf einer Pressekonferenz – mit geschliffenen Worten, vollkommene Überzeugung ausstrahlend, keinerlei Zweifel zulassend. „Und an Gerüchten über einen Verkauf haben wir kein Interesse, das verunsichert nur unsere Kunden.“
Ludwig verstand, dass sie ihm eine Rolle zuschanzte. Umhören durfte er sich, schließlich sollte er einen Diebstahl aufklären. Informationen nach außen zu tragen, das stand jedoch nicht in seiner Stellenbeschreibung. Interna sollten bitteschön intern bleiben. Er nickte.
Sie zog die Augenbrauen hoch – mit einem Nicken allein gab sie sich scheinbar nicht zufrieden.
„Ich verstehe“, sagte Ludwig wie jemand, der soeben zum Anpfiff zum Chef gerufen wurde, und fügte noch vertrauensbildend und leicht lakaienhaft „geht klar“ dazu.
Jetzt gab sich Barbara zufrieden.
Damit hatte diese Unterhaltung ihren Hauptzweck erfüllt. Damit es nicht ganz so nach Arbeitgeber-Untergebenen-Gespräch aussah, plauderte sie noch etwas vom Führen der Ranch und von den modernen Zeiten. Die Globalisierung habe schon lange an die Tür geklopft und die brauchte ein neues Denken und nicht die Rezepte von gestern.
„Toni und ich“, sie machte eine Pause, „haben das aber selber im Griff.“
Ludwig stimmte ehrerbietig zu: „Kann man ja sehen.“
Barbara nickte gnädig. „Und wir können das auch ohne Projektentwickler oder Berater oder Investoren stemmen, die einem ständig auf der Schulter sitzen und einem erzählen, was man aus der Ranch so alles machen kann.“
„Verstehe ich“, sagte Ludwig, denn es leuchtete ihm ein, dass man sein Lebenswerk nicht ohne Not einem dahergelaufenen Spekulanten in die Hand gab.
„Wir haben selber auch Ideen und können das in die Hand nehmen“, sagte Barbara. Langsam kam das Ludwig etwas dick aufgetragen vor. Sie hatte ihn ja schon auf ihrer Seite. Warum so viele Worte deswegen? Keine Ahnung. Oder doch? Eventuell wollten sie sich eine Hintertür zu den Projektentwicklern offenhalten, aber eben so, dass niemand etwas davon mitbekam? Das war denkbar.
„Man muss flexibel sein, wenn man einen Hof führt“, schloss Barbara ab und es klang nach Eigenlob.
„Klar doch“, sagte Ludwig, ohne wirklich zu wissen, worauf sie hinauswollte. Aber das war auch nicht so wichtig. Er beschäftigte sich nicht weiter damit. Barbara konnte nicht der Pferdedieb sein. Das zählte im Moment. Und dass er sie ab und zu sah.