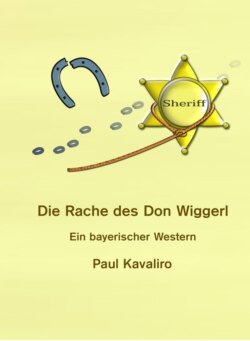Читать книгу Die Rache des Don Wiggerl - Paul Kavaliro - Страница 9
ОглавлениеDer Scout
Die Tage vergingen, aber in Ludwigs Sache ging nichts recht voran. Er war mit der Gesamtsituation unzufrieden. Er hatte sich mit Leuten getroffen und Informationen abgeschöpft. Er zeigte sich täglich auf der Ranch und hatte so gut wie jeden gesehen, der dort ein und aus ging. Auf der Habenseite konnte er immerhin für sich verbuchen, dass es seit seiner Einstellung keine Sicherheitsvorfälle gegeben hatte – von ein paar Pferde-Temperamentausbrüchen abgesehen, die man aber schnell wieder beruhigte. Aber das zählte nicht, denn sein Augenmerk lag mehr auf Menschen, die eine Gefahr für den Betrieb darstellen konnten und weniger auf der tierischen Seite.
Auf der Plus-Seite stand ebenfalls, dass keine weiteren Pferde abhandengekommen waren. Im Soll lag er deswegen trotzdem nicht, denn von den gestohlenen Tieren fehlte nach wie vor jede Spur. Als einzigen Sonnenschein benetzten ihn hier und da die Begegnungen mit Barbara. Nur wenn er nicht bald lieferte, dann schien die Sonne demnächst nicht mehr für ihn und Toni heuerte einen anderen Hilfssheriff an.
Ludwig verharrte in Unschlüssigkeit, wo er als Nächstes nach Informationen graben und wen er noch oder nochmals ausquetschen konnte. Wer schied als Outsider aus und wusste nichts und wer gehörte in den Kreis der Insider, verhüllte sich aber noch? Und hatte es Ludwig überhaupt schon geschafft, zu einem auskunftsfreudigen Auskenner vorzudringen? Er konnte es nicht sagen.
Er fühlte sich wie ein Autor mit Schreibblockade, der vor einem weißen Blatt Papier saß und nichts zustande brachte. Er brauchte einen Tipp. Doch wer konnte helfen?
Bentheneder? Wohl kaum.
Anton? Der Junge war so – wie sollte man sagen – verschlossen.
Toni? Dann konnte Ludwig auch gleich einen Zettel bei ihm abgeben, dass er keine Ahnung hatte. Ähnliches galt für Barbara.
Elvira Karl? Die traf er beinahe täglich und die hätte es ihm schon unter die Nase gerieben, wenn es da irgendwo irgendetwas gab, dem er sich annehmen sollte.
Benny und Peter? Da konnte man nochmals einen Versuch starten. Benny hatte doch über die Jahre immer mal wieder als Handwerker auf der Ranch gearbeitet, um Sachen zu bauen oder auszubessern.
Ludwig wollte sich wieder gern im Wirtshaus mit Benny treffen, aber das klappte nicht. Benny gab sich am Telefon kurz angebunden. Lust hätte er schon, aber Zeit hätte er keine. Ludwig dachte sich, dass die Wiedersehensfeier letztens wahrscheinlich nicht nur den Männern auf den Magen geschlagen war, sondern auch Bennys Frau. Vermutlich fand sie es nicht lustig, dass Benny hinterher ein eher „langsames“ Wochenende hatte mit einer schneckenhaften Dynamik bei Haushalts- und Kinderbetreuung und mit wenig Aufmerksamkeit gegenüber seiner besseren Hälfte.
Na gut, wenn Benny keine Zeit hatte, dann musste ihn Ludwig eben gleich am Telefon fragen. Ob Benny bei seinen Handwerkerprojekten auf der Ranch über die Jahre hinweg etwas aufgefallen sei?
Nein, eigentlich nicht. Toni gab den Ton an und gab auch immer die Anweisungen direkt an die Handwerker. Lediglich sein Cowboyhut wechselte von Zeit zu Zeit; er tauschte ihn gelegentlich gegen einen frischen aus, um neuen Glanz zu verbreiten. Abgetragene Hüte waren nicht sein Ding.
Andere Leute auf der Ranch, die da nicht hingehörten?
Tja, Spekulanten oder Investoren klopften wohl über die Jahre von Zeit zu Zeit an die Tür. Ein erkennbares Projekt entstand hingegen nicht daraus.
Wer schaute sonst noch vorbei?
Ja, der Schmied, für Hufeisen. Das gehörte zum Standardprogramm. Dann noch der Tierarzt, aber den brauchte man ja ebenfalls. Den hielt Ludwig schon für interessanter. Hatte der mal gewechselt? Nö, es blieb immer der gleiche. Vielleicht sollte er sich mal mit dem unterhalten?
Damit kam das Telefonat auch schon zum Ende. Na gut, mit dem Tierarzt zu reden, das konnte ja nicht schaden. Dümmer wurde man davon nicht. Aber es hatte für Ludwig keine allerhöchste Priorität, denn ein Tierarzt gehörte zum Pferdehof wie die Werkstatt zum Auto. Das stellte also nichts Besonderes dar. Er ging das bei Gelegenheit an.
Dafür beschäftigte ihn eine andere Sache: Der Winter brach herein – ungewöhnlich zeitig – und mit ihm die Kälte. Rundgänge auf der Ranch verliefen im vergleichsweise lauen Herbst weitaus angenehmer als im beißenden Frost. Die Objektsicherung gestaltete sich nicht zuletzt wegen des kürzeren Tageslichts mühseliger und gleichzeitig nach Spuren suchen musste Ludwig ja ebenfalls. Das konnte für den Rest des Jahres nicht mehr so weitergehen.
Irgendwann kam der Advent auf leisen Sohlen geschlichen, später gefolgt von der Zeit des Jahreswechsels, gepaart mit der Gelegenheit für gute Vorsätze: Dann standen beim Discounter, der die Sorgen und Bedürfnisse seiner Kunden kannte, wie in jedem Jahr zu dieser Zeit all die Hanteln und anderen Sportgeräte herum, um die frommen Pläne auch in die Tat umzusetzen.
Ludwigs gute Vorsätze existierten aber schon jetzt, im alten Jahr, und waren mehr auf Fortschritt bei seinen Ermittlungen als auf sportliche Fitness getrimmt. Und er musste sich eingestehen, dass er alleine nicht gut vorankam. Was es auf der Ranch zu beobachten gab, hatte er beobachtet. Auch kannte ihn hier mittlerweile jeder. Wenn also jemand etwas im Schilde führte, dann zog er das tunlichst nicht zu Ludwigs Präsenzzeiten durch. Außerdem schien es geboten, die Bewachung auf die Nachtstunden auszudehnen, zumindest ab und zu. Das trieb mögliche Gauner in die Unsicherheit. Die mussten dann nicht nur mit der Überwachungskamera, sondern mit echten Hilfssheriffs aus Fleisch und Blut rechnen und die vermochte man nicht derart leicht auszutricksen wie einen stummen und unbeweglichen Aufnahmeapparat.
Einen Helfer zu haben lautete Ludwigs liebste Lösung. Doch wie konnte er Toni davon überzeugen? Er überlegte angestrengt und suchte nach gewinnenden Argumenten, als er mal wieder auf der Fahrt zur Ranch in seinem spärlich beheizten Jeep fröstelte. Der Big Boss musste das Geld für den Helfer lockermachen, denn Ludwig konnte sich die Mittel weder aus den Rippen schneiden, noch von seinem eigenen Lohn abzweigen.
Alles wäre ein Kinderspiel, wenn er schon mit x Untersuchungsergebnissen glänzen konnte oder aber seine Wichtigkeit auf andere Weise aufblitzen ließ. Doch dazu hatte sich noch keine Gelegenheit ergeben, etwa einen Dieb auf frischer Tat zu ertappen und mit dem Lasso dingfest zu machen – wie ein richtiger Cowboy.
Ludwigs Fahrt ging schon fast zu Ende. Er rollte gerade auf die Ranch und in Richtung Parkplatz, wo er immer den Wagen abstellte. Er kam sich schon wie ein Arbeiter vor, der jeden Tag brav zum Fließband fuhr. Folgte wieder einer dieser austauschbaren, beschaulichen Tage?
Nichts da! In der sonstigen Wohlordnung schrien Männer durcheinander und versuchten, sich zu ordnen. Einer knallte hinter Ludwig das große Tor zu, der Jeep konnte gerade noch passieren. Aus der Richtung der Ställe schallte lautes Quieken von jungen Reiterrinnen herüber, die ihrer Angst vor einer Gefahr Luft machten. Und in all das Schreien mischte sich Pferdegetrappel. Ludwig stellte eilig den Jeep ab und stieg aus. Er stand doch als der Sicherheits-Mensch hier in der Pflicht und Quieken mit Getrappel klang nicht nach Sicherheit.
Und da sah er die Bescherung schon: Über die Hofstraße jagte ein durchgegangenes Pferd, mit Sattel und Zaumzeug. Sein Reiter rannte hinter ihm her und bedeutete ihm stehenzubleiben, doch ohne Erfolg. Der eine oder andere Ranch-Bedienstete stellte sich dem Vierbeiner in den Weg, aber der ließ sich nicht aufhalten. Die Leute spritzten auseinander. Einige schrien dabei.
Gut, dass jemand das große Tor geschlossen hatte, sonst hätte sich dieses wilde Ross noch selbst auf die Liste der abhandengekommenen Pferde gesetzt. So wie das Tier drauf war, hätte es erst an der tschechischen Grenze haltgemacht.
Ludwig schaltete blitzschnell. Jeep-Auto-Tür wieder auf, sein Lassoseil gegriffen. Oder besser gesagt: Spiel-Seil? Egal. Hin in Richtung Pferd. Jetzt nur nicht die Ruhe verlieren. Das Tier hatte abgebremst. Es tänzelte am Tor entlang, wie eine Fliege an der Fensterscheibe auf der Suche nach einem Weg in die Freiheit.
Dort hatten sich inzwischen schon zu viele Leute angesammelt, der Reiter vornedran, um das Tier aufzuhalten. Also konnte es nicht quer über die Ranch wegrennen. Doch wenn sich ihm jemand näherte, stob es wild schnaubend ein paar Meter weiter. Und dieses Biest wirkte stattlich, hatte Masse und Muskeln, wie alle Pferde hier auf der Ranch. So einfach bekam man es nicht zu fassen.
Ludwig ging festen Schrittes näher. Ehrfürchtig teilte sich die Menschenansammlung vor ihm. Manche griffen sich an den Kopf: Was wollte der mit dem Lasso? Hatte er zu viele Western gesehen? Ludwig war das schnuppe, denn er hatte die Grenze zur Tat bereits überschritten: Er hatte das Seil in der Hand, sein Vorsatz kam überdeutlich herüber und er konnte es jetzt nicht mehr weglegen.
Schon stand er in der Nähe des Pferdes. Plötzliche Bewegungen vermeidend, fing er langsam an, das Lasso zu schwingen. Er wusste, dass er nur einen Versuch hatte. Er fühlte sich wie im Zirkus; es fehlte nur der Trommelwirbel. Das Publikum schaute gebannt zu. Er schwang, ging näher heran, schwang das Seil weiter, noch ein Stück näher. Jetzt blieben noch fünf Meter. Jetzt musste es passen. Er ließ das Seilende los. Die Schlinge fegte durch die Luft. Wen traf sie? Das Pferd? Einen Zaunpfahl? Einen Passanten? Oder ging er Schuss ganz daneben? Ludwig fixierte das Tier mit den Augen, als wollte er es ins Ziel seines Wurfs zwingen.
Das Lasso neigte sich aus der Luft nach unten, immer weiter. Fast hatte es das Pferd erreicht. Nur noch einen winzigen Moment. „Bleib bloß stehen, du Gaul!“, hoffte Ludwig inbrünstig. Jetzt war das Lasso an seinem Ziel angekommen, es legte sich wie eine Kette um den Pferdehals. Er hatte tatsächlich getroffen!
Wohlige Erleichterung durchströmte seinen Körper. Das bis soeben noch ungestüme Ungeheuer war genauso überrascht wie Ludwig, dass das Kunststück gelang. Es machte keinen Versuch zu türmen. Nicht zu fest, aber bestimmt zog er das Seil an.
„Und jetzt?“, schoss es ihm durch den Kopf. Ein geglückter Lassowurf war das eine, ein Pferd zu bändigen etwas ganz anderes. Zum Glück schickte ihm der Himmel einen Retter. Wie aus dem Nichts stand da Anton neben ihm. Er ging auf das Pferd zu, fasste nach dem Lassoseil, das Ludwig immer noch fest in den Händen hielt und hangelte sich bis zum Zaumzeug des Tieres durch. Dort hatte er das Pferd im Griff und er beruhigte es, so gut er es vermochte. Kurz blickte er sich nach dem Lassowerfer um, stieß ein kaum wahrnehmbares „Danke“ hervor und führte das Pferd zügig weg von der Menge. Dann konnte nichts weiter passieren. Ludwig atmete durch.
Der Reiter trottete hinter Pferd und Anton hinterher. Er bekam heute gewiss keine Gelegenheit mehr zum Galopp, jedenfalls nicht mit diesem Pferd. Der Menschenauflauf zerstreute sich schnell, als wäre nichts gewesen. Die Leute hier machten halt nicht viel Aufhebens um solche Sachen.
Ludwigs Puls jagte immer noch. Aber er hatte es geschafft!
Jetzt nach dem siegreichen Duell mit dem Streitross befand er sich in der richtigen Stimmung, um zu Toni ins Büro zu treten und den Wunsch nach dem Helfer vorzutragen. Er wollte die Gunst der Stunde nutzen.
Gewiss war der Chef im Bilde, denn nicht im Bilde zu sein, das war nicht Tonis Art.
„Bravo Herr Donner“, begrüßte Elvira Karl den Helden am Empfang. Ludwig nickte bescheiden. Na das hatte sich ja schnell herumgesprochen. Er fragte nach dem Chef.
„Zu Herrn Kohlbayr? Ja der ist da“, bestätigte die Dame. Sie ließ Ludwig umgehend zur Audienz vor.
Toni trat gerade vom Fenster zurück. Er setzte den Cowboyhut ab und warf ihn auf den Schreibtisch. Dann ließ er sich in seinen Bürolehnstuhl fallen und viel hätte nicht gefehlt und er hätte die Füße auf den Tisch gelegt. Das tat dem aber im Winter bei all dem Matsch nicht gut. Also ließ es Toni sein.
Er lobte Ludwig für den Lassowurf. Er war also im Bilde.
Und der Gelobte preschte seinerseits gleich mit der aufgestauten Frage nach einem Helfer vor.
Toni argwöhnte: „Noch ein Bewacher?“, und bohrte mit seinen Augen Löcher in die Decke. Scheinbar ging er das verfügbare Budget durch.
Ludwigs Blick blieb an Tonis Cowboyhut hängen. „Sieh es doch mal so“, sagte er, einer plötzlichen Eingebung folgend, „wir sind Cowboys.“ Dabei zeigte er auf sein Basecap wie auf eine logische Fortsetzung des Cowboyhuts in die heutige Zeit. „Und wir brauchen noch einen Spurensucher, einen Scout.“
Im Western gab es diese Figuren. Sie rekrutierten sich aus Indianern oder anderweitigen Außenseitern. Sie stammten oft aus einem anderen Kulturkreis und wegen ihrer Andersartigkeit wollte sonst keiner was mit ihnen zu tun haben. Aber in den Momenten, in denen man sie brauchte, betraten sie als unverhoffter Verbündeter die Szene und lieferten oft die entscheidenden Hinweise.
Toni zog fragend die Augenbrauen nach oben.
Und Ludwig packte seine Argumente aus, die er sich morgens auf der Autofahrt zurechtgelegt hatte. „Na irgendwohin müssen die Pferde doch gegangen sein! Ich muss mögliche Wege abchecken und davon gibt es viele. Das schafft man zu zweit besser.“
Toni schwieg. Er schaute abwechselnd zu Ludwig und durchbohrte ihn mit seinen Augen und dann wieder zur Decke, in die imaginäre Welt der Zahlen. Er war nicht leicht zu überzeugen.
Ludwig hatte Zweifel, ob seine Argumente reichten. Also spielte er seine letzte Karte aus: „Schließlich kann ich nicht stets alleine das Lasso schwingen.“
Toni berührte diese forcierte Erinnerung unangenehm, dass der Wiggerl hier vor einer Viertelstunde eine brenzlige Situation bereinigt hatte. Er stierte nochmals kurz an die Decke, als ob dadurch von dieser zusätzliches Geld herabregnete.
Und zum Glück besann der sich dann darauf, dass sie im Kapitalismus lebten und dass ein Helfer Ertrag abwerfen konnte, indem er den Objektschutz und die Suche nach Spuren und Anhaltspunkten beschleunigte. Und außerdem war gerade Winter und draußen nicht so viel zu tun. Da brauchte man kaum Saisonarbeiter und dafür konnte man Ludwigs „Scout“ einstellen.
„Na gut, dann mach dich auf die Suche!“, befahl Toni gnädig. „Aber ich will den Burschen sehen.“ Damit nahm er seinen Hut und Ludwig seinen und sie gingen auseinander.
Ludwig freute sich. Nein, das war in der Tat kein gewöhnlicher, beschaulicher Tag. Binnen eines Vormittags hatte er zwei bedeutende Siege eingefahren. Er machte sich am besten gleich auf die Suche nach einer Verstärkung.
Doch woher diese Leute nehmen? Die wuchsen nicht auf Bäumen, vor allem nicht in der bayerischen, schneebedeckten Prärie. Wenn Ludwig durch die Straßen fuhr, dann waren da keine überzähligen, streunenden Scouts unterwegs.
Er konnte ja sein Glück in der Zeitung suchen. Oder er fragte Elvira Karl, ob sie nicht jemanden wüsste. Die schaute ihn nur entgeistert an und Ludwig bereute seine Frage im gleichen Moment, in dem er sie gestellt hatte. Die Dame musste ja denken, er habe gar keinen Plan. Da schaffte er seine Arbeit schon nicht alleine und dann wusste er noch nicht einmal, woher er einen Hilfs-Hilfssheriff bekam?
Doch dann zauberte sie doch noch einen Vorschlag aus dem Handgelenk: „Versuchen Sie’s doch mal bei der Agentur für Arbeit!“
Tja, die hieß bis vor kurzem noch Arbeitsamt und wenn in Deutschland etwas helfen konnte, dann ein Amt. Unter der Rubrik „Scout“ wurde man dort gewiss nicht fündig, aber womöglich war jemand für Überwachungsaufgaben oder ein Tagelöhner im Angebot, der zufällig ein Universalgenie darstellte? Ein Versuch konnte nicht schaden. Ob die angesichts des allgegenwärtigen Datenschutzes überhaupt Informationen telefonisch herausgaben? Sie gaben, zum Glück.
„Sie suchen also jemanden für den Wachdienst?“, vergewisserte sich die freundliche weibliche Stimme der Agentur für Arbeit am Telefon. Den dazugehörigen Namen hatte sich Ludwig nicht gemerkt, aber er freute sich trotzdem über den Klang. Er hätte ja auch an einen verdrießlichen Mittfünfziger geraten können.
Tastaturklappern im Hintergrund. „Hm“. Wieder Tastaturklappern. Ludwig wartete ab. „Sind Sie noch dran?“, fragte die Stimme, die sich jetzt eher besorgt als freundlich anhörte. „Wissen Sie, es ist schwierig, Leute zu vermitteln.“
„Das kann ich mir vorstellen“, meinte Ludwig, als er fühlte, dass er auch mal etwas sagen musste. Sicher gaben die Arbeitsagenten ihr Bestes. Wenn man das mit dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten verglich – da war jeder sein eigener bester Freund, wenn es um neue Arbeit ging. Und so manche Karriere kam, auf sich allein gestellt, ins Stocken. Da tat es doch gut, wenn man jemanden an der Seite hatte, so wie hier die Agentur.
Die Dame am anderen Ende der Strippe musste inzwischen mindestens 119 Profile durchgegangen sein, denn nach etlichen Tastatur- und Mausklick-Geräuschen folgte jetzt endlich Ruhe.
„Ich hätte hier jemanden, der eine Weile als Türsteher in einem Nachtclub gearbeitet hat.“
„Ja?“, schöpfte Ludwig kurz Hoffnung.
„Er ist zwar vorbestraft, aber Sie können sich das ja trotzdem überlegen.“
Und Ludwig überlegte: Vor seinem geistigen Auge erschien ein Bulle von einem Mann mit rotem Bart und kahlgeschorenem Schädel. Und mit ausschweifenden Tätowierungen. Wenn er den dem Toni vorzeigte, dann gab es beim Resultat nicht viele Möglichkeiten. Ex-Knackis zu integrieren, die wie welche aussahen, darin bestand sicher nicht Tonis erste Option.
Ludwig war wieder an einem dieser Momente angelangt, in denen er sich ärgerte, dass er immer nach Tonis Pfeife tanzen musste. Früher wie heute. So für sich hätte er dem Arbeitssuchenden eine Chance gegeben. Aber egal, er hatte einen Job zu erledigen.
Die freundliche Stimme am Telefon deutete Ludwigs Schweigen als Absage. „Gibt es noch andere Kriterien?“, erkundigte sie sich.
Klar, mehr Stichwörter ergaben auch mehr Suchtreffer. Das funktionierte wie bei einer Suchmaschine: Je mehr Wörter man in den Computer eingab, umso mehr Hinweise spuckte er aus. Aber meistens waren das keine guten, sondern eher Treffer, wo Suchwort eins im Konflikt mit Suchwort sieben und neun stand oder aber Suchwort zwei, drei und vier gar nicht vorkamen. Aber es fühlte sich falsch an, der freundlichen Stimme am Telefon nicht noch neues Futter für ihre Schnitzeljagd zu geben.
„Es ist von Vorteil, wenn derjenige aus der Nähe kommt“, gab Ludwig an. In der Tat war das ein dickes Plus. Wer weiß, der Kandidat wusste vielleicht nicht mal, wie man „Führerschein“ buchstabierte, geschweige denn, dass er ein solches Dokument sein Eigen nannte. Dann hatte Ludwig 1-2-3 einen täglichen Jeep-Mitfahrdienst an der Backe. Dagegen klang „Eigenanreise per Fahrrad“ vernünftig.
Die freundliche Stimme meldete sich wieder und meinte, dass insbesondere auch die arbeitsberechtigten Ausländer aus der Gegend nette und arbeitswillige Leute seien.
„Ach“, entfuhr es Ludwig. Das war die Kurzform von „auch das noch.“ Asiaten oder Afrikaner in Genglkofen, auf der Ranch? Das passte nicht ins Bild.
„Bitte?“, fragte die freundliche Stimme, die jetzt wieder besorgt klang. Schließlich hatte die Dame inzwischen schon 20 Minuten geklickt und getippt und sah ihre Felle davonschwimmen.
„Ach … ja“, stammelte Ludwig. „Ja, es wäre gut, wenn er sich mit Pferden auskennt, wollte ich sagen.“ Das erschien ihm eine passende Ausflucht zur Gesichtswahrung auf beiden Seiten des Telefondrahts, denn die „Gastarbeiter“ hatten in dieser Beziehung gewiss nichts auf der Pfanne. Pferdeliebhaber waren verwurzelt, die brachen nicht einfach so in ein fremdes Land auf. So lautete sein Kalkül.
Wieder Tastaturanschläge und Mausklicks am anderen Ende. Ludwig fühlte sich genötigt, noch etwas zu sagen, damit seine letzte Einschränkung nicht als disqualifizierend rüberkam, obwohl er sie mit dieser Absicht ausgesprochen hatte. „Oder sie ...“, sagte er schnell hinterher.
„Wie bitte?“, erkundigte sich die Stimme. War sie am Ende selbst gemeint? Im gesprochenen Deutsch konnte man ein großes „Sie“ oder ein kleines „sie“ nicht auseinanderhalten.
Ludwig stammelte wieder: „Ich meine: nicht nur 'er', sondern auch 'sie'. Äh, ich meine“, er kam ins Stocken. „Vielleicht gibt es ja nicht nur männliche Bewerber, sondern auch weibliche.“ Eine Asiatin konnte er Toni verkaufen. Einen Asiaten – das fiel schon schwieriger aus. Frauen sah Toni als harmloser an. Er war so ein Typ.
„Nein“, sagte die Stimme.
„Wie bitte?“, fragte Ludwig jetzt.
„Nein, es gibt keine weiblichen Bewerber.“
„Schade“, sagte Ludwig und machte sich schon bereit, den Hörer aufzulegen. Immerhin hatte er es versucht.
„Nein“, sagte die Stimme jetzt wieder.
Glaubte sie ihm nicht, dass er es schade fand? „Nein, was?“, fragte Ludwig jetzt, leicht angenervt.
Die Stimme am anderen Ende der Leitung behielt die Oberhand in dieser Unterhaltung. Sie durchlebte täglich so viele Gespräche und dort ging es niemals zu wie auf dem Ponyhof. Dagegen war das hier eine leichte Übung.
„Es gibt da jemanden.“
„Ach“, sagte Ludwig wieder und verbesserte sich schnell auf „ach so!“, denn das klang freundlicher.
„Geht doch“, dachte sich jetzt auch die Dame, die zu der freundlichen Stimme am anderen Ende der Leitung gehörte und präsentierte den Namen: „Semi Baccar. Er kommt aus Tunesien und wohnt bei Ihnen im Ort. Haben Sie etwas zu schreiben zur Hand?“
Klar, hatte Ludwig das. Und so bekam er die Adresse durchgesagt. „Herzlichen Dank!“, salutierte er brav in einer Mischung aus Freude über den Erfolg, denn er hatte einen Kandidaten gefunden, und Besorgnis, denn er hatte einen Kandidaten gefunden, der ihm womöglich mehr Aufregung als Hilfe bescherte.
„Gern geschehen!“, sagte die Stimme am anderen Ende und legte auf.
Das alte Sprichwort „unverhofft kommt oft“ hatte sich bewahrheitet, mal wieder. Anstelle eines Wachmannes hatte Ludwig jetzt einen ausländischen Pferdefreund in der Arbeitsagentur-Lotterie gewonnen. Am besten sollte man dem gleich zeitnah auf den Zahn zu fühlen, ehe es sich Toni mit der Stelle nochmal anders überlegte.
Also schwang sich Ludwig ins Auto und fuhr zu der Adresse, die er auf seinen Zettel gekritzelt hatte. Er landete vor einem Mehrparteienhaus in der Ortsmitte. „Zum Glück kein Asylbewerberheim“, dachte sich Ludwig, denn die fand er gruselig – so viel Fremdländisches auf einen Haufen und dann auch noch verpackt in einen deutschen Container.
Er klingelte an der Tür. Keine Reaktion. Er läutete nochmals. Da bewegte sich eine Gardine im Erdgeschoss. Wollte sich dieser Herr Baccar verstecken oder hatte er Angst? Dachte er gar, Ludwig wurde von einer Behörde geschickt?
Wieder bewegte sich der Fensterschmuck. Ludwig klingelte ein weiteres Mal, um zu sehen, ob die Gardine dann noch öfter zappelte. Stattdessen wurde sie zur Seite gezogen und das Fenster mühsam und unter Ächzen geöffnet. Der Kopf eines alten Mütterchens erschien.
„Verzeihen Sie, ich suche Herrn Baccar.“
„Wen?“, das Mütterchen war wohl mit dem Hörgerät an der Gardine hängengeblieben und hatte es verloren.
„Herrn B-A-C-C-A-R“, sagte Ludwig laut und deutlich.
„Naa, den kenn’ I net“, gab das Mütterchen zu Protokoll.
Ludwig wurde unsicher. Ob der Afrikaner sie instruiert hatte, sich dumm zu stellen und ihn zu verleugnen, wenn ein Unbekannter auftauchte?
Ludwig ließ nicht locker: „S-E-M-I.“ Pause. „B-A-C-C-A-R.“
„Ach den Sämmy, ja mei, sagn’s das doch gleich. Und schreien’s doch bittschön net so, I bin doch net schwerhörig!“
Ludwig ließ die kleine Schimpfkanonade über sich ergehen. „Wo finde ich den denn?“, fragte er, sobald das Mütterchen zu Ende gegrantelt hatte und er wieder reden durfte.
Die Frage verhallte unverstanden. Eine unangenehme Pause entstand, angefüllt mit Nachdenken auf beiden Seiten.
„Wissen’s, wo Sie den finden können?“, fragte die Alte jetzt. Dem jungen Mann hier musste man aber auch alles aus der Nase ziehen.
Ludwig schüttelte den Kopf: „Nein, weiß ich nicht. Wo ist er denn?“
Die Unterhaltung lief jetzt echt locker. Es konnte auch nicht schaden, auf Hochdeutsch umzuschalten, dachte sich das Mütterchen. Womöglich kam der junge Mann hier an der Tür aus dem deutschen Osten und sprach noch nicht richtig Hochdeutsch?
Also gab sie sich Mühe: „Der arbeitet immer am Supermarkt. Er fegt dort den Schnee. Gehen Sie doch da mal hin.“
Ludwig bedankte sich, indem er einen Diener machte. Non-verbale Kommunikation schien ihm in diesem Augenblick effektiver. Und Missverständnisse kosteten nur Zeit. Das Mütterchen war ganz gerührt von seinem guten Benehmen und winkte ihm zu in einer Art huldvollen Geste wie Queen Elizabeth die Zweite. Das war doch nett, dass dieser junge Mann aus dem Osten so gute Manieren besaß. Hatte er das in der Schule gelernt? Hierzulande kam so etwas für ihren Geschmack zu selten vor, viel zu selten.
Ludwig rettete sich freundlich zurückwinkend in seinen Jeep. Manche ältere Herrschaften verwickelten einen bei solchen Gelegenheiten in längere und zähe Gespräche, aufgrund ihrer sonstigen Einsamkeit, die natürlich bedauerlich war und den Wunsch nach Geselligkeit legitimierte. Aber er musste seine Zeit retten und fuhr los. Wer weiß, wo sich dieser dunkelhäutige Kerl in einer Stunde aufhielt und ob er ihn dann noch fand? Sahen Tunesier überhaupt dunkelhäutig aus? Na ja, er würde es schon sehen.
Ludwig fuhr am Supermarkt vor. Hierher kam er öfter und besorgte sich die Dinge des täglichen Bedarfs für seinen kärglichen Junggesellenhaushalt. Dabei hatte er meist nur eine mentale Einkaufsliste im Kopf und schaute ansonsten nicht weiter auf Details. Heute achtete er hingegen auf schneefegende Afrikaner. Tatsächlich, da war jemand. Der schwang den Schneeschieber mit Elan, lugte unter seiner tief ins Gesicht gezogenen Kapuze kaum nach links und rechts und schaffte die weiße Pracht mit Nachdruck zur Seite.
Ludwig parkte den Jeep und blieb noch eine Weile am Steuer sitzen, um den Kandidaten zu beobachten. Die Eile, mit der dieser seiner Arbeit nachging, sprach für Beflissenheit. Wahrscheinlich wollte er zeigen, dass er etwas leisten konnte; er strebte danach, sich vor dem Arbeitgeber zu beweisen. Womöglich hatte er aber auch heute noch was vor und musste vorher den Job eilig zu Ende bringen.
Seine seltenen Blicke nach links und rechts erfolgten aus den Augenwinkeln. Er vermittelte dadurch einen verunsicherten Eindruck. Wollte er etwa niemandem sein Gesicht zeigen, sollte er nicht erkannt werden? Oder hatte er schlechte Erfahrungen gemacht mit deutschen Bürgern mit negativer Einstellung zu Ausländern, die ihren Meinungsschwall auf ihm entluden? Für das alte Mütterchen vorhin am Fenster stellte er scheinbar einen positiven Mitmenschen dar. „Sämmy“ hatte sie ihn genannt. Das klang nett und nach Vertrautheit.
Im selben Moment schaute dieser Semi doch einmal für einen Augenblick länger auf, denn ein LKW fuhr an der Straße entlang. Der Schneefeger machte sich sicherheitshalber zum Sprung bereit, beobachtend und gleichzeitig fegend. Wollte der LKW zum Supermarkt einbiegen und liefern, dann war es besser, wenn man nicht im Wege stand. Schneefegende Nordafrikaner sollten lieber nicht den Geschäftsbetrieb aufhalten. Ludwig registrierte amüsiert Ansätze von Umsicht und Beobachtungsgabe beim Kandidaten.
Und jetzt, da Ludwig dessen Gesicht für einen Augenblick sah, konnte er es auch erkennen. Tatsächlich hatte er den schlanken jungen Mann von geschätzten 25 Jahren schon früher gesehen, aber nie bewusst. Damit stellte das hier quasi keinen Erstkontakt dar, sondern es gab wenigstens eine klitzekleine Vertrautheit, was Ludwig unwillkürlich aufatmen ließ. Das vermittelte ihm den letzten fehlenden Anstoß, die persönliche Begegnung einzuleiten.
Er stieg aus dem Auto und ging auf den Mann mit der Schneeschaufel zu. Da der seine Bahnen hin und her zog, hätte es komisch ausgesehen, wenn Ludwig hinter ihm hergerannt wäre. Und unwürdig. Also postierte er sich so, dass der Afrikaner auf ihn zukam. Der hatte ihn schon aus den Augenwinkeln bemerkt. Erst kurz vor Ludwig stoppte er mitsamt seiner Schneeladung, um auszuprobieren, ob der nicht doch noch zur Seite sprang und ihn einfach arbeiten ließ.
Doch Ludwig blieb standhaft. „Herr Baccar?“, fragte er und dachte sich, was wäre, wenn der Schneeräumer ihn gar nicht verstand? Zum Glück hatte er noch sein passables US-Englisch in petto. Doch seine Bedenken lösten sich schnell in Wohlgefallen auf.
Der Tunesier erwiderte Ludwigs Frage mit einem Gruß: „Grüß Gott!“, erscholl es zurück und er riss sich dabei aus Anstandsgründen die Kapuze vom Kopf, seinen Kopf der Kälte preisgebend.
Ehe er seine Fragen loswurde, sollte er sich vorstellen, erinnerte sich Ludwig an seine guten Manieren. „Mein Name ist Ludwig Donner.“ Er sagte lieber den ganzen Namen, denn Donner allein klang nach einem Künstlernamen oder gar einer falschen Identität. Vor- und Nachname zusammen wirkten dagegen unverdächtiger.
Der beflissene Afrikaner zog gleich seine Handschuhe aus und schüttelte Ludwig betont freundlich die Hand. „Ich bin Semi!“
Ludwig war das gar nicht recht. Diese übertriebene Freundlichkeit kam ihm zwei Nummern zu vereinnahmend vor. Er erwiderte den Händedruck nur flüchtig.
„Um Gottes willen, setzen Sie ihre Kapuze wieder auf“, entfuhr es Ludwig und er hörte sich jetzt an wie seine eigene Mutter, die es früher auch immer nur gut meinte.
„Geht klar“, gehorchte der junge Mann, schneller als ein Sohn gemeinhin seiner Mutter folgte. Das gefiel Ludwig. Er fühlte sich wie Robinson Crusoe, der einen Wilden rettete und ihn Freitag taufte, welcher ihm danach tief ergeben war. Er begriff jetzt die Lage besser. Dieser Afrikaner hier wollte durch beflissenes Schneeschieben zeigen, dass er ein wertvoller Teil der arbeitenden Bevölkerung darstellte. Und seine übersprudelnde Freundlichkeit entfaltete er als Schutzmantel. Wer ihm was wollte, musste diesen Mantel erst durchbohren, ausländerkritische Mitbürger zum Beispiel oder Beamte, mit denen er hier und da zu tun hatte.
Sicher hatte dieser Fremde die Erfahrung gemacht, dass seine Freundlichkeit auf manche mitreißend wirkte, was ihm zum Vorteil gereichte, denn dann stand er besser da. Andere entwaffnete sie, was ihm ebenfalls half, denn damit entging er mancher Konfrontation.
Das alte Mütterchen vorhin hinter der Gardine hatte er bestimmt auf diese Art um den Finger gewickelt.
„Haben Sie kurz Zeit?“
Der Afrikaner nickte freudig, aber mittendrin verbog sich sein Gesichtsausdruck in ein unbestimmtes Zögern. Was führte der Herr, der ihm immerhin den Vor- und Zunamen verraten hatte, im Schilde?
Ludwig war fast ein bisschen froh, dass dieser Jungspund hier ihm nicht alles bedenkenlos abkaufte. Also war jetzt Vertrauensbildung angesagt: „Ich habe Ihren Namen von der Agentur für Arbeit, vom Arbeitsamt. Ich möchte mit Ihnen über eine Anstellung reden.“
Oh gut, das klang nicht nach krummen Dingern und der freudige Ausdruck kehrte sogleich in das tunesische Gesicht zurück. „Oh gern!“ Er sah jetzt aus wie ein Kind, das unverhofft eine Weihnachtsbescherung erhielt. „Nach dieser Arbeit gern. Ich muss erst den Schnee fertigmachen.“
Ludwig lachte innerlich. Das Deutsch des Mannes war ganz passabel und um Klassen besser als Ludwigs Arabisch oder Französisch. Und so ein kleiner lustiger sprachlicher Ausrutscher wirkte sympathisch. Schnee machte man nicht fertig, den schob man beiseite. Nach außen lachte er aber nicht. Er war ein potenzieller Vorgesetzter und die mussten zuvorderst ernst und würdevoll auftreten. So hatte es Ludwig immer erlebt und so wollte er es ebenfalls handhaben. „Gut“, sagte er deshalb nur kurz und würdevoll, „ich gehe solange einkaufen.“
„Gut“, sagte auch der Tunesier, „ich mache den Schnee eilig fertig.“
Ludwig dachte unterdessen nach. War das der, der ihm vorschwebte? War das nun „sein“ Indianer, der Scout für seinen Western, wenn auch ein afrikanischer? Na gut, zumindest hatte er ein exotisches Wesen, wie im Film. Und für die Westernrolle des Außenseiters taugte er sicherlich ebenfalls. Ludwig sah ihn hier nicht gerade von Leuten umringt, die unbedingt seine Gegenwart suchten. Er rannte stattdessen da draußen einsam auf und ab und „machte den Schnee fertig“.
Und Semis Geschichte sollte Ludwig erst im Laufe der Zeit erfahren. Zum Beispiel, dass sich keiner hier richtig vorstellen konnte, wie es dort aussah, wo Semi herkam, außer die Behörden. Aber dass viele, die ihn sahen, hofften, dass er schnell wieder dorthin zurückkehrte, von wo er gekommen war, damit er hier keine kostbaren Steuergelder kostete.
Der junge Nordafrikaner wollte seinerseits niemandem auf der Tasche liegen. Zum Glück gestand ihm die Ausländerbehörde die Erlaubnis zu Aufenthalt und Arbeit zu – er konnte damit einer bezahlten Tätigkeit nachgehen. Also machte er sich auf Jobsuche. Aber ohne anerkannte Ausbildung und ohne Referenzen war das kein Zuckerschlecken. Wählerisch konnte man jedenfalls nicht sein. Semi fand hier und da eine Gelegenheit, zum Tellerwaschen, zum Schneefegen. Dass er dabei stets freundlich auftrat, milderte das Vorurteil des Schmarotzertums im Weltbild der Ausländer-Kritiker nicht. Er bewies mit seiner Fröhlichkeit nur seine Niedrigkeit in den Augen der kritischen Alteingesessenen. Doch zum Glück gaben sich nicht alle abschätzig, sondern manche auch offen.
Der Bürgermeister Moritz Hofmann zum Beispiel hatte ihn in der Gemeinde willkommen geheißen und hatte sich sogar schon einmal mit ihm für die Zeitung fotografieren lassen. Er wollte schließlich nicht als weltverschlossener Lokalpatriot dastehen in Zeiten, in der die deutsche Bundespolitik Weltoffenheit die Parole war. Manch einer hielt Hofmann deswegen für einen Gutmenschen. Nun, das war er nicht, denn er stürzte sich nicht blindlings in unkalkulierbare Abenteuer, wie er manchmal am Stammtisch hinter vorgehaltener Hand in Richtung besagter Bundespolitik grummelte. Der bayerische Widerspruchsgeist ließ grüßen.
Doch ein einzelner Nordafrikaner in der Gemeinde stellte kein Abenteuer dar. Er wirkte nicht unkontrollierbar wie eine Horde namenloser Zuagroaster. Er hatte einen Namen und ein Gesicht. Und er war freundlich. Also blieb Moritz Hofmanns stolze Seite erhaben über die Gutmenschen-Unterstellungen.
Seine vorsichtige Seite hingegen hatte Angst, dass sich wegen eben diesem Semi Baccar eine gegen ihn, den Bürgermeister, gerichtete „Alternative für Genglkofen“ formierte oder – da sprechende Abkürzungen im Trend lagen – gar die „Papagenos“: die „Patriotischen Parteinehmer gegen Nomaden“.
Ausländer stellten ein Spiel mit dem Feuer für einen gewählten Volksvertreter dar. Und Moritz Hofmann drückte sich selbst die Daumen, dass er sich im Umgang mit ihnen nicht die Finger verbrannte.
Ludwig ahnte von alledem nichts. Es hätte ihn auch kaum gekümmert. Generell interessierte ihn Politik wenig. Sie kam oft wechselhaft daher; dabei war es ihm am liebsten, wenn sich nicht viel änderte und die Dinge einfach blieben, wie sie waren. Bei seiner Tochter Callista lief das ganz anders. Doch jetzt nicht abschweifen. Zurück zur Sache, Ludwig!
Das Einzige, was ihn also am heutigen Nachmittag kümmerte, war die Frage, ob dieser Semi auf den Job passte und ob er ihm eine Chance geben sollte. Als er nach dem Einkauf aus dem Markt kam, war der Vorplatz ordentlich geräumt und kein Schnee zum „Fertigmachen“ mehr da.
„Gediegen“, dachte sich Ludwig.
Dennoch, einen Deutschen aus echtem Schrot und Korn hätte er als Helfer-Kandidaten bevorzugt. Mit denen konnte man reden, in gemeinsamer Sprache, ohne Missverständnisse. Die vertrugen auch mal ein hartes Wort, da musste man nicht ständig auf kulturelle Besonderheiten achten. Redewendungen, die hierzulande im Alltagsleben ganz normal vorkamen, die verstand ein heißblütiger Südländer eventuell anders und womöglich noch falsch und zückte innerlich das Messer.
Bei diesem Gedanken musste Ludwig fast schon über sich lachen. Er hatte doch selbst lange jenseits des Großen Teichs gelebt – als Ausländer.
Dennoch, eine unsichtbare Wand zwischen ihm und dem Dunkelhäutigen blieb. Ludwigs Reserviertheit stellte sie auf und sein Misstrauen hielt sie fest, damit sie nicht einstürzte. Dieser Typ musste sich erst Ludwigs Vertrauen verdienen.
Der Afrikaner spürte das Vorurteil, aber das ging ihm bei vielen Deutschen so. Die trugen ihr Herz eben nicht auf der Zunge. Das war schon OK. Und Freunde müssten dieser Luhtwich und er nicht werden. Das war gar nicht notwendig. Semi befand sich heute nicht auf der Suche nach innigen Freunden, er befand sich auf der Suche nach Arbeit. Und etwas, das länger als eine Stunde Anstrengung auf dem Supermarkt-Vorplatz dauerte und das regelmäßiger abgerufen und bezahlt wurde, das erschien ihm attraktiv.
Und so erwartete er den mit Einkäufen beladenen Ludwig ein paar Meter von der Supermarkttür entfernt. Er bot ihm an, etwas abzunehmen, was der aber abwehrte. Aber dass er ihm die per Fernbedienung entriegelte Jeep-Tür öffnete, das nahm Ludwig an.
Mitdenken konnte dieser Junge also, nahm Ludwig mit Genugtuung zur Kenntnis. Also erzählte er ihm während des Auto-Einladens davon, dass er Hilfe bei einer Überwachung benötigte und außerdem noch bei der Spurensuche.
„Und wo? In einer Fabrik?“, fragte der Nordafrikaner aufgeregt.
Siehe da, er interessierte sich. Ludwig erzählte ihm von der Ranch, von den verschwundenen Pferden. Und das ohnehin schon übernatürliche Leuchten im Gesicht von Herrn Baccar, in dessen Inneren sich tausend Danksagungen an die Agentur für Arbeit entluden, die diesen Luhtwich zu ihm geführt hatte, wurde noch heller.
„Kann ich Sie zu Kaffee einladen?“, fragte dieser Semi jetzt doch tatsächlich und winkte mit dem Kopf in Richtung Bäcker-Theke drüben am Supermarkt-Eingang.
Der wirkte echt ein bisschen aufdringlich; aber warum nicht, dachte sich Ludwig und willigte ein: „Na gut, aber den Kaffee zahle ich.“
Das nordafrikanische Leuchten bei den Stichwörtern „Ranch“ und „Pferde“ hatte einen einfachen Grund: Es war der Anlass, den die Agentur erfasst hatte und der Ludwig und den tunesischen Zuagroasten per Stichwortsuche zusammenbrachte: Semi hatte selber als Pferdehalter gearbeitet, erzählte er. In seinem früheren Leben, im Heimatland. Er verlieh die Tiere für Reitausflüge an Touristen. Damit sammelte er Geld und außerdem Sprachkenntnisse, vor allem Deutsch. Damit hatte er hier in Deutschland gleich eine gute Basis und ein Sprachkurs weitete sie noch aus.
Obwohl Ludwig die Herkunft seines Gegenübers bereits von der Arbeitsagentur erfahren hatte, zog er unwillkürlich die Augenbrauen hoch, als der Name des Heimatlandes während ihrer Unterhaltung fiel.
Der Afrikaner las Ludwigs Gedanken. Ja, in Tunesien gab es viele Menschen und darunter gab es eben auch Verirrte – Terroristen, die alles kaputtmachten. Sie hatten ihren Opfern und ihrem eigenen Land viel Schaden zugefügt.
Und das Bild des Tunesiers in Europa prägten vor allem die Terroristen, die am tunesischen Strand die Urlauber erschossen und die in Berlin Leute überfuhren. Die Tunesier jedoch, die sich am Strand schützend zwischen die Terroristen und die ausländischen Gäste gestellt hatten und sagten, man solle doch lieber sie anstelle der Urlauber erschießen, die verblassten in der kollektiven europäischen Erinnerung und von denen sprach keiner mehr. Gewalttäter bildeten nicht das wahre Gesicht des Landes. Semi wollte stattdessen dieses Gesicht sein und er versuchte, das Ludwig zu erklären, so gut er es vermochte.
„Verstehe“, bestätigte Ludwig kurz. Seine Bedenken gegenüber dem Fremden hatten sich inzwischen gelegt. Dieser Mann hier vor ihm sah nicht wie ein Gewalttätiger aus, auch konnte man mit ihm reden und außerdem war Ludwig groß und in der Lage, mit anderen Erwachsenen umzugehen, auch wenn sie aus einem fremden Land kamen. Darauf besann er sich jetzt, als der Afrikaner sprach. Ludwig schlürfte seinen Kaffee, während Semis Gefahr lief, kalt zu werden, weil er so aufgeregt war und viel erzählte.
„Warum sind Sie denn nach Deutschland gekommen?“, wollte Ludwig wissen. Schließlich musste er den Hintergrund seines möglichen Helfers durchleuchten. Zumindest den Teil, den ihm sein Gegenüber bereit war preiszugeben. Ob er alles glaubte, was er zu hören bekam, stand auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, Vertrauen musste verdient werden.
Und Semi berichtete, dass die Touristen in Tunesien ausblieben, als die Terroristen Menschen umbrachten. Und dass er beschloss, dass er zu den Urlaubern hinfuhr, wenn die nicht zu ihm kamen. Also verkaufte er seine Pferde, die er sowieso nicht mehr ernähren konnte, und versuchte hier sein Glück. Er war ja noch jung.
In Deutschland gab es viele Pferde, schwärmte er. Die Deutschen waren berühmt für Dressur- und Springreiten. Leider fand er hier keine Arbeit, die etwas mit Tieren zu tun hatte.
„Ziemlich blauäugig“, dachte sie Ludwig, denn so viele solcher Gelegenheiten gab es hierzulande nun auch wieder nicht, dass man jeden einreisenden Tunesier gleich auf die Ranch oder einen anderen der Höfe schicken konnte. Aber er erkannte die Begeisterung, sie züngelte wie eine Flamme in den Augen des Mannes. Und er glaubte zu sehen, dass dieser Semi gutmachen wollte, was andere seiner Landsleute an Schlechtem hervorbrachten.
War Ludwig jetzt selber naiv? Vor allem war er entspannt. Er sah dann schon, wie sich alles entwickelte. Auf Langfristigkeit war die Beschäftigung sowieso nicht ausgelegt und Gelegenheitsarbeit stellte für diesen Tunesier kein Fremdwort dar. Also würde er sich schon einfuchsen und gleichzeitig nicht arg enttäuscht sein, wenn das Engagement auf der Ranch nicht lange hielt.
Und was die Sicherheit anbetraf, so hielt Ludwig diesen jungen Mann schon in Schach, der jetzt hastig seinen Kaffee trank, weil er nach ehrlicher Erschöpfung vom Vorstellungsgespräch schieren Durst hatte.
„Was bedeutet ’Semi’ denn eigentlich?“, fragte Ludwig abschließend, als er den Kaffee ausgetrunken hatte und sich ein neuer Becher nicht mehr lohnte.
„Der alles Hörende.“
Das klang fast zu gut, um wahr zu sein. Ludwig nickte leicht. Er wollte es ihm mal glauben. Und er nahm es als gutes Omen.
„Gut“, sagte Ludwig, „Sie sind eingestellt.“