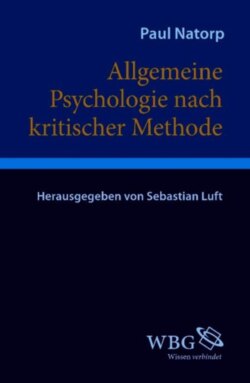Читать книгу Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode - Пауль Наторп - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Natorps Programm einer rekonstruktiven Psychologie: der Rückgang auf das Unmittelbare des Bewusstseins. Kurze Inhaltsübersicht über die Allgemeine Psychologie
ОглавлениеWelchen Weg findet Natorp aus dem Dilemma? Wichtiger Ansatzpunkt für seine Bemühung ist die Rückerinnerung an eine wissenschaftstheoretische Debatte, die im späten 19. Jahrhundert zwischen den Neukantianern – hier v.a. der südwestdeutschen Schule – und Dilthey geführt wurde. Im Lichte der erstaunlichen Ergebnisse der Naturwissenschaften wurde mit einem Mal der Status der sogenannten Geisteswissenschaften fraglich. Ihr Vorgehen kann, wie Windelband meinte, gegenüber den „nomothetischen“ (also Gesetze feststellenden) Naturwissenschaften, „idiographisch“ (das Individuelle beschreibend) genannt werden. Sie sind, wie es Dilthey nannte, gegenüber den „erklärend“ vorgehenden Naturwissenschaften, „verstehend“. Windelbands und Diltheys Unterscheidungen sind nicht identisch, aber deuten auf je ihre Weise auf die fundamentale Differenz beider Wissenschaftsarten. Es ist eben etwas radikal Verschiedenes, ob man Naturvorgänge erklärt oder die Geisteshaltung Goethes nachversteht.
Die Frage ist nun, ob das Bewusstsein eine Naturtatsache ist oder der Sphäre des „Geistes“ angehört. Je nachdem, wie man die Frage beantwortet, würde dann die Psychologie, als Wissenschaft vom Bewusstsein, entweder eine Natur- oder eine Geisteswissenschaft sein. In der Tat wurde die Debatte in dieser Gegenüberstellung geführt: Die „Seele“ ist entweder ein Teil der Natur und daher sind ihre Gesetze nichts anderes als Naturgesetze, so dass ein schroffer Unterschied zwischen Gehirn und Seele gar nicht besteht, weshalb man die Idee einer separaten, etwa gar unsterblichen, Seele getrost aufgeben kann. Das ist die Position des Naturalismus. Oder die Seele oder das Bewusstsein sind etwas radikal anderes, etwas „Geistiges“, was unter seinen ihm eigenen Gesetz- oder Regelmäßigkeiten steht, und diese sind eben – ja was genau? Dies ist die Frage, die sich stellt, wenn man das Bewusstsein als gegenüber jeder Naturtatsache radikal eigenständig ansieht. In diesem Fall erfordert eine Psychologie, wenn sie nicht als Naturwissenschaft aufgefasst wird, ihre eigenen Begrifflichkeiten, Methoden und Kategorien. Die Frontlinien und Grundunterscheidungen, wie sie hier aufgezeigt sind, sind heute trotz neuer Terminologie im Wesentlichen die gleichen.
Entscheidend für das Verständnis von Natorps Projekt ist, dass seine systematische Stellung quer zu der Alternative Natur- oder Geisteswissenschaft steht: Natorps Psychologie ist nämlich Wissenschaft weder der einen noch der anderen „Region“, weil beide Disziplinen in je ihrer Weise objektivierend vorgehen, sofern sie Gesetzmäßigkeiten feststellen. Dies geschieht ebenso in den Geisteswissenschaften, wenn sie dem Geiste eigene Begrifflichkeiten und Theorien, die eo ipso allgemeingültig, also objektiv gültig sind, fordern18. Aus diesem Grund bevorzugt Natorp auch den Titel „Kulturwissenschaften“, der beide Wissenschaftsarten umfasst (denn auch Naturwissenschaft ist Teil des menschlichen Kulturschaffens). Beide Grundpositionen sind laut Natorps Verdikt darin identisch, dass sie objektivierend vorgehen und damit das Subjektive in diesem Prozess „töten“. Ist Wissenschaft sowohl im Sinne von Natur- wie Geisteswissenschaft fest-stellend, also objektivierend, dann darf die Psychologie keine Wissenschaft, zumindest nicht im herkömmlichen Sinn aller anderen Kulturwissenschaften, sein. Ein Großteil der eigentlichen Ausführungen in der AP sind negativ und dem Nachweis gewidmet, inwiefern Psychologie als Wissenschaft im traditionellen Sinn das Psychische in praxi objektiviert, also explizit oder nicht als fixierte Tatsache, sei es der Natur oder der vom Menschen gemachten Kultur ansieht. Diese scharfsinnige Aufdeckung und Kritik vor allem an den in der Psychologie vorherrschenden Naturalismen ist immer noch hochaktuell.
Wenn also die AP den Untertitel „Objekt und Methode der Psychologie“ hat, so ist Natorps Pointe, dass weder das Objekt der Psychologie – welches nämlich gerade kein Objekt, sondern ein Subjekt ist –, noch die Methode der Psychologie, die aller anderen Wissenschaft gegenüber radikal anders sein muss, je recht konzipiert wurden. Der Anspruch von Natorps „Psychologie“ könnte also radikaler kaum sein. Es überrascht nicht, dass Husserl, dessen Anspruch mit seiner Phänomenologie nicht weniger radikal war, in Natorps Psychologie eine „große Vorahnung“ seines eigenen Projekts sah19; und in der Tat sind die Parallelen von Husserls Phänomenologie und Natorps Psychologie auffallend, sowohl methodisch wie deskriptiv. Husserls Phänomenologie, insbesondere in ihrer reifen („genetischen“) Gestalt, ist undenkbar ohne den Einfluss Natorps. Ein weiteres Indiz für ihre enge Verbundenheit ist, dass Husserl die Philosophie des Marburger Neukantianismus zwar ablehnte, womit er die transzendentale Methode meinte; Natorps Psychologie hingegen sah er, völlig richtig, nicht als Teil dieser Schuldoktrin. Natorp war seinerseits begeistert von Husserls Widerlegung des Psychologismus im ersten Band der Logischen Untersuchungen (den Prolegomena zu einer reinen Logik), die ihn in Husserl einen Gleichgesinnten sehen ließ.
Nach der Ablehnung objektivierender Methoden verbleibt jedoch die Frage: Welche Methode muss also nun dem wahren „Objekt“, d.h. dem Subjekt, gegenüber angewandt werden, um den grundsätzlichen Fehler der Objektivierung zu vermeiden? Natorps Eröffnungsschritt besteht darin, den Begriff des Bewusstseins selbst zu differenzieren. Ist dem Bewusstsein immer etwas bewusst, hat es also „Inhalte“ bzw. ist es „intentional verfasst“, wie man in phänomenologischer Terminologie sagen könnte, dann muss man die Inhalte des Bewusstseins von dessen Tätigkeiten (den intentionalen Vollzügen) unterscheiden, sowie schließlich das Ich, dem diese Inhalte bewusst sein. Diese Unterscheidungen laufen im mit Äquivokationen behafteten Begriff „Bewusstsein“ unglücklich ineinander. Was Bewusstsein also gegenüber aller bewussten Objektivität auszeichnet – wenn man unter letzterer alles versteht, was einem bewusst sein kann –, ist die Tatsache des Bewusst-seins selbst, also des „bewusst“ an sich, ungeachtet all dessen, was ins Bewusstsein treten kann. Natorp verwendet hierfür den Neologismus „Bewusstheit“20 und bezeichnet hiermit das gegenüber allem Objektiven radikal verschiedene Wesen des Bewusstseins. Ist alles, was bewusst werden kann, Objektives, ist das Bewusstsein das allem Objektiven gegenüber radikal Entgegengesetzte.
Diese radikale Entgegensetzung kann nun methodisch eingeholt werden. Die transzendentale Methode besteht in der Konstruktion des Objektiven in wissenschaftlichen Theorien, der Konstruktion wissenschaftlicher Fakta. Die Tätigkeit der Wissenschaft ist die Verobjektivierung von subjektiven Denkvollzügen, die in wissenschaftlichen Theorien ihre Kristallisierung finden. Ist die Bewegung der Wissenschaft demnach die vom Subjektiven zum Objektiven hin, steht nichts im Wege, diese Bewegung rückgängig zu machen, also die Konstruktion zu re-konstruieren. Damit ist die Marschrichtung der Natorp’schen Psychologie vorgegeben: die Re-Konstruktion des unmittelbaren Erlebens im Bewusstsein rückgehend von den Objektivierungen. Entsprechend vergleicht Natorp die zwei Methoden der Objektivierung und der Subjektivierung auch als die Plus- und Minus-Richtung auf einer gemeinsamen Skala (vgl. unten, S. 68). Die Psychologie in Natorps Verständnis ist zwar aller objektiven Bewegung der Wissenschaft radikal entgegengesetzt, ist aber letztlich doch keine eigenständige Methode gegenüber der der Wissenschaften, sondern deren Umstülpung oder Umkehrung. Es gibt also nicht zwei verschiedene Arten von Wissenschaften, sondern es gibt einen Prozess bzw. eine Struktur, die in zwei einander entgegengesetzten Richtungen abgeschritten werden kann. Die Wissenschaft im traditionellen Verständnis ist damit einseitig, sofern sie diesen subjektiven Prozess selbst ignoriert21. Das Verhältnis von subjektiver und objektiver Wissenschaft ist nach Natorp vielmehr eine Korrelativität in der Bewegung, deren Unterschied lediglich in der Richtung besteht. In Wahrheit bilden Objektives und Subjektives eine „ideale Einheit“.
Welche Ergebnisse sind von einer solchen psychologischen „Wissenschaft“ zu erwarten? Sind die Ergebnisse der Wissenschaften (im normalen Sinn) allgemein und abstrakt, so geht die Rekonstruktion den entgegengesetzten Weg und verweist auf die urtümliche Konkretion des Bewusstseins, in dem sich das Allgemeine bildet und formiert. Das Bewusstsein bzw. die Bewusstheit ist das „Urkonkrete“, aus dem alles gleich einer stetig sprudelnden Quelle entspringt und auf das alles Bewusste zurückbezogen ist22. Was als ein Auseinander von unterschiedlichen Objektivationen (den verschiedenen Kulturregionen) erscheint, ist entsprungen aus der einen ursprünglichen Kontinuität des Bewusstseinsstroms. Das Subjektive ist damit ein stetig pulsierendes „Herz“ als urkonkretes Leben, aus dem Objektivierungen in verschiedene Richtungen entspringen. Später wird Natorp für diese Urkraft bzw. Urtätigkeit den Begriff der Poiesis, als des urkonkreten, noch blinden Schaffens, verwenden.
In jeder Objektivierung muss es möglich sein, das Objektivierte auf dieses konkrete Leben zurückzuführen. So kann man also von verschiedenen Objektivierungen her auf verschiedene Weisen rückschließen, in denen sich das ursprüngliche Leben des Bewusstseins ausspricht. Grundbegriff hierfür ist bei Natorp die Potenz (s. unten, S. 78ff.)23. Diese ist der „disponierende Grundbegriff“ der Psychologie (s. unten, S. 213ff.), sofern alle abstrakte Aktualität des Bewusstseins auf ihre konkrete Potentialität zurückgeführt wird, jede Energeia, mit Aristoteles zu reden, auf ihre Dynamis, ihre Potentialität des Bewusstseinslebens. So ergibt sich ein „Stufengang der Objektivierung“ (S. 101), der jeweils in der Rekonstruktion wiederum in seine entsprechenden subjektiven Prozesse aufgelöst werden kann. In Natorps Worten:
Dieses alle Möglichkeit einer Psychologie, als der Wissenschaft von der Subjektivität, begründende allgemeinste Wechselverhältnis des Bestimmbaren und seiner Bestimmung gilt nun eben in dem ganzen Stufengange der Objektivierung, also auch der dieser entsprechenden Subjektivierung: für jede höhere Stufe der Objektivierung bedeutet die niedere die Potenz, für jede niedere die höhere die entsprechende Aktualisierung. Aber eben indem dieses Wechselverhältnis für die ganze Stufenfolge der Objektivierung, also wieder und wieder gilt, solange als irgend noch etwas von Bestimmtheit erreichbar, d.h. soweit überhaupt irgendetwas noch mit Sinn aussagbar ist, so findet dieser Stufengang, also auch der Rückgang zu den subjektiven Grundlagen, seine ideale Grenze in dem Ansatz eines letzten noch schlechterdings nicht Bestimmten, aber aller Bestimmung Fähigen, somit allseitig Bestimmbaren und zu Bestimmenden, einer Aristotelischen Urmaterie () oder eines Chaos, aus dem die ganze Weltschöpfung des Bewusstseins hervorgehe, wenigstens in letzter, in allerletzter Betrachtung hervorzugehend zu denken sei. (S. 214)
Diese Grund-„Bewegung“ nun kann nun nicht nur von der Erkenntnis her (also dem theoretischen Bewusstsein) rückgängig gemacht werden, sondern von allen anderen Bewusstseinsrichtungen, nämlich den praktischen, künstlerischen und religiösen, sofern sie in objektiven Gebilden (Moralsystemen, Kunstwerken und religiösen Kulten) terminieren. Die Totalität dieser objektiven Gebilde ist in der Tradition der Marburger Schule Kultur. Die Transzendentalphilosophie der Marburger Schule vollzieht damit, wie es Cassirer sagt, den Schritt „von der Kritik der Vernunft zur Kritik der Kultur“24. Bei allen Unterschieden, die Cassirers Kulturphilosophie, wie sie in seiner Philosophie der symbolischen Formen ausgeführt wird, auszeichnet, ist diese Konzeption von Kultur und deren Kritik ein roter Faden, der durch den Marburger Neukantianismus hindurchgeht. Natorps allgemeine Psychologie ist die dieser Kulturphilosophie im Ganzen radikal entgegengesetzte „Disziplin“.
Wie geht diese Psychologie nun vor? Laut Natorp hat sie im Wesentlichen zwei Stufen. Zunächst ist es die Aufgabe der allgemeinen Psychologie, d.h. noch vor der Untersuchung der verschiedenen Bewusstseinsrichtungen, eine allgemeine Beschreibung von „psychologischen Grundkategorien, wie Sinnlichkeit überhaupt, Zeit- und Raumordnung überhaupt, Begriffsfügung überhaupt, Strebung überhaupt“ (S. 221) usw. durchzuführen. Daraus erwächst, wie Natorp es ausdrücklich unter Hinweis auf Husserl sagt, eine „Phänomenologie des Bewusstseins“ als „bloßer Beschreibung der Bewusstseinsgestaltungen ihrer Art nach“ (ebd.), also noch vor ihrer Unterscheidung in die „reinen Erkenntnis-, Willens- und Kunstgestaltungen“ (ebd.). Natorp gesteht jedoch zu, dass man zur ursprünglichen Konkretion des Bewusstseins auf dieser Stufe der Psychologie noch nicht vordringt: Denn „mit dem allen bliebe man noch immer weit diesseits des vollen, unmittelbaren Lebens des Bewusstseins“ (ebd.). Diese erste Stufe ist eine Art Propädeutik, die erst den Sinn für die eigentliche Seinsweise des Bewusstseins schärft.
Die Hauptaufgabe der allgemeinen Psychologie besteht darin, eine „Stufenfolge der Erlebniseinheiten“ anzusetzen, also der Erlebnisweisen des „Ich“ auf der jeweiligen Stufe der Bewusstheit, um die „Zurückbeziehung des Erlebnisinhalts auf das erlebende Ich“ (S. 222) zu etablieren. Was hiermit gemeint ist, präzisiert Natorp mit der Bezeichnung „genetische Psychologie“ oder „genetische Betrachtung“, die nicht mit einer zeitlichen Stufenordnung zu verwechseln ist, sondern eine „überzeitliche“ Betrachtung der Genesis des Bewusstseinslebens selbst ist. Jede genetische Betrachtung, die in die subjektiven „Tiefen“ zurückdringt, ist damit parallel zu jeder Stufe der Objektivierung, jedes Mal analog hinsichtlich ihrer Stufe. Jede Objektivierungsstufe wird damit auf ihre jeweilige subjektive „Potenz“ hin befragt.
Somit weist die „Grunddisposition“ der Psychologie zwei Stufen, eine „ontische“ und eine „genetische“, auf, so dass „aus dem Gesichtspunkte der Genesis nicht eine neue Provinz der Psychologie abzugrenzen ist. … [U]nd zwar vertritt die allgemeine Phänomenologie die ontische [Seite], die Stufenordnung die Erlebniszusammenhänge die genetische Seite der psychologischen Aufgabe“ (S. 239).
Die ontische Phänomenologie, die die erste Stufe der allgemeinen Psychologie ausmacht, ist vergleichbar mit dem, was Husserl „statische Phänomenologie“ nennen wird, d.h. die Grundunterscheidung der intentionalen Aktvollzüge in das bewusste Ich, die Art des Aktvollzuges und des Aktinhalts, wobei Husserls noetisch-noematische Phänomenologie sicher weitaus differenzierter ausgeführt ist als Natorps allgemeiner Phänomenologie. Der springende Punkt für Natorp ist, dass diese erste Stufe, insofern sie Abstraktheiten des Bewusstseins feststellt, als Wissenschaft nicht anders als andere objektivierende Wissenschaften vorgeht. Sie mag damit zwar einen ersten Hinweis auf die den abstrakt aufgewiesenen Bewusstseinsarten zugrundeliegenden Bewusstseinsweisen des konkreten Lebens des Bewusstseins darstellen, ist aber nicht selbst die dem Bewusstsein eigentlich angemessene Disziplin; sie ist gewissermaßen die Vorstufe zur eigentlichen Psychologie.
Diese, die wahre Psychologie, die eine genetische Betrachtungsweise voraussetzt und der Husserl’schen genetischen Phänomenologie vergleichbar ist, kann, als rekonstruktiv und zurückgehend auf das konkrete Leben, nicht mehr „Wissenschaft“ im herkömmlichen Sinn genannt werden, und es stellt sich die Frage nach ihrem Untersuchungsgegenstand: was bleibt außer dem ständigen Hinweis auf das konkrete Leben, aus dem alles weitere – was immer es sei – entspringt, was aber selbst nicht mehr thematisiert werden kann? Husserls Antwort in seiner genetischen Phänomenologie, dass auch in dieser Sphäre der Genesis – von Husserl auch Passivität genannt – „Gesetze der Genesis“ aufzuweisen sind, wäre für Natorp insofern inakzeptabel, als die Feststellung von Gesetzen wiederum objektivierend ist. Wo für Husserl Phänomenologie selbstverständlich eine Wissenschaft ist (als Wissenschaft von der Erfahrungsweise von Welt vom Erfahrungsstandpunkt), tut sich für Natorp hier ein Abgrund von dunklem „Bewusstseinsgrund“ auf. Auf diesen kann man zwar im Prinzip als allen Objektivierungen zugrundeliegenden Einheitsgrund verweisen, man kann aus ihm jedoch nicht viel mehr heben außer diesem Hinweis auf „konkretes Leben“, ohne dem Objektivierungsverdacht zu verfallen.
Liest man Natorps allgemeine Psychologie mit der Erwartung, eine konkrete Wissenschaft mit ihren eigenen Ergebnissen vorzufinden, die etwa eine echte Alternative zu empirischen Psychologien oder Husserls transzendental-eidetischer Phänomenologie oder Heideggers Hermeneutik des faktischen Daseins wäre, wäre man sicherlich enttäuscht. Es sollte aber deutlich werden, dass vor allem Husserls späte Phänomenologie ohne den Einfluss Natorps unmöglich gewesen wäre. Auch der frühe Heidegger, der sich zwar Natorp gegenüber fast ausschließlich kritisch äußert, ist maßgeblich von Natorps Insistenz auf der letztlich nicht-objektivierbaren Konkretion des faktischen Lebens des Menschen beeinflusst worden. In der Tat ist Natorps Psychologie – wenn der Titel überhaupt angemessen ist – in erster Linie wirkungsgeschichtlich von Bedeutung; diese Bedeutung kann jedoch kaum überschätzt werden. Auch als Leistung in sich selbst, vom Standpunkt eines Kantianismus die Möglichkeit, wenn nicht einer Psychologie, so doch eines Zugangs zum konkreten Bewusstseinsleben zu erschließen, ohne in einen Naturalismus oder Empirismus zu verfallen, ist Natorps AP in ihrer spekulativen Kraft ein höchst beeindruckendes Dokument eines systematischen Zwischenstadiums zwischen Kritizismus und Phänomenologie.
Dennoch ist letztlich das Urteil nicht vermeidbar, dass die Natorp’sche Psychologie keine Wissenschaft ist, denn sie ist aller Wissenschaft im herkömmlichen Sinn entgegengesetzt. Was ist dann die AP? Es handelt sich nicht eigentlich um eine Psychologie, sondern eine gegenüber aller Wissenschaft angesiedelte Metareflexion auf die Tatsache, dass alles Objektive seinen subjektiven Ursprung hat. Eine eigentliche Wissenschaft ist demnach auch hieraus nicht zu entwickeln, wie Natorp vermutlich selbst gemerkt hat, als er seinen stolz angekündigten Ansatz nicht weiter ausgeführt hat. Dennoch würde man Natorps Leistung geringschätzen, würde man sie an dem positiv Geleisteten allein messen. Vielmehr ist Natorps Leistung in AP in erster Linie eine eindrucksvolle Demonstration, dass das Bewusstsein keine weltliche Tatsache ist, sei es der Welt der Natur oder des in Kulturgestalten verobjektivierten Geistes. Auch sind die von ihm ins Feld geführten Argumente gegen die Naturalisierung des Bewusstseins im Lichte gegenwärtiger Debatten zur Naturalisierung des Bewusstseins höchst lesenswert. Seine diesbezüglichen Ausführungen haben nichts an ihrer Aktualität verloren, auch wenn die AP letztlich ein philosophisches Fragment geblieben ist. Aber bekanntlich sind ja viele große Werke der Philosophiegeschichte Fragmente geblieben.