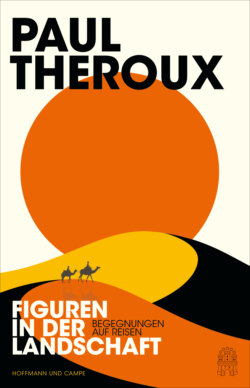Читать книгу Figuren in der Landschaft - Paul Theroux - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. »Einer, der vorm Schicksal floh«
ОглавлениеFür Amerikanerinnen und Amerikaner unter sechzig ist die literarische Welt, die in den zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg bestand, heute kaum mehr vorstellbar oder zu verstehen, und insbesondere nicht die Faszination, die Schriftsteller auf die Öffentlichkeit ausübten. Henry Miller kommt einem in den Sinn. Er war einer von vielen, die sich an der Grenze zum Outlaw bewegten, aber in einem Zeitalter der Zensur – das Verbot von Lady Chatterley und so fort – ist alles Schreiben eine heikle Sache. Bis vor rund zwanzig Jahren waren Schriftsteller als Menschen einer lesenden Öffentlichkeit nicht zugänglich. Sie lasen nicht in Buchhandlungen aus ihren Büchern; sie hielten keine Vorträge mit freiem Eintritt in der Bibliothek und standen nicht zum Signieren von Büchern bereit. Sie waren nicht sichtbar. Sie hatten mehr Macht, weil sie woanders waren, man redete über sie nur hinter vorgehaltener Hand. Sie sind heute alle tot, aber ein paar der Schriftsteller, die diese Art von Ruhm als auffällige Abwesende (Mailer, Bellow, Styron und andere Heroen in ihren Achtzigern) genossen hatten, erlebten auch noch dieses Zeitalter der Behelligung, in dem die Verlage mit dem Buchhandel gemeinsame Sache machen und die Schriftsteller in die Öffentlichkeit zerren und ihren Vermarktungsmechanismen unterwerfen. Dieser merkwürdige und spießige Exhibitionismus gehört jetzt zum Lauf der Welt. Greene blieb davon verschont.
Die Epoche, an die ich denke – deren Untergang in den 1960ern begann, vielleicht als die Verlage zu monströsen Unternehmen mit einer Vorliebe fürs Durchschnittliche wurden –, war zugleich ein Zeitalter der Zensur. Greene sorgte für einen riesigen Skandal, als er 1955 die bei Olympia Press erschienene Ausgabe von Lolita zu seinem Buch des Jahres erklärte. Durch seine Nennung bekam das Buch zugleich massiv Aufmerksamkeit und lukrative Verträge in London und New York, neben den lautstarken Verwünschungen natürlich. Der Vatikan setzte Greenes Romane auf den Index, während die in ihnen dargestellten Ehebrüche die Verkaufszahlen nur steigerten. Da ich in einer Zeit der Zensur von Büchern aufwuchs, dachte ich, dass jedes ernst zu nehmende Schreiben ein anrüchiges, leicht subversives Unternehmen sein müsse, was es nur umso attraktiver für mich machte.
Graham Greene, 1904 geboren, war ein solch subversiver Held, der selbstbewusst (mit Robert Brownings Worten) »den gefährlichen Rand der Dinge« aufsuchte, einer, der überall und nirgends lebte, ein Mann, den nur wenige Leute kannten. Als – mit den Worten seines Biographen – »einer, der vorm Schicksal floh«, hat Greene zwei Memoirenbände veröffentlicht, Eine Art Leben (1971) und Fluchtwege (1980), die mit Auskünften über sich selbst ausgesprochen sparsam sind, um nicht zu sagen irreführend. Auch wenn er Interviews gegenüber weniger abgeneigt war, als er zugeben wollte, hatte die Person des Interviewers höchsten Ansprüchen zu genügen. V.S. Pritchett, Anthony Burgess und V.S. Naipaul reisten nach Antibes, um vor dem Meister niederzuknien und danach nette Dinge über ihn in Sonntagsausgaben zu schreiben. Greene muss gewusst haben, dass solche Männer nichts über sein ungeregeltes Leben ausplaudern und keine unangenehmen Fragen stellen würden, obwohl Burgess sich bekanntlich über Greene als Frömmler und Poseur lustig machte und daraufhin von ihm mit einem Bann belegt wurde.
Im Bewusstsein, dass er ein verborgenes Leben führte, entwickelte Greene die Gewohnheit dauernden Ausweichens, die einer fast pathologischen Unfähigkeit gleichkam, die Wahrheit zu sagen. Seine Heimlichtuerei brachte ihn dazu, zeitweise ein doppeltes Tagebuch zu führen, was es ihm ermöglichte, zwei verschiedene Versionen seines Tages aufzuschreiben, eine recht nüchterne und geschäftsmäßige und eine, die voller Tollereien mit einer Prostituierten sein konnte. Verrat war ein Thema, von dem er besessen war. Da er zu zögerlich, zu gelangweilt davon oder zu argwöhnisch war, selbst eine ausführliche Autobiographie zu schreiben, machte Greene Norman Sherry, einen renommierten Englischprofessor und Verfasser von Biographien, zu seinem offiziellen Biographen. (Als ich 1968 ans Englische Seminar der Universität von Singapur kam, wurde mir zufällig der Bürostuhl zugewiesen, den Professor Sherry die vier vorangegangenen Jahre gewärmt hatte.) Greene hatte Sherrys Bücher über Joseph Conrad gelesen und schätzte sie, insbesondere Conrad’s Eastern World, und war beeindruckt von Sherrys Energie, Conrads Spuren zu folgen, an fiktive Orte und alte Schauplätze. Mit seiner üblichen Vorsicht bestellte Greene 1990 Sherry zunächst zu Drinks und Essen bei sich ein und bot ihm, nach gründlicher Prüfung, schließlich uneingeschränkten Zugang an. Greene sagte: »Keine Lügen, bitte. Folgen Sie meinem Leben bis an sein Ende.« 1976, nach zwei Jahren Vorarbeiten, fing Sherry mit der Niederschrift von Life of Graham Greene an, 1989 erschien der erste Band über die Jahre 1904 bis 1939. Greene konnte das Buch noch lesen, bei Erscheinen des zweiten Bandes (1939–1955) im Jahr 1994 war er schon tot. Ein Jahrzehnt später, mit der Veröffentlichung des lange erwarteten dritten Bandes (1955–1991), ist Sherrys Werk, insgesamt 2218 eng bedruckte Seiten, vollendet.
Für alle, die sich für Greenes Leben und Werk interessieren, ist diese dreibändige Biographie unersetzlich; als intellektuelle und politische Geschichte des 20. Jahrhunderts ist sie von unschätzbarem Wert; als literarische Reise sowie als Weltreise ist sie meisterhaft; als Quellensammlung und Schurkengalerie ist sie faszinierend. Sherry ist kein Stilist wie Leon Edel als Verfasser der fünfbändigen Biographie von Henry James, aber die Leistung dieses Werks lässt sich durchaus mit der von Edel vergleichen. Es ist ähnlich befriedigend und erschöpfend und führt beim Leser zu einem viel intimeren und physischeren Verhältnis zu seinem Protagonisten.
Im dritten Band begegnen wir dem Dramatiker Greene sowie seiner Reise nach Kuba, aus der Unser Mann in Havanna hervorging; der Reise in den Kongo, die in Ein ausgebrannter Fall ihren Niederschlag fand; den Reisen nach Haiti mit dem Buch Die Stunde der Komödianten; den Reisen nach Südamerika und dem Buch Der Honorarkonsul, dazu Reisen mit meiner Tante und Der menschliche Faktor. Während er zwar finanziell ruiniert war, wird Greene in den letzten Jahrzehnten seines Lebens für preiswürdig erachtet, erhält Auszeichnungen, erträgt das Gezänk um die Frage, ob er des Nobelpreises würdig sei, der kaum mehr zu sein scheint als eine schwedische Lotterie. Er lehnt den Ritterschlag ab, bekommt aber den fetteren Orden, den der Companion of Honour. Er wird in einen französischen Skandal verwickelt und schreibt sein J’Accuse. Er tut sich mit einem spanischen Priester zusammen und schreibt Monsignor Quixote. Er schließt Freundschaft mit Omar Torrijos, dem Premierminister von Panama, und schreibt Mein Freund, der General. Eine große Liebesaffäre endet, eine andere nimmt ihren Lauf, und er findet endlich eine Gefährtin, eine hingebungsvolle (aber verheiratete) Frau, in deren Armen er stirbt. Seine letzten Worte, Schmerzen leidend: »Ach, warum dauert es so lange, bis er kommt.«
In diesem letzten Abschnitt seines Lebens schrieb er »Leihen Sie uns Ihren Mann?«. Sein Biograph misst der Geschichte nicht viel Wert bei, für mich aber bleibt sie eine meiner Lieblingsgeschichten. Sie enthält diese Beobachtung: »Am Ende dessen, was man das ›Sexualleben‹ nennt, ist die einzige Liebe von Bestand jene, die alles ertragen hat, jede Enttäuschung, jedes Scheitern und jeden Betrug, die selbst die traurige Tatsache akzeptiert hat, dass am Ende kein Begehren so tief ist wie das einfache Bedürfnis nach Gemeinschaft.«
Greene war ein rastlos Reisender, ein engagierter Schriftsteller, ein fürchterlicher Ehemann, ein entsetzlicher Vater und eingestandenermaßen manisch-depressiv. Er war unablässig sexuell und stürmisch dauererregt. »Ich glaube, sein sexueller Appetit ist unersättlich, beängstigend«, sagte einer seiner engen Freunde, aber da er Engländer war, sollte man das Wort »beängstigend« nicht allzu ernst nehmen. Ganz sicher aber war Greene ein unermüdlicher Womanizer. Wie viele andere sexbesessene Männer war er tendenziell bindungsscheu, ausweichend, verschwand gern ohne Erklärung und hatte einen Hang zu sentimentalen Äußerungen, immer aber war er fieberhaft auf der Jagd. Er hat oft über Schreibblockaden geklagt, aber wenn es um Frauen ging, war er extrem wortreich. Er hatte die romantischen Anfälle und die Phantasie eines Lüstlings; diese brachte er zu Papier.
Ein Großteil des ersten Bandes ist seiner Suche nach einer passenden Frau gewidmet. Als sich der junge Greene für Vivien Dayrell-Browning entschieden hat, schreibt er ihr mehr als zweitausend Briefe, bevor er sie schließlich überzeugen kann, ihn zu heiraten. Kaum zwei Jahre nach der Heirat geht er aber schon wieder zu Prostituierten. Die Ehe geriet in die Krise, als Kinder kamen. Er besaß so wenig väterlichen Instinkt, dass er ernsthaft erwog, mindestens eines von ihnen zur Adoption freizugeben. »Wie wenig ich Kinder mag«, schrieb er an eine seiner Liebhaberinnen und klagte über seine Kinder, ihren Egoismus, ihre Forderungen – auch noch lange, nachdem er von zu Hause ausgezogen war, nach zwanzig Jahren mit Vivien, von denen er mehrere damit zugebracht hatte, Liberia und Mexiko zu bereisen, Meisterwerke zu schreiben, fremdzugehen oder seine Frau einfach zu meiden.
Auch wenn er darüber sprach, Vivien zu verlassen, ließ er sich nie von ihr scheiden. Seine Ehe bewahrte ihn davor, sich ganz für eine seiner Liebhaberinnen entscheiden zu müssen: für Dorothy Glover, der wir früh im zweiten Band begegnen und mit der er fremdging zu der Zeit, als seine Ehe zerbrach, oder eine andere, insbesondere Catherine Walston, mit der er eine leidenschaftliche Affäre (den Großteil des zweiten Bandes hindurch) hatte, die schließlich zu einer Freundschaft wurde, die bis zu ihrem Tod hielt. Diese Affäre mit Walston wird in Tausenden weiteren Briefen erzählt. Eine leidenschaftliche Affäre konnte Greene zu fünfzehnseitigen Briefen inspirieren, schloss aber Treue nicht ein. Ein Grund war, dass er viele, wenn nicht die meisten seiner Affären mit verheirateten Frauen hatte, deren betrogene Ehemänner wenig anderes tun konnten, als zu seufzen oder bedeutungslose Ultimaten zu stellen. Er hatte seine Gründe dafür, sich verheiratete Frauen zu suchen und immer wieder Teil von Ménages à trois – oder auch à quatre, oder sogar cinq – zu werden. Nach ihrer Bekehrung zum Katholizismus entwickelte Catherine Walston eine Vorliebe für Priester und ermunterte sie – wahnsinnig attraktiv, wie sie war –, ihre Liebhaber zu werden. Catherines Mann Harry reagierte darauf lediglich mit einem Schulterzucken und fing etwas mit der verlassenen Dorothy Glover an; und während Greene die Sache mit den Priestern verurteilte, war er selbst (wir sind jetzt im dritten Band) mit Anita Björk liiert, einer schwedischen Schauspielerin, und dann mit Yvonne Cloetta, der Frau eines Diplomaten in Kamerun, deren Mann davon keinen Schimmer hatte. Wundert es da, dass Greenes Bücher voller Ehebrüche sind? »Greenes Wahrheit liegt in seiner Literatur«, schreibt Sherry und belegt es immer wieder. Da das Thema Kindheit in Greenes Werk eine große Rolle spielt, könnte man ergänzen, dass dem Wesen eines Greene’schen Ehebruchs – vielleicht des Ehebruchs im Allgemeinen – etwas eignet, das ihm die Spannung eines Kinderspiels verleiht: das Verstecken, die Geheimnisse, die Lügen, die Schauspielerei, die kichernde Befriedigung, die Schuld, sogar der heimliche Sex selbst.
Zu einem anschaulichen Beispiel für Greenes kindliche Perversität kommt es 1959 auf Jamaika, wo er gerade mit Catherine Urlaub macht und an einen Freund schreibt: »Trotz des angenehmen Lebens hier (& meiner 500 Wörter pro Tag) schweife ich in der Phantasie doch ziemlich stark nach Douala [Yvonne] ab – ganz zu schweigen von Stockholm [Anita]. Vielleicht ist die niederländische Witwe die Lösung!« Da er noch mit Vivien verheiratet ist, gibt es zu diesem Zeitpunkt fünf Frauen in seinem Leben (während er an Ein ausgebrannter Fall arbeitet). Einen Monat später reist er mit einem Freund, Michael Meyer, durch den Pazifik. Die These eines vorherigen Biographen, Michael Shelden, dass Greene gelegentlich der Homosexualität zuneigte, verwirft Sherry. Er vertritt die Ansicht, dass Greene verheiratete Frauen aus dem Grund bevorzugte, dass sie so wenig von ihm verlangten. »Verheiratete Frauen sind die unkompliziertesten«, sagt Querry in Das Herz aller Dinge. Mein eigenes Gefühl dazu ist, dass es eine ambivalent homoerotische Komponente hat, wenn ein Mann eine längere Affäre mit einer verheirateten Frau hat, die weiterhin zu Hause mit ihrem Mann lebt und mit ihm schläft. So machte es Greene oft. Und dann gibt es die verdrehte Logik, dass Greene seiner Geliebten Treue schwört, während er seine Frau betrügt und natürlich auch noch zu Nutten geht, für die er eine heillose Vorliebe hatte.
»Ich habe noch nie verstanden, was daran attraktiv sein soll, zu einer Prostituierten zu gehen«, hat Michael Meyer mit spöttischer Missbilligung gesagt. »Für mich ist das so, als zahle man jemandem Geld dafür, dass er einen beim Tennis gewinnen lässt.«
Das ist zwar witzig, trifft es aber nicht, da Greene kein Casanova war, sich nichts auf seine Eroberungen einbildete und über sie auch nicht Buch führte (wenngleich er eine detaillierte Liste seiner 47 Lieblingsprostituierten führte, die Sherry im Anhang abdruckt). Greene war unsicher, bedürftig, unersättlich, an Abwechslung interessiert und immer bereit für einen Anmachversuch. Er bevorzugte schlanke Frauen, knabenhafte, zierliche – er selbst war 1,93 Meter groß. Die Frauen in seinen Romanen entsprechen häufig diesem Schema, sind aber natürlich realen Frauen nachempfunden, die er geliebt hatte.
»Er hat eine entschiedene Vorliebe für Bordelle«, bemerkte eine Freundin. Sherry scheut sich nicht, zu belegen, dass dem so war. Schon ganz am Anfang, im ersten Band, wird Otto Preminger mit den Worten zitiert: »Wenngleich er auf den ersten Eindruck beherrscht, korrekt und britisch wirkt, ist er in Wirklichkeit verrückt nach Frauen. Er denkt pausenlos an Sex.«
Na und?, könnte man einwenden. Aber diese zwanghafte Sexualität scheint sein Leben geprägt zu haben, seine Reisen, die Themen seiner Bücher und seinen Glauben. Obsessiv und schnell gelangweilt, war er unfähig, einer Frau sexuell treu zu sein. Er genoss es, ein Streuner, ein Horchender, ein Fremder zu sein. Seine Sexualität belastete ihn und linderte zugleich seine Schwermut. Sie war, seinem Glauben gemäß, seine Verdammnis, machte ihn zu einem Sünder und erfüllte ihn mit Reue, die sich in Sätzen äußerte wie »Ich war so ein verdammter Idiot« und »Ich habe sehr viele Menschen in meinem Leben betrogen« und »Ich wünschte, ich hätte nicht so viel zu bereuen«.
Er konvertierte zum Katholizismus, um Vivien für sich zu gewinnen, und es scheint, als sei er Katholik geblieben, weil er glaubte, so seine sexuelle Gier besser kontrollieren zu können. Alles, was sein Glauben vermochte, war jedoch, dass er sich noch schuldiger fühlte und sich krampfhaft bemühte, ihn mit den eigenen Sünden zu versöhnen, aber immerhin konnte er als Gläubiger Absolution und heiligmachende Gnade erlangen. In Das Herz aller Dinge, Die Kraft und die Herrlichkeit, Das Ende einer Affäre und vielen anderen Büchern rang er damit, Sünder als letztlich tugendhaft darzustellen. Der Satz von Charles Péguy, »Le pécheur est au cœur même de chrétienté« (Der Sünder lebt mitten im Herzen der Christenheit), ist dem Herz aller Dinge als Motto vorangestellt. Das Problem quälte Greene bis an sein Lebensende und ließ ihn zu einem Moralisten werden.
Während einfach »schlecht« zu sein auch etwas Langweiliges hat, und der Akt des Fehlermachens eine irritierende Banalität, lässt sich mit den Wörtern »sündigen« und »böse« großes Drama produzieren. Greene schwelgte darin, indem er sein Handeln mit diesen Begriffen beschrieb. »Richtig« und »falsch« interessierte ihn nicht sonderlich, »gut« und »böse« hingegen sehr. Er hatte eine Schwäche für das Teuflische. Orwell sagte einmal, dass Greene offenbar der Idee anhänge, »die seit Baudelaire im Schwange ist, dass es etwas durchaus Distinguiertes hat, verdammt zu sein«.
Im dritten Band reist Greene nach Haiti. Haiti vereinte so ziemlich alles, was er sich von einem Reiseziel wünschte, insbesondere von einem, das Schauplatz eines Romans werden sollte. Es war verarmt, tropisch, marode und stand am Rande eines Bürgerkriegs. Es wurde von einem Kobold regiert. Es war berühmt für seine Bordelle, seine Slums und seine merkwürdigen Ausdrucksformen des Glaubens – der sich aus Katholizismus und einem Mischmasch afrikanischer Rituale zusammensetzte. Haitis Frauen, insbesondere die Prostituierten, wurden für ihre Schönheit gerühmt. Die reich ausgeschmückten Hotels verfielen, aber es war genug Alkohol verfügbar, dass Gäste sich ordentlich betrinken konnten. Die einzigen Expatriates waren windige Geschäftsmänner und ausländische Diplomaten, mit der entsprechenden Zahl gelangweilter Ehefrauen. Jetzt füge man noch Voodoo hinzu, politische Tyrannei, Rum Punch und Sonne, und das Ergebnis ist die bunte Horror-Show, der wir in Die Stunde der Komödianten begegnen.
Das Reisen, der Sex, das Schreiben, die Liebschaften waren – so legt es Norman Sherry nahe – alles Versuche Greenes, seine Depression zu lindern. Er war ein echter Melancholiker. Sieben Mal hat er versucht, sich umzubringen, und sprach oft davon, sein Leben zu beenden. Sein misstrauisches Wesen hielt ihn davor zurück, seine Schwermut irgendjemandem zu offenbaren, außer Catherine Walston, die in der Lage war, ihn aufzuheitern. Sie war es, die sagte: »Grahams Leid ist so echt wie eine Krankheit.« Ein anderer Freund sagte, dass Greene »nur glücklich war, wenn er unglücklich war«. Greene schuf als Romancier Hauptfiguren, die berühmt waren für ihre düstere Stimmung, und auch als Reisender war Greene kein heiterer Mensch. Über Mexiko und die Mexikaner schrieb er in Gesetzlose Straßen: »Ich hasse dieses Land und diese Menschen.«
Geld beschäftigte ihn sehr. Die Suche nach finanziellen Mitteln ist ein mitlaufendes Thema in allen drei Bänden, da er bis zu seinem Lebensende seiner Frau Geld schickte und seine Kinder noch finanziell unterstützte, als sie schon lange erwachsen waren. Greene war für seine Zeit ein ungewöhnlicher britischer Schriftsteller, insofern er eine ganze Reihe verschiedener Vollzeitstellen innehatte: mindestens vier Redakteursstellen bei Zeitungen und Zeitschriften, eine regelmäßige Tätigkeit als Filmkritiker (worin er brillant war, was man in The Pleasure-Dome: The Collected Film Criticism nachlesen kann), und zwei wichtige und aktiv ausgefüllte Positionen bei Londoner Verlagshäusern. Band drei beschreibt seine Arbeit als Dramatiker, seinen großen Erfolg (Das Geheimnis) und letztendliches Scheitern (Das Ebenbild) sowie seine Arbeit als Drehbuchautor, und neben Unser Mann in Havanna und Die Stunde der Komödianten geht es dabei auch um Angebote aus Hollywood, zum Beispiel als bei ihm vorgefühlt wurde, ob er bei Ben Hur mitarbeiten würde (»Ich wäre bereit zu helfen, falls es viel Geld gibt & mein Name nicht erwähnt wird«). In seinen frühen Sechzigern fand er heraus, dass sein Buchhalter ein Betrüger war und ihn um viel Geld gebracht hatte. Mit der Aussicht auf den finanziellen Ruin zog Greene aus Steuergründen nach Frankreich und wurde dort durch die Arbeit als Drehbuchschreiber wieder zahlungsfähig. Seine berühmten Reisen nach Panama, wo er in die Wirren um den Panamakanal verwickelt wurde, wurden von General Torrijos bezahlt, der ihm auch die Flugtickets schickte. Bei seinem Tod ging sein gesamtes Geld (kein allzu großes Vermögen) an seine Frau, mit der er seit vierzig Jahren nicht zusammengelebt hatte.
In den meisten Biographien von Literaten gibt es ein einfaches Detail, das für den dargestellten Charakter besonders aufschlussreich ist. Thoreau verließ nie das Haus, Henry Miller stand unter der Fuchtel von Frauen, Borges lebte in ständiger Angst vor seiner Mutter, James Joyce hatte Angst vor Gewittern, Freud hatte Angst auf Bahnsteigen, Wittgenstein war süchtig nach Cowboy-Filmen, Wallace Stevens nach Süßigkeiten, Nabokov war nie in Moskau, Jack Kerouac hatte Stapel der National Review neben seinem Bett, als er starb.
Es finden sich viele ähnlich merkwürdige Details in dieser Greene-Biographie. Greenes Abneigung gegen Kinder ist wenig überraschend; sie ist typisch für viele Autoren von Kinderbüchern (Greene hat drei geschrieben). Er hatte auch eine Abneigung gegen Adverbien, wenngleich man welche in seinen Büchern finden kann. Es scheint so, als habe er nie eine Pistole abgefeuert, auch wenn seine Bücher voll sind von Schießereien. Umgeben von der großartigen Küche der Provence, klagte er darüber, wie sehr er englische Würstchen vermisse.
Ein weniger häuslicher Mann als er lässt sich kaum denken. Nachdem er 1939 den ehelichen Haushalt verlassen hatte, lebte er nie wieder mit einer Frau zusammen – und er starb 1991. Seine letzte Liebhaberin, Yvonne Cloetta, besuchte ihn in seiner Wohnung in Antibes, kochte ihm Abendessen, munterte ihn auf und ging dann nach Hause zu ihrem Mann. Greene konnte nicht kochen, war unfähig, eine Schreibmaschine zu bedienen und einen Besen zu benutzen; er war ein von Natur aus von anderen abhängiger, wenn nicht gar hilfloser Mann. Hinzu kommt die erstaunliche Tatsache, dass er, obwohl ein Reisender, ein Gefahrensucher, ein zutiefst neugieriger Streuner, der selten zu Hause war, nicht Auto fahren konnte. Dass er Liebhaberinnen brauchte, ist nicht allzu schwer zu verstehen. Verblüffend ist aber die Vorstellung, wie verloren er ohne jemanden war, der ihn fuhr, für ihn kochte, putzte, tippte; er brauchte sein Leben lang immer jemanden, der sich um ihn kümmerte. Wen wundert es da, dass viele der Tausenden von (handgeschriebenen) Briefen, die Sherry in das Buch aufgenommen hat, den Tonfall eines verlorenen Jungen haben?
Ich habe Greene gekannt, wenn auch nicht den komplexen Greene aus Sherrys Biographie. Wie Sherry schreibt, kannte niemand diesen Mann. Er war zu mir und anderen Schriftstellern sehr großzügig. Ein Name, der im Buch nicht vorkommt, ist der von Etienne Leroux, einem südafrikanischen Schriftsteller (der auf Afrikaans schrieb), für dessen hervorragende Romane (Sewe dae by die Silbersteins und andere) Greene sich einsetzte. Und wenn ich mich unterschätzt, ungelesen oder missverstanden fühle, denke ich an eine Geschichte (nicht in der Biographie), die Greene mir einmal erzählt hat, über einen Abend, den er in Paris mit ein paar Filmleuten verbrachte. Ein berühmter französischer Regisseur und Bewunderer Greenes schwärmte von dessen epischem Marsch durch den Busch Liberias, der in Reise ohne Landkarten (1936) beschrieben wird. Er sagte: »Das ist Graham Greene. Er ist durch Westafrika gereist!« Die Schauspielerin neben ihm sagte darauf: »Wie haben Sie das gemacht?«, und reckte dann ihren Daumen hoch. »Autostop?«