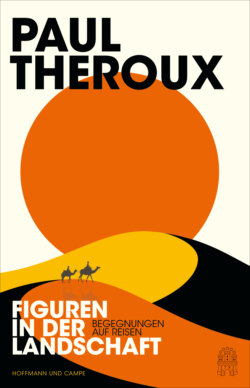Читать книгу Figuren in der Landschaft - Paul Theroux - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Thoreau in der Wildnis
ОглавлениеHenry David Thoreau war emotional so stark mit seinem Haus in Concord verbunden, dass ihm das Weggehen stets schwerfiel. Nach 1837 verließ er es tatsächlich nur noch für kurze Zeit: für eine dreizehntägige Reise auf dem Concord und dem Merrimack River, für einige Besuche auf Cape Cod, drei Wanderungen in die Wälder von Maine und für kurze Aufenthalte auf Staten Island und in Minnesota. Bei diesen Reisen war er nie allein unterwegs, sondern hatte stets einen Freund oder Verwandten dabei. Er war einer der Ersten, die den Mount Katahdin bestiegen, was aber eine wagemutige Ausnahme darstellt, und wahrscheinlich schaffte er es auch nicht auf den höchsten Gipfel. Die Kanutour über 325 Meilen, über die er in »The Allagash and East Branch« in The Maine Woods schreibt, war seine ehrgeizigste Reise – und tatsächlich eine ziemlich anspruchsvolle –, aber das Buch zeigt auch, dass Thoreau bei aller Begeisterung für die Wildnis in der Tiefe der Wälder gelegentlich hilflos und verloren war. Die Erfahrung führte zur Überzeugung, dass er dort niemals allein leben könnte.
Die Wälder von Maine waren Wildnis, Thoreau betont jedoch ihre Nähe zur Zivilisation: Sie seien nur wenige Stunden vom gut erreichbaren Bangor entfernt. Der Walden Pond lag nur einen angenehmen Fußmarsch von seinem Elternhaus entfernt, in dem er fast sein ganzes Leben verbrachte. Dass er während seines berühmten Experiments in der Blockhütte am Walden Pond, beim Philosophieren über die Einsamkeit, seiner Mutter die schmutzige Wäsche brachte und weiterhin ihren Apfelkuchen genoss, verschwieg er. Sein Freund William Ellery Channing schrieb, dass Thoreau, als seine Mutter nach seinem Abschluss am Harvard College und der Rückkehr nach Concord das Thema des Auszugs aus dem Elternhaus aufbrachte, weinerlich reagierte – und dort wohnen blieb.
Sein Freund und literarischer Mentor Ralph Waldo Emerson ging auf der Suche nach neuen Eindrücken nach England, und auch andere Schriftsteller seiner Zeit reisten um die halbe Welt – Nathaniel Hawthorne nach England, Washington Irving nach Spanien, Melville in den Pazifik –, doch Thoreau ließ sich davon nicht beirren. Auf die Berichte von diesen Reisen reagierte er abwehrend, manchmal auch abschätzig. Er war ein Widerspruchsgeist aus Überzeugung. Er kultivierte seine Eigenwilligkeit und stilisierte sie in seinen Schriften, dabei war seine Persönlichkeit noch weit merkwürdiger, als ihm bewusst war.
Seine typische Reaktion auf die Reisen seiner Freunde in aller Welt findet man in einem Brief an seine Mutter: »Das Leben, das wir leben, ist ein seltsamer Traum, und ich vertraue überhaupt keiner Rechenschaft, die Menschen von ihm ablegen. Ich glaube, ich würde zufrieden sein, wenn ich an der Hintertür in Concord unter dem Pappelbaum sitzen könnte, von nun an für immer.« Das klingt vielleicht nicht wesentlich anders als Dorothys Epiphanie am Schluss von Der Zauberer von Oz: »Und wenn ich je wieder die Wünsche meines Herzens suchen sollte, dann werd’ ich nicht weiter streifen dafür als in unseren eigenen Garten«, doch ist Geringschätzung bei Thoreau oft ein Paradox. Aber warum auch Concord verlassen, wenn es dort so ist wie in einem Gedicht von ihm beschrieben:
Our village shows a rural Venice,
Its broad lagoons where yonder fen is;
As lovely as the Bay of Naples
Yon placid cove amid the maples;
And in my neighbor’s field of corn
I recognize the Golden Horn.
Unser Dorf ist ein ländliches Venedig
Mit seinen breiten Lagunen dort hinten im Moor;
Lieblich wie die Bucht von Neapel
Jene beschauliche Wölbung im Ahorn;
Und in des Nachbarn Getreidefeld
Sehe ich das Goldene Horn.
Man ist diese Pose von Thoreau gewohnt, die liebenswerte, aber mitunter auch unerträgliche Stubenhockersturheit des amerikanischen Welterklärers vom Land, der noch nie in Venedig, Neapel oder der Türkei war und auch nicht vorhat, je dorthin zu reisen.
Dass sein Dorf eine Ausnahme gebildet haben soll, ist äußerst fragwürdig, und dass er darauf bestand, nur dort zu leben und fremde Länder selten erwähnt, außer um sie herabzusetzen, stimmt skeptisch. Der dieser Haltung innewohnende Provinzialismus, den Henry James so harsch kritisierte, steht zugleich im Zentrum von Thoreaus Wunsch, über die Wildnis Maines zu schreiben. Er wollte sie unheimlich finden und von Vergangenheit erfüllt und wild genug, um berichten zu können, dass sie nie zuvor von einem Weißen erblickt wurde – eine Behauptung, die wörtlich so im Bericht über die erste Reise zu finden ist.
Thoreau war mit Leib und Seele Amerikaner, ganz im Sinne des Nonkonformisten Emerson. Seine Leidenschaft galt dem Lokalen, und das bedeutete für ihn, in Amerika zu reisen – nicht zuletzt, um den Menschen zu zeigen, wie man das tat. Er wollte ihnen vormachen, wie man mit dem Land umzugehen habe, wie man über es sprechen solle, in welchem Ton, welche Themen zur Sprache kommen sollten. Dieses Projekt verfolgte er sein Leben lang und wurde so zum ersten und tiefsinnigsten amerikanischen Umweltschützer. Seine Themen in Maine waren, wie er selbst einmal notiert: »Der Elch, die Kiefer & der Indianer.« Seine letzten Worte auf dem Sterbebett waren angeblich: »Elch … Indianer.«
Thoreaus drei Reisen nach Maine in den Jahren von 1846 bis 1857 fallen in denselben Zeitraum wie die Veröffentlichung von Melvilles größten Werken. Es gibt keinen Beleg dafür, dass Thoreau Moby Dick gelesen hat, allerdings finden sich viele Hinweise auf Typee, Melvilles Debütroman, der in der Zeit erschien, als Thoreau zum ersten Mal in Maine war, und über den er in einer frühen und später wieder verworfenen Fassung von Ktaadn schreibt. Beim Vergleich der Formen von Wildnis gibt sich Thoreau kämpferisch und argumentiert, er habe in Maine eine tiefere Wildnis kennengelernt als Melville auf den abgelegenen Vulkaninseln der Marquesas, bei der lieblichen Fayaway und den kannibalischen Inselbewohnern. Klingt etwas weit hergeholt, aber so denkt er.
Neben anderem waren Thoreaus Reisen in die Wälder von Maine die bewusste Suche nach den Indianern als einem amerikanischen Ideal, ähnlich der seines Zeitgenossen George Catlin. Er war ein früher und vorurteilsloser Chronist der indianischen Ureinwohner und porträtierte sie ebenso hervorragend mit Worten wie Catlin mit dem Pinsel. Catlin bereiste jedoch den Westen; den Glanz und Federschmuck und die Würde der von ihm dargestellten Indianer bekam Thoreau nie zu Gesicht. Eine der lyrischeren und mystischeren Beschreibungen eines Indianers am Schluss von Ktaadn endet mit dem Satz: »Er gleitet den Millinocket hinauf und verschwindet aus meinem Blick, während eine weiter entfernte und neblige Wolke auftaucht, die hinter einer näher gelegenen vorbeiwandert und sich im All verliert. So stellt es sich seinem Schicksal, das rote Antlitz des Menschen.«
Thoreaus längsten Reisen fern der Heimat – zwei von Krankheit überschattete Monate in Minnesota, sechs Monate mit Heimweh auf Staten Island – muss man die Leistungen anderer heldenhafter Reisender seiner Zeit entgegenhalten: Sir Richard Burton in Arabien und Afrika, Sir John Franklin in der Arktis, Sir Joseph Hooker in Tibet, Henry Walter Bates am Amazonas, Charles Darwin auf den Galapagosinseln, Alfred Russel Wallace in Fernost. Ihre Namen seien hier nur erwähnt, weil Thoreau als begeisterter Leser von Reiseberichten – seinem literarischen Lieblingsgenre – fast alle ihre Bücher las. Er war fasziniert von Burton, wie er als Araber verkleidet die heiligen Städte Mekka und Medina besuchte, und als Schriftsteller und Denker war er tief beeinflusst von Darwins Fahrt der Beagle und Über den Ursprung der Arten.
Thoreaus abschätziges Bonmot, dass es sich nicht lohne, »rund um die Welt zu fahren, um die Katzen von Sansibar zu zählen«, ist weithin bekannt, Bücher über Reisen durch Afrika interessierten ihn aber durchaus. Eine weitere Passion von ihm waren Reisebücher über die Arktis, aus denen er auch lernte, wie man das Zufrieren des Walden Pond und das Schmelzen des Eises beschreibt. Auch den Bericht über die Expedition von Lewis und Clark, der 1814 erschien, hatte er gelesen, und er verfolgte aufmerksam, auf eine fast eifersüchtige Art, die ambitionierten Unternehmungen seiner Zeitgenossen zur Erforschung Amerikas. Etwa zur gleichen Zeit, als Thoreau durch die Wälder von Maine wanderte und paddelte, erkundeten John Frémont und Kit Carson die Rocky Mountains.
Als Leser und auch bei seinen eigenen Reisen beharrte Thoreau in seiner Besessenheit von der Vorstellung eines unberührten Amerika und auf der Suche nach dem Urwald darauf, dass Maine wilder sei als weiter entfernte Teile des Landes. Über die Holzmetropole Bangor schreibt er mit einem schönen Bild, sie liege »wie ein Stern am Rande der Nacht und zehrt immer noch von den Wäldern, aus denen sie gebaut wurde«. Was die Wildnis betrifft, so schreibt er, dass »der Neugierige« bereits »nach wenigen Stunden Reise« Richtung Nordosten »an den Rand eines Urwaldes gelangen« wird, »und das wäre vielleicht trotzdem interessanter, als wenn er tausend Meilen nach Westen ginge«. Tausend Meilen nach Westen hätten ihn nach Columbus, Ohio, geführt.
Thoreau suchte beim Reisen Informationen und Erfahrungen, aber ebenso suchte er Metaphern und, mehr noch als alles andere, nach einer narrativen Struktur. Er reiste, wie A Week on the Concord and Merrimack Rivers zeigt, um mit dem Reisebericht einen Rahmen zu haben, den er dann mit Weisheiten, Einsichten, Aperçus, Gedichten (seinen eigenen und denen anderer) füllen und für Abschweifungen nutzen konnte, die schon aufgrund ihrer Länge eigenständige Essays sind. Die Idee des Buches war zunächst die Erzählung einer zweiwöchigen Bootstour. Es wurde aber etwas völlig anderes und lässt sich auch kaum der gewöhnlichen Reiseliteratur zuordnen. Die Einträge zu den einzelnen Tagen werden zu langen Kapiteln mit philosophischen Reflexionen und naturkundlichen Ausführungen, voller flotter Sticheleien gegen das Christentum und Spott für organisierte Religionen – wobei es genau dieser obsessive Säkularismus war, der verhinderte, dass das Buch zu seiner Zeit ein größeres Publikum fand. Einer der besten Essays, über die Freundschaft, wurde erst später eingefügt. Das Buch ist voller solcher späteren Ergänzungen, auch Walden durchlief sieben verschiedene handschriftliche Fassungen.
Bei einer solchen Überarbeitungswut und Freude an erzählerischen Erweiterungen, am Sinneswandel, an Umstellungen und Neufassungen verwundert es kaum, dass Thoreau zu Lebzeiten nur zwei Bücher veröffentlichte, wenngleich er Pläne für mehrere weitere hatte. Dazu gehörte The Maine Woods, ebenso Cape Cod, und er sprach von einem Buch über Indianer. Man darf aber nicht vergessen, dass The Maine Woods, posthum veröffentlicht, trotz aller Zusammenhänge eine Zusammenstellung von drei Erzählungen in ganz verschiedenen Stadien der Vollendung ist; kein einheitliches Werk, sondern eher eine Torte mit drei ganz unterschiedlichen Schichten aus Reisen in die Wälder. Als Protokoll von Eindrücken, als Work in Progress, wird das Buch dadurch umso interessanter. »Ktaadn« ist ein geschliffener jugendlicher Text, »Chesuncook« vollendet und reif und »The Allegash and East Branch« zwar in der vorliegenden Form unfertig, aber ein Schatz an Informationen und Wissen.
Das gesamte Buch ist voller Wiederholungen, Widersprüche und nur lose organisiertem Material. Ein triviales Beispiel: Auf den ersten Seiten von »Ktaadn« kommt der Name Sunkhaze vor, ein kleiner Bach in der Nähe von Oldtown. »Wir überquerten den Sunkhaze, ein sommerlicher indianischer Name.« Doch fast dreihundert Seiten später fragt Thoreau Joe Polis nach der Bedeutung des Namens, worauf dieser auf seine typische (und wenig sommerliche) indirekte Art antwortet: »Wenn man den Penobscot hinunterfährt, so wie wir, und man ein Kanu aus dem Ufer heraus vor sich hereinfahren sieht, ohne zu sehen Fluss – das ist Sunkhaze.«
Mir scheint es meine Pflicht, den ahnungslosen Leser, der The Maine Woods zum ersten Mal in die Hand nimmt, davor zu warnen, dass jede der Erzählungen ausgesprochen prosaisch, fast abschreckend anfängt, mit dem Datum der Abreise und dem Runterrasseln schmuckloser Informationen im trockenen, langwierigen Stil des Fahrtenbuchs eines Handlungsreisenden. Jeder der Abschnitte beginnt so, aber immer wenn er die Häuser hinter sich gelassen hat und endlich im Wald ist, kommt Thoreau in Fahrt. Er ist ein unermüdlicher Beobachter, macht auch nachts noch Notizen, gleich einem »Spion im Lager«, wie er über sich selbst sagt. Jeder, der Thoreau liest, wird unweigerlich bedauern, dass der Autor den amerikanischen Kontinent nicht irgendwann mal verlassen hat und ins Ausland gereist ist, denn er war einer der sensibelsten und gewissenhaftesten Beobachter von Natur und Mensch, den die Literaturgeschichte kennt.
In »Ktaadn« schreibt er an einer Stelle über das Wesen der Wildnis. »Es ist schwierig, sich ein Gebiet vorzustellen, das nicht von Menschen besiedelt ist«, beginnt er bescheiden. Dann schlägt er zu: »Hier war Natur etwas Wildes und Schreckliches, trotzdem Schönes. Ehrfürchtig betrachtete ich den Boden zu meinen Füßen, um zu sehen, was die Gewalten dort geschaffen hatten, die Form und Fasson und den Stoff ihres Werks. Dies war jene Erde, von der wir gehört haben, aus Chaos und alter Nacht entstanden. Hier war keines Menschen Garten, sondern die unverbrauchte Erde. Es war kein Rasen, keine Weide, keine Wiese, kein Waldland, keine Aue, kein Ackerland, kein Ödland. Es war die frische und natürliche Oberfläche des Planeten Erde, wie sie für immer und alle Zeit geschaffen wurde […].«
Was für eine wunderbare Stelle. Man mag sich fragen, was Thoreau eigentlich den ganzen Tag lang machte in seiner Blockhütte am Ufer des Walden Pond, zwei Jahre lang. Eine Antwort ist: Sätze wie diese schreiben, denn als er dort lebte, arbeitete er seine erste Maine-Reise zu einem Artikel aus, der ihm als Grundlage für öffentliche Vorträge dienen sollte. Thoreau war damals siebenundzwanzig und sein lyrischer Stil auf dem Höhepunkt, mit einer Vorliebe für schillernd beschriebene Szenen und die Beobachtung winzigster Details, die er bei seiner Darwinlektüre gelernt hatte. Sieben Jahre später ging er wieder nach Maine. Er verstand sich auch da noch als Dichter, sein Stil war immer noch lyrisch, zugleich aber erfreulich präzise. Man denke an eine Beschreibung wie die in »Chesuncook«, wo sein Führer, der Indianer Joe Aitteon, auf einen Elch schießt und ihn verwundet. Der Elch flieht, und Aitteon verfolgt ihn. Thoreau beobachtet alles detailliert: »Er lief schnell das Flussufer hinauf in den Wald, mit einem eigentümlichen, federnden, geräuschlosen und schleichenden Schritt, schaute nach rechts und links auf den Boden und lief in der nur schwach erkennbaren Spur des verwundeten Elchs, deutete hin und wieder schweigend auf Blutstropfen auf den wunderschön leuchtenden Blättern der Clintonia borealis, die ringsum den Boden bedeckten, oder auf einen frisch abgeknickten trockenen Farnstengel, und kaute dabei die ganze Zeit irgendein Blatt oder auf Harz herum.«
In einer anderen Passage in »Chesuncook«, die zu Recht für ihre Schönheit und Präzision gerühmt wird, beschreibt Thoreau das Umstürzen eines Baumes in der Ferne: »Einmal, als Joe wieder seinen Ruf ertönen ließ und wir nach Elchen lauschten, vernahmen wir ein schwaches Echo oder ein dumpfes, trockenes Rascheln, das durch die moosbedeckten Korridore zu uns drang, mit einem soliden Kern, jedoch wie halb erstickt durch den üppigen und schwammartig wuchernden Wald, wie das Schließen einer Tür am fernen Zugang zu einer feuchten, struppigen Wildnis. Wären wir nicht da gewesen, kein Sterblicher hätte es je gehört. Als ich Joe flüsternd fragte, was das für ein Geräusch gewesen sei, antwortete er: ›Baum fällt.‹«
Seine letzte Reise in die Wälder von Maine unternahm Thoreau im Jahr 1857. Da war er vierzig, und man erkennt an seinem Stil, dass er ein anderer Reisender geworden ist: bescheidener und betroffener von den Veränderungen, die er seit seiner ersten Expedition elf Jahre zuvor bemerkt. Er zitiert nicht mehr Milton, singt nicht mehr das Loblied der Holzfäller und verklärt auch nicht mehr die mystische Figur des Indianers. Als weitsichtiger Chronist verurteilt er nun die Holzfällerindustrie. Thoreau war stets fasziniert von den amerikanischen Ureinwohnern, und seine dritte Reise nach Maine bot ihm reichlich Gelegenheit, jene zu studieren. Durch seinen Führer Joe Polis konnte Thoreau die Lebensweise und Gewohnheiten eines Penobscot-Indianers, der noch an einigen Traditionen seines Volkes festhielt, aus erster Hand dokumentieren.
Bereits bei seiner ersten Expedition hatte er nach Indianern als Begleiter gesucht, aber keinen geeigneten gefunden. In »Ktaad« leben sie in »schäbigen, elenden und freudlosen« Behausungen, wo er einen »zerlumpten Indianer, der einer Wäscherin ähnelte«, sieht; ein anderer, dem er begegnet, wird als »robuster, aber schwerfällig und schmierig aussehender Kerl« beschrieben. Sie wirken »kummervoll«, sind Säufer und vor allem sind sie Christen. Als er in Oldtown eine »schmucke« katholische Kirche sieht, bemerkt Thoreau (der junge, spöttische Reisende mit seinem Widerspruchsgeist und hyperbolischen Stil): »Ich dachte sogar, eine Reihe Wigwams mit Powwow-Tanz und einem Gefangenen, der am Marterpfahl gefoltert wird, wäre achtbarer.«
Die Indianer in »Ktaadn« werden nur aus der Ferne beobachtet und mit der für Thoreau typischen Forschheit und Überheblichkeit beurteilt, er hat auch keinen Indianer als Begleiter. Louis Neptune, ein möglicher Führer, hält die getroffene Vereinbarung nicht ein. In »Chesuncook« ist Thoreau vorsichtig geworden und sieht bei Joe Aitteon genauer hin. Aitteon ist der »Sohn eines Gouverneurs« (eines sogenannten »tribal governor«), vierundzwanzig Jahre alt, »gutaussehend«, »klein und stämmig«, mit »schmalen Augen« und solider Kleidung. Nach diesen gewöhnlichen Details folgt die Bemerkung: »Als er danach die Gelegenheit hatte, seine Schuhe und Strümpfe auszuziehen, war ich beeindruckt, wie klein seine Füße waren.« Was Joe Aitteon dem Leser sofort zarter und interessanter erscheinen lässt.
»Ich beobachtete seine Bewegungen genau und hörte aufmerksam zu, wenn er sprach, da wir ihn als Indianer ja hauptsächlich aus dem Grund angestellt hatten, dass ich seine Lebensweise und sein Verhalten aus der Nähe studieren konnte.« Was Thoreau auffällt, ist, dass Aitteon einen eigenartigen Gang hat, ein großartiger Spurenleser ist, dass er »Oh Susanna« pfeift und »Yes, Sir-ih« sagt und »Bei George!«. Außerdem muss er erfahren, dass Joe – »obwohl der Sohn eines Gouverneurs« – Analphabet ist und wenig über die Geschichte seines Volkes weiß.
Thoreaus eigene Einfältigkeit als Reisender unter den Ureinwohnern wird offenkundig, wenn er sein Befremden über Joe Aitteons scheinbar dürftige Vorstellung von Entfernungen äußert. Im unwegsamen Gelände von Volkskulturen sind Meilen keine brauchbare Einheit; was zählt, ist die tatsächliche Dauer des Weges. Darin besteht der Hauptunterschied eines Menschen mit Landkarte (Thoreau) und einem mit gründlicher Kenntnis der Gegend (Aitteon), da Aitteon zwar sagen konnte, »wann wir da sein würden, aber nicht, wie weit es war«.
Thoreaus Beobachtung, dass Aitteon Schwierigkeiten im Umgang mit abstrakten Vorstellungen hat – vermutlich dazu noch in englischer Sprache –, findet ihr Gegenstück in seinem Gefühl eines Nachts, dass er, als er Aitteon in seiner Muttersprache Abenaki sprechen hörte, »dem primitiven Bewohner Amerikas so nahe wie die ersten Entdecker« kam. Diesen Crusoe-Moment empfand er als einen seiner großen Triumphe als Reisender in den Wäldern von Maine.
Es ist offensichtlich, dass Joe Aitteon nicht dem Urbild eines Indianers entsprach, das Thoreau suchte. Aitteon war vor allem zu vertraut mit der Welt der Weißen. Das »Oh Susanna« und die aufgeschnappten Phrasen empfand Thoreau als Beleidigung seines feingestimmten Ohrs. Bei der dritten Reise fand Thoreau schließlich den Mann, den er suchte. Ja, Joe Polis war zwar Christ und weigerte sich daher auch, sonntags zu arbeiten; er mochte Süßigkeiten; und er war schon mal in Washington, D.C., und New York City gewesen. Er war Persönlichkeiten wie Daniel Webster begegnet (von dem er bei seinem Besuch abgewiesen wurde). Aber zugleich ist er auch sachkundiger als Aitteon, beherrscht das Leben im Wald und ist ein meisterhafter Kenner der Topographie der Wildnis, und er kennt die Namen von Pflanzen, Bäumen, Landschaftsmerkmalen – und gibt dieses Wissen an Thoreau weiter. Wie andere Indianer benutzt er häufig seine Zähne (»wo wir eine Hand benutzt hätten«). Joe Polis ist von vornehmer Herkunft, Thoreau bekommt mit, dass er »dem Adel angehöre«. Er ist schlau, geheimnisvoll und spricht gerne in rätselhaften Weisheiten. Von Thoreau danach gefragt, wie er durch den weglosen Wald nach Hause finde, lacht Polis nur. »Großer Unterschied zwischen mir und weißen Mann.« Später, als sie ein Kanu reparieren, vertraut Polis ihm an, »es gebe ein paar Dinge, die ein Mann nicht einmal seiner Frau verrät«.
Eine der einfühlsamsten Beschreibungen von Joe Polis findet sich weit hinten in »The Allegash«, wo Thoreau in einfachen Worten die Erzählung des Indianers wiedergibt, wie er als zehnjähriger Junge auf dem Weg durch die winterlichen Wälder einmal fast verhungert wäre. So bewundernswert der Indianer ihm für seine Tapferkeit erscheint, beeindruckt Thoreau am stärksten seine Selbstbeherrschung und die Einfachheit seiner Lebensweise. Seine Art, sich zu kleiden und zu reisen, verkörpert das Ideal Thoreaus: »Ich bemerkte, dass er ein Baumwollhemd trug, das ursprünglich weiß gewesen war, darüber ein grünliches Flanellhemd, aber keine Weste, außerdem Flanellunterhosen und feste Leinen- oder Segeltuchhosen, die auch einmal weiß gewesen waren, blaue Wollsocken, Stiefel aus Rindsleder und einen Filzhut oder ›Kossuth‹. Er hatte keine Kleidung zum Wechseln dabei, sondern trug nur eine feste, dicke Jacke, die er im Kanu beiseitelegte. Er schnappte eine große Axt, sein Gewehr und Munition, eine Decke, die man, wenn man wollte, als Segel oder Rucksack verwenden konnte, legte seinen Gürtel um, an dem ein großes Messer in der Scheide steckte, und marschierte einfach los, um den ganzen Sommer lang fortzubleiben.«
Das Porträt von Joe Polis zeichnet das Bild eines Mannes, der so zeitlos erscheint wie die Bäume und Felsen. »Vom Indianer kann ich noch viel lernen, vom Missionar nichts«, schreibt Thoreau, als er über seinen Führer nachsinnt. Seine Methode dafür sieht so aus, dass er »ihm auf dieser Reise alles beibringen wolle, was ich weiß, und er solle mich sein ganzes Wissen lehren«. Die Erfahrungen in den Wäldern von Maine lassen Thoreau demütiger werden. Wo er vorher die Welt erklärte, ist er jetzt Schüler. Bereits in »Chesuncook« sieht er einem Indianer beim Bau eines Kanus zu und schreibt: »Ich notierte gewissenhaft, wie ein Kanu gebaut wird, und dachte mir, dass ich gerne eine Zeit als Lehrling diesen Beruf erlernen würde und mit meinem ›Meister‹ in die Wälder gehen, um dort die Rinde zu besorgen, das Kanu zu bauen und in ihm schließlich zurückzukehren.«
Auch als Joe Polis ihm beibringt, wie man unterschiedliche Vogelstimmen erkennt, wünscht sich Thoreau, von ihm unterrichtet zu werden. »Ich merkte an, dass ich bei ihm gern Schüler sein und seine Sprache lernen wolle, während ich eine Zeit lang auf der Indianerinsel leben würde.« Polis brachte Thoreau so viele Abenaki-Wörter bei, dass in den meisten Ausgaben von The Maine Woods ein Glossar (»Eine Liste von Indianer-Wörtern«) angehängt ist. Nachdem Polis ihm gezeigt hat, wie man auf traditionelle Art aus Lilienwurzeln eine Suppe kocht, versucht Thoreau, es ihm nachzutun, und gegen Ende der Expedition (reichlich spät für diese Lektion) bringt Polis Thoreau bei, ein Kanu auf Art der Indianer zu paddeln.
Das ganze Buch The Maine Woods hindurch muss sich Thoreau immer wieder vom Irrtum befreien, dass die Indianer Naturschützer seien. Joe Aitteon bekennt offen, dass er nicht wie seine Vorfahren (»wild wie die Bären«) im Wald überleben könnte. Die Wälder sind nicht der Ort, wo die Indianer leben, sondern wo sie jagen, schreibt Thoreau, und beschuldigt sie dabei des Opportunismus. »Wie grob und falsch die Indianer und Jäger mit der Natur umgehen! Kein Wunder, dass ihre Rasse bald ausgestorben sein wird!« So unsinnig diese Einschätzung ist (kurz vorher schreibt er, dass die Indianer dort seit viertausend Jahren jagen), hat er doch recht mit der Feststellung, dass wahllose Abholzung und Jagd letztendlich das Gesicht des Waldes für immer verändern werden.
Eine der dramatischsten Geschichten des Buches ist die Tötung eines Elches durch Joe Aitteon. Thoreau beschreibt Elche voller Begeisterung und wirklichkeitsferner Phantasie: »Sie erinnerten mich an große verängstigte Kaninchen«; »sie erinnerten mich sofort an Giraffen« und »ihre verzweigten und blattartigen Geweihe an eine Art Seetang oder Flechte aus Knochen«. All diese Beschreibungen sind getragen von Zuneigung und Ehrfurcht. Die Tötung eines Elches ist für Thoreau eine Tragödie (»Die Natur blickte mich streng an, wegen des Mordes an einem Elch«), aber er räumt widerwillig ein, dass Elche von den Indianern aus Notwendigkeit gejagt werden, um ihres Fleisches und ihres Felles willen, und dass die Elchjagd zur Tradition und den Bräuchen der Indianer gehört.
In einem großartigen Abschnitt beschreibt Thoreau in »Chesuncook«, wie in seiner Vorstellung der Elch und die Kiefer verbunden sind. »Eine abgeholzte Kiefer, eine tote Kiefer, ist nicht mehr Kiefer als ein toter menschlicher Kadaver ein Mensch ist.« Er spricht von der »missbräuchlichen und gedankenlosen Verwendung« von Walen und Elefanten, die in »Knöpfe und Flageoletten« verwandelt werden. »Jedes Geschöpf«, fährt er fort, »ist besser lebendig als tot, Menschen und Elche und Kiefern, und wer das richtig begreift, wird das Leben eher bewahren als zerstören wollen.«
Der Indianer ist genauso wenig ein Freund der Kiefer wie der Holzfäller; tatsächlich ist der einzige Freund der Kiefer – und des Elches und der Wildnis – der Dichter. Verändere nichts, töte nichts, weder Elch noch Kiefer, schreibt er in einer Sequenz mahnender Sätze. Dieses wunderbar einfühlsame Plädoyer endet damit, dass Thoreau die Kiefer preist, »den lebendigen Geist des Baumes« liebt er am meisten. »Sie ist so unsterblich wie ich«, endet der Absatz, »und wird womöglich so hoch in den Himmel aufsteigen, dass sie mich auch dort noch überragen wird.«
Als »Chesuncook« in der Zeitschrift Atlantic Monthly erscheint, fehlt dieser letzte Satz. Der Herausgeber der Zeitschrift, James Russell Lowell, hatte ihn gestrichen. Die Umstände dieses Vorfalls und die Reaktion von Thoreau sind aufschlussreich. Lowell war erst kurz vorher zum Herausgeber der Zeitschrift geworden. Er kannte Thoreau persönlich, mochte ihn aber nicht besonders. Sie hatten zur gleichen Zeit in Harvard studiert, aber Lowell war eine Art Salonlöwe und Dandy, und Thoreau war Thoreau. Lowell fragte bei ihm einen Artikel für die Zeitschrift an.
Thoreau reichte daraufhin »Chesuncook« ein. Der lektorierte Text wurde an ihn zurückgeschickt, woraufhin er feststellen musste, dass der Satz über die Kiefer durchgestrichen war. Thoreau schrieb »stet« an den Rand, »Text bleibt«. Als der Artikel erschien, fehlte der Satz. Thoreau unterstellte, vielleicht zu Recht, dass Lowell ihn wegen seiner Naturverehrung zu heidnisch fand, überzogen, zu mystisch und druidisch, unwürdig einer Zeitschrift, von der er wollte, dass sie in jedem Haushalt willkommen wäre. Was auch immer der wahre Grund war, Thoreau fand die Streichung ohne sein Einverständnis »unlauter und feige«.
Man kann unschwer erkennen, dass der anstößige Satz Thoreaus Sicht auf die Welt zusammenfasst. Durch die Streichung machte Lowell seine Missbilligung dieser Sicht klar und verwarf so eine von Thoreaus Grundüberzeugungen. Thoreau, der jeglicher Autorität misstraute, ging hart mit ihm ins Gericht dafür in einem Brief, der ein kleines Meisterwerk der Verteidigung von Autorschaft darstellt. Unter anderem schrieb er darin: »Der Herausgeber hat in diesem Fall nicht mehr Recht, ein Gefühl herauszunehmen, als ein Gefühl einzufügen oder mir Worte in den Mund zu legen. Ich bitte niemanden, meine Meinungen anzunehmen, aber ich erwarte, dass sie, wenn sie sie in gedruckter Form anfordern, sie auch drucken oder meine Zustimmung zu ihrer Änderung oder Unterlassung einholen. Ich würde nicht viele Bücher lesen, wenn ich anzunehmen hätte, dass sie so bereinigt wurden. Ich empfinde diese Behandlung als Beleidigung, wenn auch nicht als solche beabsichtigt, denn es würde bedeuten, dass man mich dafür bezahlen kann, meine Meinung zu unterdrücken.«
Nach der Forderung, dass der Satz in der nächsten Ausgabe unbedingt abzudrucken sei, was er nie wurde, fuhr Thoreau fort: »Ich bin nicht gewillt, in irgendeiner Weise mit Menschen in Verbindung gebracht zu werden, die sich als so heuchlerisch und ängstlich erweisen wie es hier scheint. Ich würde einem Mann vergeben, der Angst hat vor einer gereckten Faust, aber wenn jemand regelmäßig ängstlich wird, wenn ein ernster Gedanke geäußert wird, dann muss ich glauben, dass sein Leben eine Art Albtraum ist, der bei vollem Tageslicht andauert.«
Thoreau war nach Maine gegangen, um genau solche Epiphanien zu haben, wie er sie in dem Satz über die Kiefer beschreibt. Er hatte ein starkes, sogar erotisches Verhältnis zu Bäumen, was sich nicht nur in seinem berühmten Satz »Die ganze Natur ist meine Braut« äußert, sondern auch in einer Witzelei, die er 1856 seinem Tagebuch anvertraut: »Es wurde endlich eine gute Partie für mich gefunden. Ich habe mich in eine Straucheiche verliebt.« Durch die Streichung des Satzes verweigerte Lowell Thoreau den zentralen Punkt seiner Argumentation, die Liebe zum Wald, und an Thoreaus Reaktion lässt sich ablesen, was ihm an seinem Buch wichtig war. Er will, dass wir diesen Satz und den darin formulierten Glauben im Kopf behalten. Er bringt den Geist des Buches auf den Punkt.
Der Geist von The Maine Woods ist jugendlich. Eine der Haupteigenschaften Thoreaus ist seine Jungenhaftigkeit – zu der auch die Liebe zu seiner Mutter gehört, sein verspielter Wortwitz und der Unwille, sein Zuhause zu verlassen. Und auch, so scheint mir, die vielen Momente einfachen Glücks, die er in der Freiheit der Wälder von Maine empfindet. Und was ist seine Sehnsucht, sich Fähigkeiten der Indianer anzueignen – Abenaki sprechen zu lernen, ein Kanu zu bauen –, anderes als der Wunsch, noch einmal ein junger Schüler zu sein?
Die Erwähnung von Tellern aus Birkenrinde, von denen mit Gabeln aus Erlenzweigen gegessen wird, der Verkostung von Zederntee und seine Freude darüber, dass der Tisch für das Abendessen einfach ein großer Holzklotz war, scheinen mir Beispiele dafür, dass Thoreau mit seiner zur Schau gestellten Freude am Primitiven eigentlich wie ein froher Pfadfinderjunge klingt.
»Ich wurde ganz aufgeregt vom Anblick der Wildtannen und Fichtenspitzen«, schreibt er in »Chesuncook«. »Es war wie der Anblick und Geruch von Kuchen für einen Schuljungen.« Eine der Portagen in »The Allegash« wird zu einer Tollerei, als Polis ein Wettrennen mit ihm macht, und es gefällt Thoreau offensichtlich, wenn der Indianer am Ende völlig außer Atem sagt: »Oh, manchmal ich gerne spielen.« Thoreau ging mit ernsthaften Absichten in die Wälder von Maine und hinterließ uns wertvolle Aufzeichnungen über diese Zeit und diesen Ort. Aber es steht auch außer Frage, dass der Wald Thoreau die Freiheit gab, zu spielen und jugendlich zu sein, wie ein kleiner Junge aufschauend zur Kiefer, dem Elch und dem Indianer.
Aber auch seine Ambivalenz ist Teil seiner Jugendlichkeit. Bei der Beschreibung eines einsamen Jägers, dem sie begegnen, vergleicht Thoreau dessen Schicksal mit dem »Leben der hilflosen Scharen in den Städten«. Er preist das Leben im Wald, kann sich aber nicht vorstellen, dort so gut leben zu können wie die Indianer. Das Leben des Jägers erschließt sich ihm nicht, ebenso wie »das Leben des einsamen Pioniers« oder »des Siedlers«, der »sein tägliches Brot direkt aus der Natur bezieht«. Für Bewunderer von Thoreaus Findigkeit ist eine der Offenbarungen von The Maine Woods – und sie mag leicht schockierend wirken – sein ehrliches Eingeständnis, dass er nicht im Wald leben könnte, dass dieser schließlich doch gesellige Mann die Gesellschaft seiner Stadt braucht, dass er froh ist, wieder nach Hause zurückzukehren.
Das Buch bietet aber weit mehr als einen erhellenden Einblick in das turbulente Dunkel Thoreaus innerer Konflikte. Die drei Reiseberichte zeichnen mit zunehmender Eindrücklichkeit das Bild einer sich wandelnden Landschaft. Er sah, dass sich aufgrund der Anwesenheit der Siedler, Missionare und Holzfäller die Lebensweise der Indianer bis zur Unkenntlichkeit veränderte, dass die Städte abstoßender wurden und der Wald dem Untergang geweiht war, es sei denn, man würde Teile von ihm zu geschützten Gebieten erklären, die Thoreau Nationalparks nannte.
Seine Einwände gegen die Eindämmung von Flüssen und Bächen bewiesen Weitblick; er sah die Folgen voraus, die Schäden durch Überflutungen und den Verlust natürlicher Lebensräume. Er war zwar keineswegs der Einzige, der das Werk der Holzfäller anprangerte, aber unvergesslich sind seine Angriffe im Namen einer Wildnis, die »zehntausend Schädlinge« spüre, »die an den Fundamenten ihrer edelsten Bäume nagen«. Auf ähnliche Weise berichtete er in Walden, anstatt seine Nächte in der Holzhütte zu idyllisieren, vom Lärm der ersten Lokomotiven, die dort in Hörweite vorbeifuhren. Rückblickend schrieb er in Walden: »Seit ich aber diese Ufer verließ, haben die Holzhauer sie noch weiter verwüstet […] Wie kann man erwarten, dass die Vögel singen, wenn man ihre Bäume fällt?«
The Maine Woods ist einer der frühesten und detailliertesten Berichte über die Veränderungen des Landesinneren Amerikas durch die Zivilisation. Thoreau lehrt uns darin, wie man über die Natur schreibt, Wissen erwirbt, beobachtet, und ganz grundsätzlich: wie man leben sollte. »Wir sollten unser Leben so zärtlich und anmutig führen wie man eine Blume pflücken würde.« Natürlich kann Thoreau schreiben wie ein Engel, aber diese Begabung ist nicht seine einzige und auch nicht seine größte. Da er mit so großer Gewissenhaftigkeit aufschrieb, was er sah und hörte, kündet sein Werk davon, was die Zukunft bringen sollte. Das Buch veranschaulicht so die große Einsicht über die Wahrhaftigkeit beharrlichen Beobachtens: dass Texte, wenn in ihnen die Wahrheit gesagt wird, prophetisch sind.
(2004)