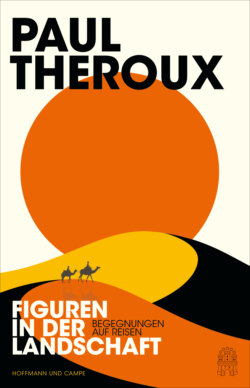Читать книгу Figuren in der Landschaft - Paul Theroux - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Studie für Figuren in der Landschaft
ОглавлениеIch bin Romanschriftsteller, und nur gelegentlich Essayist oder Chronist meiner Reisen. Wie gerne wäre ich dazu fähig, die Schneckenspur meiner Schriftstellerei zu beschreiben – diese tastende innere Reise voller Fehlstarts und frustrierenden und dann wieder bezaubernden Momenten –, ohne großspurige Vagheiten und absurde Scheinheiligkeiten zum Besten zu geben. Schon diese Zeilen klingen prätentiös und unangenehm, Sie sehen also das Problem.
Wenn ich die maßlose Eitelkeit so verabscheue, mit der andere Schriftsteller in Abstraktionen über ihr Werk sprechen, warum sollte ich es dann selbst tun? Ich sehe Leute lieber gute Literatur schreiben, als mir ihre stöhnenden Berichte darüber anzuhören, wie sie es gemacht haben. Wenn Schriftsteller darüber klagen, wie hart das Schreiben ist, sich über ihr Leid auslassen, weiß wirklich jeder, dass das, was sie sagen, Unsinn ist. Verglichen mit einem richtigen Beruf, wie in einem Bergwerk oder der Gastronomie, als Feuerwehrmann oder Ananaspflücker, ist Schreiben der Himmel.
Außerdem bin ich von der großen, nagenden Angst vieler Schriftsteller besessen, dass ich, wenn ich das Handwerk der Romanschriftstellerei allzu genau analysieren würde, vielleicht nie wieder ein Wort zu Papier brächte. Also lieber gar nicht erst darüber schwadronieren. Jeder Schriftsteller muss das Geheimnis des Schreibens in sich selbst finden. Leid kann hilfreich sein, Durcheinander auch, so wie auch die Liebe zu Büchern und das Verlassen der Heimat. Ich bin mit der Vorstellung groß geworden, die der Reiseschriftsteller Norman Lewis so treffend ausgedrückt hat: »Je weiter ich von zu Hause weg war, desto besser würde es sein«, und es erwies sich auch als wahr.
Aber wenn das Schreiben von Romanen ein Ritual im Dunkeln ist, obskur und so ungreifbar, dass man kein Wort von dem versteht, was man geschrieben hat, bis man fertig ist, erfordern andere Arten des Schreibens einen einfacheren und praktischeren Ansatz.
Reiseschriftstellerei: Dazu kann ich was sagen. Für die habe ich bestimmte Richtlinien. Die erste ist: Reisen Sie so inoffiziell wie möglich.
Die Gefahren offizieller Reisen und Besuche sieht man überall. Nichts auf der Welt ist irreführender als der gesponserte Besuch, die Pressereise, der Pressepool, die Pressemappen, die Informationsreise. Der Subtext des offiziellen Besuchs ist immer tendenziös, und es sind Faulheit, Selbstherrlichkeit und Gier, die den Besucher dazu bringen, solchen Einladungen zu folgen und die Lügen zu schlucken. Der einzige Sinn des roten Teppichs besteht darin, den Besucher zu blenden und die Wahrheit zu verschleiern.
»Uganda macht sich großartig«, sagte Präsident Clinton zu mir bei einem Treffen, als ich ihm erzählte, dass ich dort herumgereist war.
»Nein, überhaupt nicht«, sagte ich. »Die Regierung ist korrupt. Die Opposition wird unterdrückt und verfolgt. Das Leben im Busch ist schwieriger als in den 1960ern, als ich dort Lehrer in Kampala war. Und wie gesagt, ich war vor einem Monat dort.«
»Hillary war gerade da.« Der Präsident lächelte über meine Unwissenheit. »Dem Land geht es gut.«
Und daraufhin musste ich dann lächeln.
»Für wen halten Sie sich, solche schrecklichen Dinge über den Iran zu sagen? Sie lügen!«, brüllte mich Marion (Mrs. Jacob) Javits im August 1975 in den Kulissen des NBC-Fernsehstudios in New York City an, kurz nachdem ich mein erstes Reisebuch, Basar auf Schienen, veröffentlicht hatte. Der Iran sei ein stabiles, prosperierendes und gut regiertes Land, sagte sie. Wirklich?
Ich war mit dem Zug und dem Bus durch das ganze Land gereist, von West nach Ost, und in der heiligen Stadt Meschhed gelandet. Ich hatte nichts als Geschichten von Folter, Unterdrückung und Tyrannei von sehr wütenden Iranern gehört, die davon sprachen, den Schah loswerden zu wollen. Es stellte sich heraus, dass Frau Javits eine bezahlte Beraterin der iranischen Regierung war, und ihr Ehemann, der US-Senator Jacob Javits, gerne iranische Empfänge besuchte und den dort gereichten Kaviar genoss, auf Einladung des Schahs, der vier Jahre später gestürzt wurde.
»Kein Schicksal ist so ungewiss wie das der Reisebücher«, schrieb Joseph Conrad in seinem Vorwort zu Richard Curles Into the East. »Sie sind das angreifbarste aller literarischen Erzeugnisse. Der Mann, der ein Reisebuch schreibt, liefert sich mehr als jeder andere in die Hände seiner Feinde.«
In meinem 1988 erschienenen Buch über meine Reisen durch China, Riding the Iron Rooster (nennen Sie mir einen beliebigen Zug in China, ich bin mit ihm gefahren), schrieb ich, dass die chinesische Polizei, die bewaffnete Volkspolizei und die »Friedensagenten« aus Chengguan mit Vorliebe Studenten verprügelten. Ich war ein Jahr lang durch China gereist; ich hatte viele Demonstrationen gesehen. Die gängige Meinung im Westen war, dass die chinesische Regierung reformorientiert und tolerant sei. Die Rezensenten zerrissen mein Buch in der Luft. Und nur ein Jahr später fand das Massaker am Tiananmen-Platz statt.
Wahres Reisen und die Recherche des Essayisten bedürfen recht einfacher Kunstgriffe: bescheiden, geduldig, allein, anonym und wachsam sein. Das sind alles keine Eigenschaften, die man für gewöhnlich mit stubenhockerischen Abgeordneten auf einer Inspektionsreise verbindet oder mit Tugendhelden auf der Suche nach Ländern, die sie mit ihrer Wohltätigkeit und ihren Lebensmittelgeschenken beglücken können, oder mit Journalisten, die über hochrangige Treffen berichten – die allesamt hauptsächlich auf den ausgerollten Teppich aus sind.
Für mich als wohlhabenden, älteren, halbwegs bekannten Schriftsteller, der es sich leisten kann, Erster Klasse zu fliegen, schöne Autos zu mieten und in guten Hotels zu übernachten, ist es besonders wichtig, dass ich in alten Kleidern, mit kleinem Budget, in einem Bus oder mit dem Zug oder auf einem Viehtransporter reise. Mein Element (und seit Herodot der Stoff, aus dem die Reiseberichte sind) ist die Begegnung mit gewöhnlichen Leuten. Als ich 2001 in Afrika war, erfuhr ich so gut wie nichts Interessantes von Politikern, aber sehr vieles durch meine Gespräche mit Lastwagenfahrern, Wanderarbeitern, Prostituierten und Bauern. Auch Schriftsteller sind eine Quelle der Inspiration, besonders wenn sie Teil einer bestimmten Landschaft zu sein scheinen. In Buenos Aires suchte ich Jorge Luis Borges auf, in Tanger Paul Bowles, in Brasilien Jorge Amado, in der Türkei Yaşar Kemal und später Orhan Pamuk. Auf meinen Reisen durch Afrika verbrachte ich in Ägypten Zeit mit Nagib Mahfuz und in Johannesburg mit Nadine Gordimer. Das gesamte Genre der Reiseliteratur und vieler Reise-Essays scheinen mir treffend in dem Titel des rätselhaften Gemäldes von Francis Bacon Studie für Figuren in einer Landschaft zusammengefasst.
Ich genieße den Komfort ebenso wie jeder andere Reisende. Und niemand weiß ein zurückgezogenes Leben mehr zu schätzen als ein Schriftsteller – und empfindet weniger Freude am eitlen Schwarm, wo Jugend herrscht und Gold und sinnlos Prunken. Kommt Ihnen bekannt vor? Es sind die Worte des Herzogs in Shakespeares Maß für Maß, und Reiseschriftsteller tun gut daran, sie sich zu Herzen nehmen. Um herauszufinden, was in seinem Herzogtum wirklich vor sich geht, sagt der Herzog, müsse er in eine bescheidene Verkleidung schlüpfen, wie das Gewand eines Mönchs, um »sowohl Fürst als auch Volk zu besuchen«.
Auch von Harun al-Rashid, Kalif von Bagdad im 8. Jahrhundert, kann man lernen. Der Kalif verkleidete sich regelmäßig als Mann aus dem Volk und ging dann auf den Markt, um zu sehen, wie die Menschen lebten, welche Sorgen sie hatten, was sie beschäftigte, worauf sie stolz waren. Die großen Reisenden der Vergangenheit unternahmen ihre Wanderungen in einem ähnlichen Entdeckergeist – die mittelalterlichen Mönche, die nach China kamen, die japanischen Bettelmönche, die wandernden Tagebuchschreiber, die der französische Historiker Fernand Braudel in meinem Lieblingsbuch Sozialgeschichte des 15.–18. Jahrhunderts: Der Alltag so ausführlich zitiert. Offizielle Reisen zeigen Ihnen nicht, wie die Welt aussieht; inoffizielle Reisen, bei denen Sie die Leute belauschen und beobachten, hingegen schon.
Den Weg von Kairo nach Kapstadt, als ich für mein Buch Dark Star Safari durch Afrika reiste, legte ich mit Bussen, Lastwagen, Fähren, Kanus und Zügen zurück. Ich hatte keinen Namen; ich war nie jemand Besseres. Manchmal war ich Effendi oder Faranji, aber überall im suahelisprachigen Afrika war ich Mzee – Papa, Opa –, so wie ich es wollte, ein anonymer älterer Mann. Natürlich ist das Alleinreisen mit Risiken verbunden, aber es hat auch enorme Vorteile. Als amerikanischer Reisender ist man ohnehin privilegiert, aber mir ist schleierhaft, wie es möglich sein soll, ein Land wirklich zu verstehen, ohne seine Kehrseiten, sein Hinterland, sein Alltagsleben zu sehen. Nicht Bürokraten in Büroräumen, sondern Figuren in der Landschaft.
Der aufschlussreichste Teil eines Landes, und besonders eines afrikanischen Landes, ist seine Grenze. Jeder kann am Flughafen einer Hauptstadt ankommen und sich von der Modernität dort täuschen lassen, aber es braucht schon einen gewissen Mut, um mit dem Bus oder dem Zug an die Grenze zu fahren, immer das Gebiet der Vertriebenen und Verarmten, der Menschen, die versuchen, das Land zu verlassen oder hineinzugelangen, der Fluch der Bürokratie. Die Zoll- und Einwanderungsbeamten an den Grenzübergängen sind zwar nicht für ihre freundliche Art bekannt, aber sie sind repräsentativer für das Leben vor Ort als die Leute, die Sie am internationalen Flughafen der Hauptstadt mit einem breiten Lächeln in Empfang nehmen.
Wenn Sie inoffiziell unterwegs sind und auf Reisen improvisieren, worauf können Sie dann zurückgreifen? Auf Ihren Mut, sonst nicht viel. Sie gehen hin und hoffen auf das Beste. Den weisesten Ratschlag für Reisen habe ich von einem Strandgutsammler in Australien, der dort campte und vorhatte, die Halbinsel Cape York zu umsegeln. Mit einem größeren Schiff wäre das eine haarsträubende Tour, sein Plan war aber, die Fahrt mit einem kleinen selbstgebauten Floß zu machen. Er hatte keinen Zweifel daran, dass er die starke Strömung und die starken Winde der Torres-Straße überleben und vielleicht sogar nach Papua-Neuguinea weiterfahren würde.
»Meiner Erfahrung nach«, sagte er, »kann man fast alles machen und fast überall hingehen, wenn man nicht in Eile ist.«
Mir scheint, dass alle guten Ratschläge, die ich jemals erhalten habe, von Menschen kamen, die nichts als den Wunsch haben, in Bewegung zu sein – Optimisten allesamt. Als ich 1992 für mein Buch Die glücklichen Inseln Ozeaniens auf Reisen und mit einigen Fischern auf einem Auslegerkanu bei den Trobriand-Inseln unterwegs war, sagte mir der Steuermann, dass er auf der Suche nach Fisch Hunderte von Meilen aufs Meer hinausfuhr.
»Der Ozean sieht wie eine einzige geschlossene Wasseroberfläche aus, aber das stimmt nicht«, sagte er. »Es gibt überall Felsen und kleine Inseln, an denen man sein Kanu festmachen und wo man die Nacht verbringen kann.«
Das Reisen besteht zu einem Großteil aus Scherereien und Verzögerungen, was keinen Leser interessiert. Ich tue mein Bestes, um auf eine Reise gut vorbereitet zu sein. Ich erkundige mich nur selten nach Namen von Leuten, die man vor Ort aufsuchen sollte.
Vorsicht und Improvisationstalent sind nützlich für den Reisenden, da er dauernd daran erinnert wird, dass er ein Fremder ist, und entsprechend wachsam und einfallsreich werden muss. Bevor ich mich auf den Weg mache, studiere ich gründlich die detailliertesten Karten, die ich finden kann, und lese alle Low-Budget-Reiseführer. Geld zu haben ist von Vorteil, aber Zeit ist wertvoller. Abgesehen von einem kleinen Kurzwellenradio trage ich keine Hightech-Gegenstände mit mir herum – mittlerweile zusätzlich noch ein Telefon, niemals eine Kamera oder einen Computer, nichts Zerbrechliches oder Unersetzliches. In Südafrika wurde mir meine Tasche gestohlen, und fast alles, was ich besaß, war weg: eine gute Lektion. Ich hatte aber immer noch meine Notizen. Wer stiehlt schon Notizbücher?
Das Schreiben also. Ich habe ein Notizbuch im Taschenformat dabei und kritzle es den ganzen Tag lang voll. Abends übertrage ich diese Notizen in ein größeres Tagebuch und ordne den Tag zu einer Erzählung. Ein durchschnittlicher Eintrag für einen Tag beträgt etwa tausend Wörter, manchmal weniger, oft mehr. Wenn ich unterwegs die Möglichkeit habe, fotokopiere ich die Seiten, etwa vierzig oder fünfzig auf einmal, und schicke sie nach Hause. Bis zum Ende einer Reise habe ich ungefähr sieben oder acht Notizbücher vollgeschrieben, die die Grundlage für das Buch bilden. Wenn ich jemanden für ein literarisches Porträt interviewe, insbesondere wenn es eine potenziell klagefreudige Person ist, lasse ich ein Aufnahmegerät laufen, während ich die Antworten zusätzlich in ein Notizbuch schreibe, um später die wichtigen Passagen klarer vor Augen zu haben.
Danach transkribiere ich das gesamte Interview eigenhändig vom Band, die langweiligen Passagen lasse ich aus. Ich habe noch nie eine Sekretärin, einen Assistenten oder Rechercheur beschäftigt. Obwohl ich deutlich mehr Romane als Reisebücher geschrieben habe, könnte ich über meine Methode als fiktionaler Schriftsteller nie so genau oder sicher Auskunft geben, falls ich überhaupt eine Methode habe.
Nach Sunrise with Seamonsters (1984) und Fresh Air Fiend (2001) ist Figuren in der Landschaft mein dritter Band mit Essays, insgesamt 134 Essays, über 53 Jahre hinweg geschrieben. In der gleichen Zeit habe ich dazu Romane, Kurzgeschichten und Reisebücher veröffentlicht. Millionen von Wörtern! Was wie Graphomanie oder Furor Scribendi wirken mag, ist aber nicht zwanghafter als der natürliche Drang des durchschnittlichen Künstlers, der sein schöpferisches Leben lang eine Vielzahl von Gemälden und Skizzen anfertigt. Genau wie für einen Maler stellte für mich die Vertiefung ins Schreiben nicht nur eine Möglichkeit dar, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch, mein Leben zu ergründen. Ich sehe mich ähnlich wie Ford Madox Ford, der sich in der Widmung zu seinem umfassenden Überblick The March of Literature als »einen alten Mann« beschreibt, »der verrückt ist nach dem Schreiben – in dem Sinne, wie Hokusai sich als einen alten Mann bezeichnete, der verrückt war nach dem Malen«.
Als ich 1971 meinen Job an der Universität von Singapur kündigte, schwor ich mir, nie wieder für einen Chef zu arbeiten oder Memos wie »Institutstreffen am Donnerstag. Seien Sie da« zu befolgen. Ich hatte vier Romane veröffentlicht und arbeitete an einem fünften, Saint Jack. Mir wurde klar: Ich kann kein Teilzeit-Autor sein. Ich muss mich der Sache ganz verschreiben, selbst wenn das heißen sollte, in Armut zu leben.
»Der Wert einer Sache bemisst sich danach, was man dafür aufgeben würde, sie zu besitzen.« Dieser aphoristische Satz aus dem Roman The Secret Books meines Sohnes Marcel drückt auf elegante Weise aus, wie ich mich vor sechsundvierzig Jahren gefühlt habe, als ich die Sicherheit meiner Anstellung, eine mögliche Rente, ein gewisses Prestige und ein festes Monatsgehalt für die prekäre Existenz in einer kleinen, schlecht beheizten Steinhütte in einer abgeschiedenen Gegend von Dorset in England aufgab. Die erste Version von Saint Jack wurde dort glücklich fertiggestellt.
Die Notwendigkeit lehrte mich, dass ich meine Rechnungen auch durch Auftragsarbeiten bezahlen konnte: Buchbesprechungen, Reiseberichte, Porträts bekannter und unbekannter Leute. Anthony Burgess schrieb einmal: »Ich lehne keinen vernünftigen Auftrag ab, und nur sehr wenige unvernünftige.« Burgess, mit dem ich befreundet war und der sich sehr großzügig über meine Arbeit äußerte, ist jemand, mit dem ich mich identifizieren kann, wie mit all den anderen Schriftstellern, die ihre Schriftstellerei durch Aufträge finanziert haben. Graham Greene, V.S. Naipaul, V.S. Pritchett, Jonathan Raban und viele andere Schriftsteller, die ich persönlich kannte, haben als freiberufliche Autoren, als Freelancer begonnen. Mir gefällt der Begriff des »Freelancers«, mit seiner Andeutung von Unabhängigkeit und potenzieller Macht: ein bewaffneter Reiter, der allein durch die Lande zieht, sich gegenüber keinem Ritter zu verantworten hat, aber offen ist für Verhandlungen und bereit, in den Kampf zu ziehen. In Bezug auf seine Romane schrieb Henry James: »Es ist die Kunst, die das Leben schafft, etwas interessant und bedeutend macht, und ich weiß nichts, was die Kraft und Schönheit dieses Prozesses ersetzen könnte.« Doch müssen diese edlen Worte eben auch der Tatsache gegenübergestellt werden, dass James seinen Lebensunterhalt mit Reiseberichten und Rezensionen bestritt.
Als Jonathan Raban 1987 seiner ersten Essay-Sammlung den pointierten Titel For Love and Money gab, lieferte er zugleich das Motto im Wappen der Freelancer. Natürlich nehmen Schriftsteller Aufträge an, um ihre Rechnungen zu bezahlen, denn, wie Dr. Johnson sagte: »Nur ein Holzkopf hat je für etwas anderes als Geld geschrieben.« Aber niemand hat je gut geschrieben ohne die Liebe zum Schreiben.
Ich habe zwar solche offiziellen Förderungen nie erhalten, habe aber auch nichts gegen die Guggenheim-Stipendien, die Fulbright-Preise, das MacArthur-Stipendium oder die Ernennungen zu Stadtschreibern. Nur können sie die Schriftsteller täuschen und betören. Der Glamour und die sozialen Annehmlichkeiten, die mit solchen Auszeichnungen einhergehen, können zu der irrigen Vorstellung führen, dass es der Mäzen ist, der dem Autor Würde verleiht, und nicht sein Werk. Zu den Folgen solcher Förderungen gehören die Selbstgefälligkeit, die Überheblichkeit der Prominenz, das unvermeidliche Händegeschüttel und eine Art Unwirklichkeit. Auffällig bei vielen Schriftstellern in dieser glücklichen Lage ist dazu der Unwille, sich ins Unbekannte zu stürzen. Schlimmer als all das ist jedoch die Verachtung des Freelancers als armem Lohnschreiber – ein Reflex, dem man bei den geförderten, mit Preisen überhäuften Autoren recht häufig begegnet. Alles in allem habe ich dann wohl doch, wenn ich das jetzt so geschrieben vor mir sehe, geringfügige Vorbehalte, was die Literaturförderung betrifft.
Der Freelancer wird von Neugierde geleitet und muss, wenn er ihr folgt, kompromisslos sein, er darf niemals seine schriftstellerische Gabe verraten, indem er schlecht oder in Eile schreibt, oder auf Geheiß des Redakteurs in einem bestimmten Stil. Die Freiheit – zu reisen oder kurzfristig einen Auftrag anzunehmen – ist für ein solches Leben eine unerlässliche Voraussetzung. Wenn Sie sich darauf einlassen, kann aber schon der geringste Anlass eine ganze Kette von Ereignissen auslösen.
Ich wollte zum Beispiel mal den Sambesi mit dem Kajak hinabfahren und hatte mit National Geographic vereinbart, dass ich einen Artikel darüber schreibe. Während der Reise traf ich ein attraktives Paar, das gerade eine Luxus-Safari auf der simbabwischen Seite des Flusses machte. Die Frau trug hohe Stiefel und eine maßgeschneiderte Safarijacke; der Mann war vom Typ Hemingway, bärtig und schroff, und auch er trug stilvolles Khaki. Sie kamen aus New York, und ich hielt sie für Mann und Frau. »Wir bleiben in Kontakt«, sagte die Frau zu mir beim Abschied.
Zurück in den USA rief ich sie an, um mehr über ihre Eindrücke von Afrika zu hören, und erkundigte mich im Laufe des Gesprächs nach ihrem Beruf. »Ich bin eine Domina«, sagte sie. »Der Mann, mit dem ich zusammen war, ist ein Kunde von mir. Ich habe ihm auf der Safari ziemlich oft den Hintern versohlt.«
So traf ich »Nurse Wolf«, die sich bereit erklärte, sich mit mir für den Artikel zu unterhalten, der in diesem Band enthalten ist und im New Yorker erschien. Zugleich ermöglichten mir der Bericht über meine Fahrt auf dem Sambesi und die Gage vom New Yorker, eine noch ehrgeizigere Afrikareise in Angriff zu nehmen, von Kairo nach Kapstadt auf dem Landweg, woraus mein Reisebuch Dark Star Safari hervorging.
Im besten Fall lebt der Freelancer ein Leben voller glücklicher Zufälle. Ein Auftrag für einen Zeitschriftenartikel führte mich 1980 nach China, für eine Kreuzfahrt auf dem Jangtse, was wiederum zu weiteren Aufträgen für Texte über China führte und schließlich zu meiner einjährigen Chinareise für Riding the Iron Rooster. Eine Geschichte über Neuseeland Ende der 1980er Jahre weckte meine Neugier und brachte mich dazu, einige Jahre darauf für Die glücklichen Inseln durch den Pazifik zu reisen und mich später auf Hawaii niederzulassen.
Hin und wieder siegt die Neugier, und ich schreibe etwas auf eigene Faust in der Hoffnung, dass sich eine Zeitschrift dafür interessiert. Nachdem ich viele seiner Bücher gelesen hatte, schrieb ich Oliver Sacks, ob ich ihn zum Mittagessen einladen dürfe, um mit ihm über das Konzept der »Neurologie der Straße« zu sprechen, die Analyse der Störungen zufälliger Passanten auf den Straßen New Yorks. Wir gingen spazieren, und Oliver diagnostizierte die Tics und Zwangsstörungen Fremder. Wir wurden Freunde. Ich machte mir ausgiebig Notizen und schrieb schließlich ein Porträt, das dann auch von einer Zeitschrift veröffentlicht wurde. Meine Texte über Hawaii in diesem Band, über mein Leben in London, über Autobiographien, über Gänsezucht, über meine Erfahrung mit der psychedelischen Droge Ayahuasca, über ein Leben als Leser und die vielen Gastkommentare und Kolumnen habe ich nicht auf Anfrage geschrieben. Den Text über meinen Vater, »Lieber alter Dad«, habe ich im Winter 2007 in der Transsibirischen Eisenbahn geschrieben, als ich neun untätige Tage (und 9289 Kilometer) vor mir hatte. In Wladiwostok fing ich an, meine Erinnerungen an ihn aufzuschreiben, schrieb, während draußen die Birken und kahlen schneebedeckten Weiten vorbeizogen, und war fertig, als der Zug in den Jaroslawler Bahnhof in Moskau einfuhr. Der Essay über meinen Vater führte zu umfassenderen Überlegungen zu meiner Familie und einem Haufen Notizen, die schließlich die Grundlage für meinen Roman Mutterland wurden.
Dann gibt es noch die Texte, die auf die Anfrage oder das Gespräch mit einem Herausgeber oder Redakteur zurückgehen. Solche Vorschläge für Texte, aus heiterem Himmel, haben oft den Vorzug, dass man mit Büchern, mit der Welt, mit komplexen Figuren und eindrucksvollen Landschaften in Kontakt bleibt. Der Herausgeber oder Redakteur fragt an, ob man vielleicht Interesse daran habe, einen Prominenten zu porträtieren oder die Einführung zu einem Buch oder einen Essay über einen Schriftsteller zu schreiben. Wenn es sich um Autoren oder Bücher handelt, die ich bewundere, sage ich zu. Daher die Essays in diesem Buch über Henry David Thoreau, Henry Morton Stanley, Joseph Conrad, Somerset Maugham, Graham Greene, Paul Bowles, Muriel Spark, Hunter Thompson. Ich las Georges Simenons Chez Krull zum ersten Mal als Lehrer in Afrika, las weitere Bücher Simenons und stellte erfreut fest, dass auch er in den 1930ern durch Afrika gereist war (und drei Romane mit afrikanischem Hintergrund geschrieben hatte); dass er durch den Pazifik gesegelt war, in Arizona und Connecticut gelebt und Hunderte von Romanen veröffentlicht hatte. Nachdem ich fünfzig Jahre lang Simenon gelesen hatte, entsprach ich gern der Bitte eines Verlegers, die Einführung zu einer Neuauflage seines Romans Die Witwe Couderc zu schreiben.
Eine der angenehmen Nebenwirkungen des Schreibens über all diese verschiedenen Themen ist, dass man davon ganz gut leben kann, ohne die andere Arbeit beiseitelegen oder vor einer Klasse stehen zu müssen, sich auf Stipendien zu bewerben oder als irgendeine Art von Berater zu arbeiten. Ein weiterer willkommener Nebeneffekt ist, dass solche gelegentlichen Auftragsarbeiten die ermutigende Illusion einer richtigen Anstellung erzeugen, das Gefühl, man sei sehr beschäftigt und habe Arbeit zu verrichten. Die große Furcht eines Schriftstellers ist nämlich, dass das Schreiben so langsam vorangeht, dass es eher eine Art perverses Hobby ist als eine solide Beschäftigung, und schon gar nicht vergleichbar mit einem richtigen Beruf.
Vieles davon gehört einer alten Welt an, mit einem literarischen Leben, das am Verschwinden ist. Vor kurzem habe ich meine Papiere an eine renommierte Bibliothek verkauft; sie schickten einen Lastwagen, um sie abzuholen. Auch das wird zu einem Anachronismus, denn ich schreibe meine ersten Entwürfe noch von Hand, anders kenne ich es nicht. Wie lange werden Schriftsteller noch ein Papierarchiv besitzen? Der Lastwagen mag bereits jetzt überflüssig sein; viele Schriftsteller können ihr gesamtes Archiv auf ein oder zwei USB-Sticks speichern.
Während ich das schreibe, werden Zeitschriften eingestellt, im Fernsehen kaum noch Interviews mit ernst zu nehmenden Schriftstellern gezeigt, und im Radio kommt vor allem Musik, unterbrochen von irgendwelchen Diskussionen über Sport. Der Beruf des Schriftstellers, wie ich ihn bisher kannte, wandelt sich grundlegend. Die alten Medien sind zu Fossilien geworden, und was ich über die neuen Medien weiß, ist, dass sie flüchtig, rechthaberisch und improvisiert sind, die Texte weitgehend unredigiert, voller Lügen und Plagiate und schlecht bezahlt. Wenn ich mir so zuhöre, steigt in mir aber zugleich das Gefühl auf, dass ich wahrscheinlich falschliege und (wie mein Sohn einst über alte Männer schrieb) das Ende meines Lebens mit dem Ende der Zivilisation verwechsle, und dass es verknöchert ist, sich so geringschätzig über Innovationen auszulassen oder mit Erstaunen zu vermelden, dass die Barbaren vor den Toren stehen, wo sie dort doch immer schon standen – und den Schriftstellern einen Grund gaben, wachsam, schonungslos und beschäftigt zu sein.