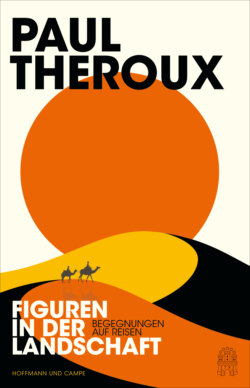Читать книгу Figuren in der Landschaft - Paul Theroux - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Der Reisende
ОглавлениеReise ohne Landkarten ist eine so souveräne Reise, so unheilverkündend in ihren an Conrad erinnernden Schattierungen, dass man sich immer wieder neu klarmachen muss, dass das Buch der Balanceakt eines jungen Mannes ist. Was im Übrigen auch für Conrads eigene Reise gilt, die ihn zu seinem Buch inspirierte, bei der er im September 1890 die Roi des Belges den Kongo hinaufsteuerte, auch sie ein Balanceakt: Conrad (damals noch Kapitän Korzeniowski) war zweiunddreißig, brauchte Geld, trug sich mit dem Gedanken, die See für immer hinter sich zu lassen, und machte nur langsam Fortschritte mit seinem ersten Roman, Almayers Luftschloss. Reisen durch Afrika änderten die Laufbahn beider Männer, indem sie ihnen epische Themen und dschungelhafte Uneindeutigkeit boten. Viele Jahre später nannte Greene die nervöse Reise, die er im Alter von dreißig Jahren gemacht hatte, »lebensverändernd«. Conrad äußerte sich ähnlich über seine hektische Fahrt den Fluss hinauf und hinunter.
Greenes Buch ist eines von vielen in der Reiseliteratur, die ein mythisches Durchdringen Afrikas hin zu seinem eigentlichen Wesen suggerieren, ganz ähnlich seinen Vorläufern Herz der Finsternis, Stanleys Durch den dunkeln Welttheil oder die Quellen des Nils und Im dunkelsten Afrika, und seinen vielen Nachfolgern, darunter Laurens van der Posts Vorstoss ins Innere. Der Mythos von der Suche, der in diesen Büchern ausgeführt wird, ähnelt den Abenteuergeschichten von Jungs: die Qualen, die der weiße Reisende aushalten und überwinden muss (mit allen stereotypen Hindernissen des Primitivismus), um eine lebensverändernde Offenbarung im fernen Herzen Afrikas zu erleben. Diese phantasiereiche Annahme des heroischen Romantikers mit Tropenhelm, dass l’Afrique profonde funkelnde Geheimnisse enthält, ist einer der Gründe dafür, warum wir einen so verzerrten Blick auf Afrika haben. Im Fall von Conrad war die Offenbarung »Das Grauen! Das Grauen!«. In Greenes Fall waren es Ärgernisse, das Heimweh, afrikanische Träger, die »zu weit!« klagten, und psychoanalytische Bestätigungen vorheriger Annahmen. Im Grunde gibt es aber gar kein Geheimnis, nur die offensichtliche Wahrheit, dass schwierige Reisen, wie zum Beispiel auf dem Landweg durch Afrika, uns vieles über uns selbst lehren: über die Grenzen unserer Kraft, unserer Weisheit, unseres Geistes, unseres Einfallsreichtums, selbst die Grenzen unserer Liebe.
Greenes Buch ist ein genial aufbereiteter Bericht über eigentlich nur vier Wochen im Busch Liberias von einem absoluten Anfänger, was Afrika betrifft. Greene gesteht das gleich zu Beginn ein. »Ich hatte Europa nie zuvor verlassen, ich war ein völliger Amateur, was Reisen in Afrika betraf.« Erstaunlicherweise nahm er seine junge Cousine Barbara mit, um ihm Gesellschaft zu leisten. »Ihr armen Ahnungslosen!«, ruft ihnen ein Fremder in Freetown zu. Wenn der gewusst hätte.
Fern seiner gewohnten Umgebung ist Greene bedrückt, nervös und unruhig, und Barbara verfügt über keine nennenswerten Qualitäten. Der mitleidige Fremde in Freetown erkannte an ihrem hilflosen Lächeln und der mangelnden Vorbereitung, dass sie einen Sprung ins Ungewisse gewagt hatten – Journey into the Dark war auch einer der Titel für das Buch, der jedoch verworfen wurde. Wie ahnungslos war Greene wirklich? Hier ein Beispiel: Kurz vor seiner Ankunft in Freetown, wo die Reise beginnen soll, gesteht er: »Ich konnte mir die Himmelsrichtungen auf dem Kompass noch nie richtig merken.« Kann ein Reisender ahnungsloser sein?
Doch lassen sich Greene und seine Cousine von der eigenen Inkompetenz nicht schrecken. Sie suchen sich einen Führer. Sie heuern Träger und einen Koch an. Sie steigen in den Zug Richtung liberianische Grenze und beginnen ihre Wanderung durch das Hinterland. Sie haben sechsundzwanzig schlecht bezahlte afrikanische Träger, die ihre Vorräte und Ausrüstung schleppen. Sie haben eine Pistole, ein Zelt (das sie nie nutzen), einen Klapptisch, eine tragbare Badewanne und einen Vorrat an Whiskey. Sie haben sogar Glasperlen zum Verteilen an Einheimische dabei – allerdings bevorzugen die Einheimischen Geld oder Whiskey. Die Reise ist abenteuerlich: Beiden machen die Anstrengungen schwer zu schaffen, Greene bekommt hohes Fieber, es gibt Missverständnisse und Irrwege. Die Träger verzögern dauernd die Weiterreise. Gut einen Monat nach ihrem Aufbruch sind die Greenes zurück an der Küste, und etwa eine Woche später (das Buch geizt mit Zeitangaben) sind sie wieder auf einem Schiff mit Kurs auf England.
Die Reise fand 1935 statt. Junge, ansehnliche, selbstbewusste, gut gekleidete und überhebliche Engländer, frisch von den besten Universitäten, tauchten in den entlegensten Ecken der Welt auf, prahlten mit ihrer Amateurhaftigkeit, trugen komische Kopfbedeckungen (Greene trug einen Tropenhelm), in der unerschütterlichen Gewissheit, dass schon alles gut gehen wird. Die Leute würden sie für ihre Englishness respektieren und zuvorkommend und hilfsbereit sein, und wenn nicht, wenn die Einheimischen launisch und schräg sein sollten und ein paar englische Redewendungen radebrechen würden, wäre die Reise immerhin eine Gaudi. Zu Hause würde dann das Buch geschrieben und besprochen werden. So war es bei den Reisen und Büchern von Greenes Zeitgenossen – Evelyn Waugh, Robert Byron, Peter Fleming und anderen, deren Werke in den letzten Jahrzehnten viel gelobt, ja sogar (meiner Meinung nach) zu hoch gelobt wurden.
Reise ohne Landkarten wird selten mit diesen Büchern zusammen erwähnt, vielleicht, weil dem Buch der Humor fehlt, weil es düster ist, in einem allgemeinen Sinn politisch. Aus seiner Begeisterung für halbnackte afrikanische Frauen macht es jedoch auch keinen Hehl. Das Buch hatte eine unglückliche Publikationsgeschichte. Achtzehn Monate nach Erscheinen wurde es wegen einer drohenden Verleumdungsklage zurückgezogen. So hatte es von Beginn an keine Chance. Was Greenes Anfängertum betrifft, so scheinen mir seine Nervosität und Unerfahrenheit die Erinnerung an die Kämpfe mit den Herausforderungen geschärft zu haben, sie vielleicht auch im Rückblick vergrößert und dramatisiert; und seine Ängste steigerten seine Wahrnehmung jeder verstreichenden Stunde, sodass die Reise zu einer Art großer Saga wurde. Es ist Greenes erstes und bestes Reisebuch.
Irgendwann Anfang der 1930er Jahre kam Greene die Idee, dass er durch den afrikanischen Busch wandern müsse. Er war ein junger Mann, seit sechs Jahren verheiratet, seit einem Monat Vater eines Mädchens. Er hatte noch nie über Reisen geschrieben, was kaum überrascht – war er doch kaum je gereist. Er hatte England für Kurztrips verlassen, aber eher auf eine entspannte Art, wie für Wochenendausflüge, und war nie über die Grenzen Europas hinausgekommen. Über Afrika wusste er nichts, er hatte noch nie gecampt oder auf unbequemen Böden geschlafen oder eine längere Seereise gemacht oder eine lange Wanderung – und schon gar keinen Treck durch den Busch. Vermutlich beeinflusst von den Reisen seiner Freunde und Zeitgenossen, setzte er es sich in den Kopf, mit Trägern und Dienern durch einen unerforschten Teil des liberianischen Hinterlandes zu wandern. Er wusste nicht genau, wie viele Meilen er zurücklegen oder wie lange es dauern würde, oder wie seine Route genau verlaufen würde.
Viel merkwürdiger noch als diese Unklarheiten war jedoch Greenes Entscheidung, seine junge Cousine Barbara mitzunehmen, meiner Ansicht nach zumindest; dieser Einfall, um nicht zu sagen: diese verrückte Idee, wurde ansonsten bislang nie ernsthaft infrage gestellt. Sie war siebenundzwanzig und noch nie gereist. Sie war privilegiert aufgewachsen und hatte mit Wanderungen nicht viel am Hut. Aber Greene hatte Glück – obwohl Barbara zur feinen Gesellschaft gehörte, war sie zugleich auch ein solider Kumpel. Sie lernte schnell wandern und mit der Situation zurechtzukommen, und die Tour härtete sie ab gegenüber den Strapazen des Reisens. Wenngleich sie sich in ihrer Rolle als Mitreisende zurückhaltend verhielt – in Greenes Buch kommt sie kaum vor –, war Barbara ihm draußen auf dem Treck durchaus ebenbürtig, wenn auch vielleicht nicht beim Schreiben. Ihr eigener Bericht über die Reise, zuerst 1938 als Land Benighted erschienen und 1982 als Too Late to Turn Back (mit einer Einleitung von mir) neu aufgelegt, ist ein bescheidener, aber nützlicher Kommentar zu Greenes anspielungsreichem und manchmal etwas schwerfälligen Buch.
Warum Greene Barbara mitnahm, warum er nicht allein reiste oder sich für einen erfahrenen Mann entschied, ist eine Frage, die er in seinem Buch nicht beantwortet, aber auch in keiner der Biographien ernsthaft besprochen wird. In einer Nebenbemerkung schob es Greene einmal auf sein impulsives Wesen: zu viel Champagner bei einer Party. Man kann sich jemanden, der so sorglos, so rücksichtslos seine Begleitung für eine Reise aussucht, nur schwer vorstellen. Ein unerfahrener junger Reisender, der nicht einmal mit einem Kompass umzugehen weiß, und seine jüngere, debütierende Cousine in Afrika, mit (wie sie berichtete) einem Band von Sakis Geschichten im Gepäck, klingt eigentlich nach Satire. Oder schwärmte Greene für sie? Was Frauen betraf, konnte er ziemlich impulsiv sein. Barbara war attraktiv; Greene war Vivien schon wenige Monate nach der Hochzeit untreu. Es gab Gerüchte über eine Affäre zwischen ihm und Barbara. Dass sie in seinem Bericht nicht vorkommt, könnte Verlegenheit sein, die Reue des Ehebrechers, eine Stimmung, in die Greene mit seinen Frauengeschichten zeit seines Lebens verfiel.
Wir wissen es nicht, und wahrscheinlich ist es auch egal. Doch das Bewusstsein, dass Greene die Strapazen der Reise gemeinsam mit dieser jungen Frau durchmachte, nimmt der Geschichte viel von ihrem geheimnisvollen Nimbus. Man stelle sich Kurtz in der inneren Station mit seiner Auserkorenen an seiner Seite vor, und sofort verliert er den Nimbus des Einzelgängers, Führers, Problemlösers, geheimnisvollen Mannes – genau wie Greene in Begleitung von Barbara. Gegen Ende der Reise bekam Greene Fieber, machte sich kaum noch Notizen und hatte es eilig. »Ich erinnere mich an nichts von dem Marsch nach Zigi’s Town und auch nur an sehr wenig von den folgenden Tagen. Ich war so erschöpft, dass ich nicht mehr als ein paar Zeilen in mein Tagebuch schreiben konnte.« Um etwas über den letzten Teil der Reise zu erfahren, muss der Leser sich an Barbaras Bericht halten. Sie war nicht krank; ganz im Gegenteil, in ihrem Buch schreibt sie, dass sie auf der Reise immer kräftiger wurde, während Greene immer schwächer wurde.
Ein männlicher Begleiter hätte Greene fordern und sich über seine windigen Pläne und ständigen Improvisationen lustig machen können. Zu Beginn hatte Greene keine klare Vorstellung davon, wohin er überhaupt ging und wie er dorthin käme. Er schreibt, dass er eine nur sehr vage Vorstellung von der Reise hatte. »Ich wollte die Republik [Liberia] zu Fuß durchqueren, aber ich hatte keine Ahnung, welcher Route wir folgen oder welche Verhältnisse wir antreffen würden.« Und dennoch hielt Greene bis zum Ende durch, mit Hilfe seiner Cousine. Er gelangte ins Hinterland; er erreichte die Küste. Dass das Buch zu seinen besten gehört, liegt vielleicht daran, dass er dauernd in Not geriet und dass die Reise in mehrerlei Hinsicht die Erfüllung seiner Kindheitsphantasien war.
Später im Leben sprach Greene oft darüber, wie stark er als Kind von Abenteuergeschichten beeinflusst wurde, von Heldentaten, Piraten und Verbannten, den anschaulich geschilderten Qualen von Reisenden, Schwertkämpfern und Sündern.
Die meisten von uns lassen diese Bücher im Regal des Kinderzimmers zurück, Greene aber blieb immer fasziniert von ihrer Anschaulichkeit, ihren Themen, den klaren Moralvorstellungen, ihrem Interesse an Helden und Schurken, ihren exotischen Schauplätzen. Bevor er nach Afrika aufbrach, las er einen Bericht der britischen Regierung über Gräueltaten in Liberia, der ihn zu dem Kommentar veranlasste: »Die ganze Agonie […] rief einen wahrhaft erhabenen Eindruck hervor.« Er ist nicht schockiert – er ist begeistert; und diese Beschreibung trifft auch auf ein Buch wie, sagen wir: König Salomos Schatzkammer zu. In dem Essay »Die verlorene Kindheit« denkt Greene über dieses Buch nach und schreibt, dass es seine »unheilbare Faszination mit der Hexe Gagool mit ihrem kahlen gelben Schädel, der faltigen […] Haut einer Kobra« war, »die mich nach Afrika führte«.
Greene war ein verträumter, mitunter auch grüblerischer Junge gewesen. Seine Eltern waren so sehr in Sorge über seine düstere Zurückgezogenheit, dass er schon als Teenager eine Psychoanalyse machen musste, ein früher Patient der damals noch neuen Behandlung durch Gesprächstherapie und Traumdeutung. Reise ohne Landkarten ist voller Hinweise darauf, dass das Buch von jemandem geschrieben wurde, der schon mal auf der Couch eines Psychiaters lag. Als er über seine Angst vor Ratten und Mäusen, Faltern und anderen fliegenden Wesen schreibt (»Ich hatte dieselbe Panik vor Vögeln wie meine Mutter«), erklärt er: »Aber in Afrika konnte man ihnen ebenso wenig aus dem Weg gehen wie dem Übernatürlichen. Die Methode der Psychoanalyse besteht darin, den Patienten zu der Idee zurückzuführen, die er unterdrückt: Das ist eine lange Reise in die Vergangenheit ohne Karten, bei der man hier und da einen Hinweis findet, so wie ich von diesem Mann oder jenem den Namen eines Dorfes erfuhr, bis man dann schließlich der Idee als Ganzes ins Auge sehen muss, oder dem Schmerz oder der Erinnerung.« Seine Afrikareise, sagt er also, war eine Therapie, eine Freiluft-Konfrontation mit seinen Ängsten.
Seine Kindheit bestand aus dem eintönigen Leben (aber voller Panik vor Vögeln und Faltern) in einer unscheinbaren englischen Marktstadt, die für ihre Knabenschule und ihre Möbelproduktion bekannt war. Greene war dort, ohne es zu beabsichtigen, eine auffällige Erscheinung. Als schlaksiger schlechter Schüler an einer Schule, deren Direktor sein Vater war, zu groß gewachsen und zu mürrisch, war er ein geeignetes Opfer für Schikanen und Spott, nicht nur bei den Mitschülern, sondern auch den eigenen mit ihm rivalisierenden Geschwistern. Greene floh in die Phantasiewelt der von diesem Alltag weit entfernten, wilderen Kämpfe der Helden bei Rider Haggard, Kipling, Captain Marryat, Robert Louis Stevenson oder G.A. Henty. Er sehnte sich danach, jemand anderes und woanders zu sein – die Sehnsüchte eines Schriftstellers; und ihre Erfüllung machte Greene zu dem Schriftsteller, den wir kennen.
Für Liberia scheint er sich entschieden zu haben, weil es ein Ort war, wie er ihm in seinen frühen Lektüren begegnet war. Oder zumindest stellte er ihn sich so vor: Dschungel, Lehmhütten, Eingeborene, Medizinmänner, Gerüchte über Kannibalismus. Er reiste auf eine altmodische Art, mit Märschen auf Trampelpfaden in Begleitung einer großen Gruppe schwer beladener Träger. Als er im April 1935 nach England zurückkehrte, begann er das Buch zu schreiben. Im selben Jahr verwertete er das Liberia-Erlebnis auch für eine seiner besten Kurzgeschichten, Eine Chance für Mr. Lever. Außerdem arbeitete er noch an einem Thriller, Das Attentat. Bis zum Jahreswechsel hatte er beide Bücher fertig, 1936 sind sie erschienen.
Trotz mittelmäßiger Verkaufszahlen und der Androhung einer Verleumdungsklage sicherte die Geschichte über seine Liberia-Reise Greene den Ruhm und wurde Teil des Mythos seiner Person, gab seinem Leben eine Richtung und verankerte in der Phantasie seiner Leser das Bild dieses melancholischen und schwer greifbaren Mannes als das eines stoischen Abenteurers. Noch immer lesen die Menschen das Buch, um seine Denkweise besser zu verstehen, in dem freilich keines seiner Defizite vorkommt. Greene fand eine Umgebung und eine Art, über das Reisen zu schreiben, die sich deutlich von der seiner literarischen Zeitgenossen unterschied. Sein Buch ist bewusst voll von literarischen Anspielungen, mit vielen Verweisen und Zitaten, unter anderem von Conrad, Burton, A.E. Housman, Henry James, Celine, Baudelaire, Firbank, Santayana, Kafka, Sassoon, Saki, Milton, Thomas Paine, Samuel Butler, Walter Raleigh und aus der Bibel. Zum Thema Reiseliteratur findet man bei ihm einen Vergleich der jeweiligen Verdienste zweier Zeitgenossen, Somerset Maugham und Beverley Nichols.
Im Buch äußert er sich abfällig über die Lustreisen von Kommunisten und (eine für Greene seltsame Aussage) kommunistische Heuchelei. Und er entschied sich für die chaotischere westafrikanische Küste und nicht für die geordneten Bauernstädte in Britisch-Ostafrika. Wenngleich eine fragwürdige Behauptung, scheint es für ihn ein Lob zu sein, wenn er schreibt, dass in Liberia »die Zivilisation fünfzig Meilen hinter der Küste endete«. Er hätte mit der Vermutung recht gehabt, dass man in Ostafrika ein paar hundert Meilen von der Küste entfernt Städte finden konnte, in denen Kaffeebauern, Rinderzüchter und Polospieler lebten und es Teeplantagen und Gymkhana-Clubs gab. Und Liberia war in den Nachrichten. Es war noch nicht lange her, 1926, dass die Firma Firestone dort Millionen von Hektar Land für die Latexproduktion gepachtet hatte, zu einem Spottpreis. 1930 ergab eine Ermittlung des Völkerbundes gegen Firestone und die liberianische Regierung, dass auf den Plantagen unlautere Arbeitspraktiken, Ausbeutung, Zwangsarbeit und Sklaverei herrschten – genau jene Missstände, die Conrad in König Leopolds Kongo 1890 erlebt hatte. Diese Vorgänge hatten Greenes Aufmerksamkeit erregt.
Greene behauptete, dass die Landkarte von Liberia weitgehend leer sei, voll jener verlockenden weißen Flecken, von denen Marlow am Anfang von Herz der Finsternis spricht. Auch fünfzig Jahre später scheint Greene der Ansicht (das ganze Buch hindurch), dass ein Großteil von Liberia Terra incognita sei. Liberia war in Wirklichkeit bereits seit 1847 eine unabhängige Republik. Bis 1919 war die Landesgeschichte von anhaltenden Grenzstreitigkeiten mit den benachbarten französischen Kolonien, Französisch-Guinea und der Elfenbeinküste, geprägt. Greenes Behauptung einer leeren Landkarte scheint insofern außergewöhnlich, als für eine geographische Herausforderung wie seine Reise die genaue Kenntnis der Landkarte eigentlich die Voraussetzung wäre.
Greene behauptete auch, dass auf den amerikanischen Landkarten, die er zurate zog, an manchen Stellen das Wort »Kannibalen« gestanden habe. Solche fabelhaften Behauptungen findet man auf Landkarten Afrikas aus dem 18. Jahrhundert, für das 20. Jahrhundert ist das aber aus dem doch recht guten Grund unwahrscheinlich, dass Kannibalismus nicht praktiziert wurde, außer in den Köpfen ängstlicher Phantasten, die man normalerweise nicht mit modernen Kartographen in einen Topf wirft. Dennoch kann man sehen, worauf Greene hinauswill. Das Land ist leer, der Busch ist weglos; er ist voller Magie und Teufelstänzer und anthropophager Stämme; wir sind in l’Afrique profonde, dem »tiefsten Afrika«. Weil er so große Angst hat, betont er so stark die Gefahren. Selbst in seinem eigenen Text bezieht er sich ab und zu auf den Kannibalismus. Das ist natürlich eine Verleumdung seiner Gastgeber, aber er ist damit in guter Gesellschaft mit Conrad, in dessen vieldeutiger Erzählung über den Kongo der Kannibalismus als beharrliches Gerücht ein durchgehendes Motiv ist.
Aber auch wenn er später noch einmal für ein Jahr – ein unglückliches Jahr, wie er sagte – in Afrika leben sollte, als britischer Spion in Freetown, blieb Greene in Afrika doch im Wesentlichen ein Besucher. Er kam an, arbeitete ein bisschen als Journalist, schrieb ein paar Texte. Er romantisierte Afrika und war, wie so manch anderer leidenschaftlicher Verehrer, unkritisch. Afrika belohnte ihn, indem es ihm sein Drama, seine Uneindeutigkeit, aber selten seine Gewöhnlichkeit oder seine wahren Tugenden offenbarte – ein blühendes Familienleben und die Selbstversorgung kommen einem da in den Sinn. Greene liebte Afrika so, wie es nur ein Besucher kann – kein lange dort lebender Expatriate, kein leidgeprüfter Fremder, unbeliebter Missionar, überarbeiteter Arzt oder verachteter Lehrer.
Greene hätte es als Schriftsteller im afrikanischen Busch schwer gehabt, hätte er sich dafür entschieden, dort für längere Zeit zu leben. Seine Verzweiflung über das reale Buschleben zeigt sich in seinem Buch nur allzu deutlich. Nach der Hälfte der Reise – also nach nur vierzehn Tagen – ist er krank und kann es kaum erwarten, dass das Ganze vorbei ist. »Jetzt war alles, was ich wollte: Medikamente, ein Bad, einen Drink auf Eis und etwas anderes als diese Buschtoilette aus Bäumen und totem Laub, wo ich mich in der Dunkelheit jeden Moment auf eine Schlange setzen konnte.« Wenige Tage später: »Ich war glücklich, weil ich das Gefühl hatte, jeder Schritt bringe mich ein Stückchen weiter nach Hause«. Am siebzehnten Tag: »Mir ging alles und jeder auf die Nerven.« Kurz darauf: »Ich kam mir vor wie ein Verrückter, hier mitten in Liberia herumzusitzen […] Es war wie ein Albtraum. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, warum ich hierhergekommen war.« In seinem Tagebuch bezieht er sich in einem Eintrag in Bassa Town auf »diese dämliche Reise«, was er aber – neben weiteren und ernsteren Vorbehalten – nicht ins Buch mit aufnehmen wird. Weniger als eine Woche später ist er an der Küste, und alles nur noch eine Erinnerung.
Im Rückblick, rationalisiert auf den Buchseiten, war die Reise sowohl munterer als auch tiefgründiger, mit spannungsgeladenen Höhepunkten und so, als folge sie dem Entwurf einer Handlung – die unerwarteten Torturen dieses unvorbereiteten Reisenden. In Greenes Wahrnehmung gab genau dieser Kampf seiner Reise aber etwas Erhabenes. Er erkannte, dass das, was er erreicht hatte, einzigartig und schwierig war, und natürlich war es das auch: Der Amateur hatte es geschafft und Erfahrung gesammelt. »Ich hatte Lust zu lachen und zu brüllen und zu weinen – das war das Ende, das Ende des schlimmsten Stumpfsinns, den ich je erlebt hatte, der schlimmsten Ängste und der schlimmsten Erschöpfung.« Sein Instinkt war richtig gewesen: er musste diese Reise machen.
Gelegentlich wird behauptet, dass Greene ein besonders hervorragender Reisender gewesen sei, dass seine Reisen eindrucksvoll gewesen seien, sogar bahnbrechend. Ich sehe das überhaupt nicht. Er hatte Glück auf seinen Reisen. Er hatte ein behütetes Leben gelebt. Er war ziemlich ängstlich und manisch-depressiv, wie er selbst in seiner Autobiographie sagt. Es gab immer ein Taxi, das auf ihn wartete. Seine Leistung war, dass eine so nervöse Seele in der Lage war, solche Herausforderungen zu meistern, da er im Wesentlichen ein kultivierter Mann war, der damit prahlte, Bewegung zu verabscheuen und seine Privatsphäre und den Komfort schätzte.
Seine Ängste ließen Afrika lebendig werden – für ihn selbst, für den Leser. Der unbehagliche Reisende, der Dilettant, der Greene war (sich immer auf seine Kontakte verlassend, immer abhängig davon, dass man ihm dem Weg zeigt), neigt dazu, die Landschaft, die er durchquert, zu erfinden. Im Durcheinander seiner Vorstellung ist sie weitaus wilder als in Wirklichkeit. Es gibt in Reise ohne Landkarten mehrfach die Behauptung der Existenz von Kannibalismus. In Liberia gab es aber keine Kannibalen. An einer Stelle erwähnt er »einen Stamm, etwa eine Reisewoche entfernt, der angeblich gegenüber Fremden noch immer Kannibalismus praktizierte«, und dass er durch »das Land der Manos« reiste, »in dem der rituelle Kannibalismus nie wirklich völlig ausgemerzt worden ist«, und dass in Ganta »früher einmal […] an diesem Wasserfall Menschenopfer stattgefunden« hätten. Ähnlich unwahrscheinlich ist die Existenz von »Gegenden, wo meine Cousine und ich die ersten Weißen waren, die dort seit Menschengedenken auftauchten«, in einem Land, das wenige Jahre zuvor den großen Vertrag mit Firestone über Kautschukplantagen abgeschlossen hatte (wobei Firestone am liebsten das ganze Land besitzen wollte). Es ist die liebenswerte Selbsttäuschung eines Mannes, der eine Landschaft erfindet, von der er sich zuerst als Kind in England ein Bild gemacht hatte, mit Todesangst vor der Hexe Gagool.
Greenes Afrika lohnt einen genaueren Blick, weil so vieles davon nur in seinem Kopf existiert. Er sieht den Busch als eine feindliche Umgebung an, nicht als eine neutrale. Wenn die Ameisen und Ratten und Kakerlaken es nicht schaffen sollten, einen aufzufressen, dann wird man wahrscheinlich (so schreibt er) beim Besuch der Buschlatrine durch einen Schlangenbiss umkommen. Wobei die Schlangen auch ganz schicklich daherkommen können: »Einmal querte eine hübsche, kleine grüne Schlange den Weg, aufrecht und ohne Eile, sie schob ihre Büste stolz voran ins hohe Gras hinein und sah aus wie eine von Sargent gemalte Dame der Gesellschaft, die Gäste empfängt, Gift spritzend in aller Freundlichkeit, ein Diadem von Fabergé.«
Greenes Afrika ist ein Ort, an dem der Uneingeweihte zugrunde geht, eine dramatische Kulisse, häufig bei ihm nicht als konkrete Landschaft beschrieben, sondern als eine Atmosphäre – Hitze und Staub, Insekten und Vogelrufe; es steht für das romantische Abenteuer und die Möglichkeit der Neuerfindung. Es gibt kein Großwild in Greenes Afrika, wohl aber raubtierhafte Menschen – meist Weiße –, und es gibt Krankheit, Verrat, Ehebruch und verlorene Liebe. Politik kommt so gut wie nicht vor, und außer Deo Gratias in Ein ausgebrannter Fall und ein paar von den Trägern in Reise ohne Landkarten haben bei ihm nur wenige Afrikaner Vorfahren oder Biographien.
Als er 1942 nach Freetown zurückkehrte, um für den Geheimdienst zu arbeiten, lernte Greene Sierra Leone besser kennen. Er hielt sich aber fast nur an die Stadt. Der Roman, der aus dieser Erfahrung hervorging, Das Herz aller Dinge, spielt in der Hauptstadt an der Küste, mit Exkursionen in den Ort Pende im Busch. Afrika ist nicht Thema des Buches, sondern nur der schemenhafte Hintergrund für diesen im Wesentlichen nach innen gerichteten Roman, der sich mit Glaube und Verdammnis, mit Himmel und Hölle beschäftigt.
Der Roman Ein ausgebrannter Fall (1961) geht noch stärker in diese Richtung, Ergebnis einer weiteren afrikanischen Reise, von Greene in dem kurzen, nichtfiktionalen Buch Afrikanische Reise beschrieben. Viele Stellen in dem Roman sind direkte Transkriptionen aus seinem Notizbuch und Porträts von Menschen, die er bei seinem Aufenthalt in einem Leprakrankenhaus in Belgisch-Kongo getroffen hatte. Als der Roman erschien, hatte Greene sich bereits einen Namen als Autor über tropischen Verfall, Chaos und betrunkene Expatriates gemacht, dessen Prosa vom unbehaglichen Bewusstsein der richtenden Gegenwart des allwissenden christlichen Gottes geprägt war, wobei die Gottheit besonders in die schwülen Schlafzimmer von Greenes eigenwilligen Figuren blickte. Afrika zeichnet sich in diesen beiden Romanen drohend ab, stärker aber noch der christliche Glaube. Afrika ist die Bühne, auf der sich Ehebrecher fragen, ob sie ihre Chance auf Erlösung verspielt haben. Afrika passt zu Greene, weil es ihm ungeformt erscheint, nach Risiko und Gefahr und Krankheit klingt, eine Art Kriegsgebiet ohne Schusswechsel. Das ist die Macht Afrikas, die Leichtgläubigen zu verzaubern.
Als Greene in Afrika schließlich eine echte Rebellion mitbekam und über die Ereignisse des Mau-Mau-Aufstandes in Kenia 1953 berichtete, lagen seine Sympathien weniger bei den Rebellen als bei den britischen Bauern in den sogenannten White Highlands. Er war nicht lange genug dort, um die Ausbeutung, die politischen Ungerechtigkeiten und den grundlegenden Rassismus in der britischen Kronkolonie Kenia zu verstehen, auch wenn ihm eigentlich Gerechtigkeit ein Anliegen war und er den afrikanischen Unabhängigkeitsbestrebungen wohlwollend gegenüberstand. Greenes Afrika ist im Gegensatz zu konkreteren Umgebungen wie London, Brighton, Saigon und Port-au-Prince eine Landschaft im Geiste, eine Reihe von anschaulichen, manchmal stereotypen Bildern, die, gerade weil sie in ihrer groben Vereinfachung unseren eigenen Stereotypen entsprechen, den großen Anklang seiner Vorstellung von Afrika als zwielichtigem Ort erklären könnten. Die »tiefe Anziehungskraft« der »Zwielichtigkeit« wird in seiner liberianischen Reise angedeutet, mir scheint aber »zwielichtig« kaum mehr zu beschreiben als die heruntergekommenen Gemeinschaften von Expatriates an der Küste, weit entfernt vom Eindruck der Unendlichkeit des Buschs, der das wahre Herz Afrikas ist.
Greene war ein eingestanden sentimentaler Schwärmer, was Afrika betraf. Dieser Sentimentalität begegnet man bereits früh in seinem Werk; erstmals wird sie tatsächlich in Reise ohne Landkarten greifbar. Er erinnert sich an eine Szene in einer Bar in England, in der auch eine junge Frau am Tresen sitzt, die weint. Während er dasitzt und trinkt, geht ihm Folgendes durch den Kopf: »Aus irgendeinem Grund dachte ich selbst in diesem Augenblick an Afrika, nicht an einen bestimmten Ort, sondern an eine Kontur, eine Fremdheit, ein Wissen-Wollen. Das Unterbewusstsein ist häufig sentimental: Ich habe geschrieben: ›eine Kontur‹, und diese Kontur ist natürlich in etwa die des menschlichen Herzens.«
Ein solcher Gedanke wird einem alteingesessenen Expatriate in einem afrikanischen Land kaum kommen, er würde nie an die Karte des gesamten Kontinents denken. So jemand würde, unsentimental aus Überlebensinstinkt, bei Afrika an die kleine Stadt oder Lichtung denken, wo er arbeitet. Die Karten, an die er denken würde, wären Karten seines Distrikts, höchstens noch seiner Provinz.
Greenes Reaktion auf Afrika ist literarisch und in gewisser Hinsicht abstrakt, abgeleitet von Conrad, der, obwohl er eine klare Meinung über den belgischen Kolonialismus hatte, Afrika jenseits der Ufer des Flusses kaum kannte. Doch auf seine typisch virile und spontane Art und vielleicht als Nebeneffekt seiner Angst im Busch löst Afrika bei Greene starke Reaktionen aus.
In dieser Hinsicht war er seiner Zeit voraus, unvoreingenommen, dem Geist der Abenteuergeschichten aus seiner Kindheit treu. Mit einem Wort ist Afrika für Greene nackt. Von einigen Frauen ist er aus diesem Grund wie gebannt. Das Buch ist ein Kompendium brauner Brüste. Die ungezwungene und wohl auch unbewusste Art, wie Greene schöne Frauen kommentiert, ist eine Art Manier des Buches. Nur bei Sir Richard Burtons Berichten über Ostafrika findet man eine ähnlich große Expertise in Sachen brauner Brüste.
Auch wenn er widersprüchlich sein konnte – Reise ohne Landkarten ist ein launisches Buch, in dem der Autor seine Meinung über Afrika mehrmals ändert –, steht Afrika für Greene grundsätzlich für Leben und Hoffnung und Vitalität. Greenes Blick auf den grünen Kontinent vom Schiff aus steht in scharfem Kontrast zu dem Marlows in Herz der Finsternis, als dessen Schiff sich dem Kongo nähert, denn obwohl sie den gleichen Blickwinkel haben, kommen sie doch zu sehr unterschiedlichen Schlüssen. Marlow sah einen Kontinent, der heimgesucht, besessen, beschossen und unheimlich war; Greene sieht an der üppigen Küste einen glücklicheren Ort, »eine gewisse warme und schläfrige Schönheit«, die ihn an Baudelaires sinnlichste Gedichte erinnert.
Für Greene bedeutet Afrika auch instinktive Begeisterung, Freiheit, »das Leben, für das man geboren war«. An diesem frühen freudigen Punkt des Buches hat er seine ersten afrikanischen Frauen auf einem Markt gesehen, mit »den anmutigen Gesichtern […] der jungen wie der alten – anmutig weniger durch sexuelle Attraktivität als vielmehr in ihrer scharf voneinander geschiedenen skulpturalen Bildhaftigkeit«. Heiter erinnert er sich später, weiter unten an der Küste, an »die schicken Huren von Dakar«. Sein Blick verweilt auf einer jungen Frau, die sich dem Auto nähert, in dem er sitzt: »Ihre nackten Brüste waren klein und fest und spitz, und sie besaß die glatten runden Schenkel einer Katze.« Einige Tage später, als er auf seiner Reise ins Landesinnere aus dem Zug schaut, sieht er Frauen in einer Schlange an der Haltestelle, »ihre großen, schwarzen Nippel erinnerten an das Zentrum einer Zielscheibe«. Als er an der Grenze zwischen Liberia und Französisch-Guinea eintrifft, bleibt sein Blick an einer Frau hängen, die ihm als Verkörperung der gesamten Gegend erscheint, in der er »etwas Liebreizendes, Glückliches und Unversklavtes« zu erblicken meint, »so etwas wie das Mädchen, das an jenem Morgen den Hügel herabkam, ein Stück leuchtendes Tuch um die Hüften gewickelt, und das Sonnenlicht fiel zwischen ihre dunklen, hängenden Brüste«.
Er hatte keine Mühen gescheut, ein Treffen mit Liberias Präsident Edwin Barclay zu arrangieren, aber während des Treffens ist Greene weniger beeindruckt von dem mächtigen Mann als von einer anwesenden Frau, die »eher chinesisch als afrikanisch« aussieht. »Sie war das Schönste, was ich in ganz Liberia zu Gesicht bekam, ich konnte meine Augen nicht von ihr lassen.« In einer Buschsiedlung, die Greene »das scheußliche Dorf« nennt, beurteilt er das Dorf nach seinen Frauen und kommt zu dem Schluss: »Nur einige Frauen durchbrachen die örtliche Monotonie der Hässlichkeit […] Eines der jungen Mädchen in einem Turban und mit mandelförmigen orientalischen Augen und kleinen hübschen Brüsten entsprach selbst in seinem Schmutz dem europäischen sexuellen Geschmack.« Auf dem Umweg durch Französisch-Guinea gefallen ihm die Frauen, die den »Standards eines Landes« entsprachen, »das die bestaussehenden Huren und die elegantesten Bordelle zur Verfügung stellt« – und er beschreibt detailliert ihre Frisuren und Bemalungen.
Greenes Reaktion auf die Nacktheit der afrikanischen Frauen ist sicherlich ein Aspekt seiner Erleichterung über das Gefühl, sich gleichermaßen befreit und gefesselt zu fühlen. Afrika wirkt in diesen Situationen wie der Garten Eden. In der französischen Kolonie wird Greene später im Buch von der Tochter eines Häuptlings unterhalten, die leicht betrunken ist. Greene mustert das Mädchen: »Ihr Schenkel unter dem eng geschlungenen Tuch um ihre Hüften war wie der zarte pelzige Körper eines Kätzchens, sie hatte schöne Brüste, und sie war sauber, sehr viel sauberer als wir. Der Häuptling wollte, dass wir über Nacht blieben, und ich begann mich zu fragen, wie weit seine Gastfreundschaft reichen würde.« Selbst am Ende seiner Kräfte in Bassa Town, krank und ungeduldig, aufs Ende seiner Reise zutaumelnd, nimmt er noch wahr, wenn Frauen ihn ansehen. Mit seinem mittlerweile geschulten Auge sieht er eine Frau als Stellvertreterin einer bereits fortgeschrittenen Kultur, »einen Hinweis darauf, dass wir uns dem Rand der Zivilisation näherten, die von der Küste aus bis hierher ausgriff. Ein junges Mädchen lümmelte den ganzen Tag herum und posierte mit Beinen und Hüften auf eine anzügliche Art, wie eine Prostituierte. Sie war nackt bis zur Taille und sich dieser Nacktheit vollkommen bewusst, sie wusste, dass Brüste für den weißen Mann etwas bedeuteten, was sie für den Eingeborenen nicht bedeuteten.«
Die »Prostituierte« ist eine Ausnahme von der Gleichsetzung afrikanischer Nacktheit mit Unschuld, die Greene sonst vollzieht. Als Zuschauer bei einem Dorftanz, der nach einem scheußlichen Rigaudon klingt (»ausgemergelte alte Frauen, die sich […] auf ihre mageren Hinterteile klatschten«), ist er glücklich: »Die Freiheit Afrikas« begann »endlich«, »auf uns überzugreifen«. Im nächsten Absatz unterstreicht er noch einmal die Anziehungskraft eines Landes, das, mit einem Zitat, »noch seine Jungfräulichkeit besitzt, nie geplündert, umgegraben und geschändet wurde« und dessen »Minen nicht mit Hämmern aufgebrochen, und ihre Götterbilder nicht aus den Tempeln geraubt« worden seien. Das Zitat hat keinen Quellennachweis – ich musste einen gelehrten Freund fragen, von wem es sein könnte, es ist von Sir Walter Raleigh –, aber die Aussage könnte klarer nicht sein. Die Reise währt erst so kurz (etwa zehn Tage), dass Greene noch von der Vorstellung von Afrika als unbefleckt fasziniert ist. Er glaubt, er sei tief in das Land eingedrungen. Er stellt sich vor, dass er jungfräulichen Boden betritt, und »so viel Jungfräulichkeit gibt es nicht auf der Welt, als dass man es sich leisten könnte, sie nicht zu lieben, wenn man sie findet.«
Das ist kein abschließendes Urteil. Später, entmutigt und krank, gesteht er, dass er Liberia als höllisch empfindet und das Ende der Reise kaum erwarten kann. Er hasste die beiden letzten Wochen und war froh, als alles vorbei war. Das Buch ist also widersprüchlich, aber die Widersprüche sind wahrhaftige Spiegelungen der verschiedenen Stimmungen Greenes während seiner Reise. Gewissenhaft dramatisiert er alle ihre emotionalen Phasen, von der Besorgtheit über die Angst zu Bezauberung und Romantik bis zur Desillusionierung und wieder zurück (beim Nachdenken in Ruhe) zur Faszination.
Heute, siebzig Jahre später, ist Liberia gefährlicher als damals, als Greene es mit seiner Cousine durchquerte, angewiesen auf die Freundlichkeit Fremder und auf Gastfreundschaft. Seit Jahrzehnten hat sich das politische System Liberias, geprägt von Vetternwirtschaft, Korruption und Gönnerschaft, Homburger Hüten und dreiteiligen Anzügen, kaum verändert. Als Präsident William Tubman, der im Wesentlichen wie Barcley mit Unterstützung der USA regierte, eines natürlichen Todes starb, wurde William Tolbert sein Nachfolger. Nach neun Jahren an der Regierung wurde er von einem jungen Soldaten, Samuel Doe, gestürzt, der dann als Militärdiktator ein Schreckensregime führte. Auch Doe wurde gestürzt, in der Gefangenschaft wurden ihm die Ohren abgeschnitten, und er wurde brutal getötet. Nach ein paar Jahren musste sein Mörder, Prince Yormie Johnson, der nicht sein Nachfolger als Präsident geworden war, ins Exil nach Nigeria fliehen.
Das Land litt unter bewaffneten Banden, Kindersoldaten und selbsternannten Führern. 2005 hatte Liberia eine Übergangsregierung, die Parlamentswahlen für 2006 angekündigt hat, aber das Land war weiterhin (wie zu Greenes Zeiten) eines der ärmsten Länder Afrikas. Es gibt Straßen (wenn auch holprige), wo zu Greenes Zeiten Buschpfade waren. Man kann seine Route auf einer modernen Landkarte nachverfolgen. Freiwillige des Peace Corps betreiben die Schulen in einigen der von Greene erwähnten Siedlungen – zum Beispiel Tapeta (Tapee-Ta), wo er und seine Cousine einen »viktorianischen Sonntag« verbrachten und Colonel Elwood Davis (»Diktator von Grand Bassa«) trafen. Liberia bleibt auch in seiner Notlage ein Bollwerk des Kautschukimperiums von Firestone und eine anhaltende Quelle illegal geschürfter Diamanten.
Greene kehrte nie nach Liberia zurück. Seine Reise war für ihn, wie viele schwierige Reisen, im Rückblick nichts als herrlich. Und doch machte sie ihn auch zu einem ambitionierteren Reisenden. Wenige Jahre später war er in Mexiko, auf dem Rücken eines Maultiers reitend, woraus Gesetzlose Straßen (1938) hervorging. Er erkundete weitere Teile Afrikas und andere äquatornahe Orte in Südostasien, der Karibik und Lateinamerika. Er entwickelte einen Instinkt für konfliktträchtige Länder mit atemberaubenden Landschaften und schönen Frauen (die genau zu mustern er nie aufhörte). Mit über siebzig schrieb er am vierzigsten Jahrestag der Reise an Barbara: »Für mich war diese Reise sehr wichtig – mit ihr begann eine Liebe zu Afrika, die nie ganz aufgehört hat […] Überhaupt eine Reise, die mein Leben veränderte.«