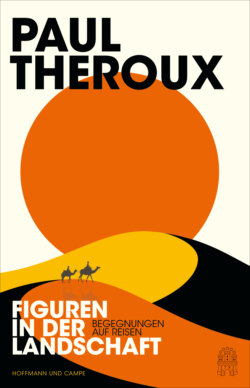Читать книгу Figuren in der Landschaft - Paul Theroux - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Liz in Neverland
ОглавлениеEs sagt einiges über Elizabeth Taylors vielkritisierte Stimme, dass ich sie trotz des lauten Rat-Tat-Tat des Hubschraubers klar hören konnte, als wir von Michael Jacksons Neverland-Ranch in den Sonnenuntergang abhoben. Mädchenhaft, flehend, schrill, durch das Titan der Rotorblätter schneidend, und ihren Hund fest im Arm, einen Malteser namens Sugar, rief sie: »Paul, sagen Sie dem Piloten, dass er eine Schleife fliegen soll, damit wir die ganze Ranch sehen können!«
Neverland, diese Spielzeugwildnis voller Fahrgeschäfte, Puppenhäuser, Zootiere und Lustgärten, entfernte sich langsam unter uns, als Elizabeth, wie es ihre Art ist, mehr wollte.
Ich musste ihre Bitte gar nicht an den Piloten weitergeben, er hatte sie – obwohl er Kopfhörer aufhatte – auch so gehört. Er flog uns hoch in den pfirsichfarbenen Sonnenuntergang, von wo aus Neverland noch spielzeughafter aussah: Unmengen blinkender Lichter, die völlig sinnlos schienen, da (außer den Sicherheitsleuten) weit und breit keine Menschen zu sehen waren, nur das Reptilienhaus mit den scheibenförmigen Fröschen und fetten Pythons, in dem sowohl eine Kobra als auch eine Klapperschlange ihre Zähne gegen die Scheibe geschlagen hatten beim Versuch, mich zu beißen; das Affenheiligtum, wo AJ, der große struppige Schimpanse mit dem schaufelartigen Mund, mir ins Gesicht gespuckt hatte und Patrick, der Orang-Utan, mir die Hand verdrehen wollte; die scheuen Giraffen, die spuckenden Lamas, die aggressiven Schwäne auf dem Teich, Gypsy, der mürrische, fünftausend Pfund schwere Elefant, den Elizabeth Michael geschenkt hatte; die leeren Fahrgeschäfte im Vergnügungspark – die Schiffschaukel, der Neverland-Autoscooter, das Neverland-Karussell, das in Endlosschleife Michaels Lied »Childhood« (»Has anyone seen my childhood?«) spielte; der große, hell erleuchtete Bahnhof; die Rasenflächen und Blumenbeete, in denen als große graue Felsbrocken getarnte Lautsprecher lagen, die das Tal mit Showmelodien beschallten, einer unaufhörlichen Fahrstuhlmusik, die das Zwitschern der wild lebenden Vögel übertönte. Im Zentrum des Ganzen lief auf einem Videowürfel, so groß wie die Leinwand eines Autokinos, ein Zeichentrickfilm, in dem zwei Wesen mit irren Gesichtern sich erbarmungswürdig anquakten. Das alles hell leuchtend in der wolkenlosen Dämmerung, ohne dass auch nur eine einzige Menschenseele zusah.
»Da ist der Gartenpavillon, in dem Larry und ich uns das Jawort gegeben haben«, sagte Elizabeth mit einem ironischen Kopfschütteln. Sugar blinzelte durch seine hübsch gekämmten Ponyfransen, die Elizabeths eigenem schönen weißen Haar gar nicht so unähnlich waren. »Ist der Bahnhof nicht entzückend? Da drüben picknicken Michael und ich immer«, sagte sie und deutete in Richtung einer Baumgruppe auf einem Felsen. »Können wir die Runde noch mal drehen?«
Elizabeth ist am elizabethanischsten, wenn sie mehr will. Und so überflogen wir noch einmal langsam die langgezogene Senke des Neverland-Tals, die gesamten elf Quadratkilometer, während die Schatten vom rosa-goldenen Leuchten des Himmels immer länger wur- den.
»Das Neverland-Kino … Blumen … Michael liebt Blumen«, sagte Elizabeth. »Schauen Sie mal die Schwäne auf dem Teich! Hui!«
Wenn man Schwäne wie diese hat, braucht man keine Rottweiler mehr, dachte ich. Obwohl es seit Monaten nicht geregnet hatte, waren die vielen Hektar Rasenflächen, bewässert durch eine unterirdische Sprinkleranlage, von einem satten Grün. Miniatursoldaten gleich sah man auf dem Gelände hier und da Sicherheitsleute, manche zu Fuß, manche in Golfwagen, manche strammstehend als Wachposten, Neverland ist nämlich auch eine Festung.
»Können wir bitte noch eine Runde drehen, nur noch eine?«, fragte Elizabeth.
»Wofür ist der Bahnhof da?«, fragte ich.
»Die kranken Kinder.«
»Und die ganzen Vergnügungen?«
»Die kranken Kinder.«
»Sehen Sie mal, die vielen Zelte.« Ich hatte die Ansammlung großer Tipis, verborgen im Wald, bis dahin gar nicht gesehen.
»Das ist das Indianerdorf. Die kranken Kinder lieben es dort.«
Aus der Höhe sah ich noch einmal, dass dieses Tal der aufwändig wiedereroberten Kindheit überfüllt war von Statuen. Die Schotterstraßen und Golfwagenpfade wurden von kleinen hübschen Statuen von Flötenspielern gesäumt, von Gruppen dankbar grinsender Kinder, Trauben von sich an den Händen haltenden Zwergen, manche mit Banjos, andere mit Angelruten. Außerdem gab es große Bronzestatuen, wie die von Merkur (dem Gott des Handels und der Kaufleute) in der Mitte der kreisförmigen Auffahrt vor Neverlands Haupthaus mit seinen dunklen Schindeln und Kreuzstockfenstern, eine fast zehn Meter hohe Figur, mit Flügelhelm und Hermesstab und allem Drum und Dran, auf einer Zehenspitze balancierend, die letzten Strahlen des sirupfarbenen Sonnenuntergangs auf den großen Bronzegesäßbacken, was seinen Hintern wie einen gebutterten Muffin aussehen ließ.
Das nächste Tal hingegen, das wir überflogen, war voller Kühe. Wir ließen sie unter uns zurück und drehten auf die ausgedehnten Vororte Santa Barbaras zu.
»Sagen Sie dem Piloten, dass wir weiter runter wollen! Tiefer!«
Es war jetzt eine noch mal andere Stimme, noch jünger, das Bitte mehr! war jetzt das Quietschen eines kleinen Mädchens. Der Pilot hatte es verstanden und hob den Daumen. Er flog uns am Stadtzentrum Santa Barbaras vorbei und die Küste entlang, nur knapp über den sich brechenden Wellen.
Elizabeth schrie mit ihrer schrillen kleinen Stimme: »Hui! Wir streifen die Wellen! Wie der Wind! Huiii!«
Die Wellen brachen sich als dicke weiße Nackenrollen, einen halben Meter unter den Kufen des Hubschraubers flogen die Schaumfetzen. Nicht weit entfernt lagen die Surfer am berühmten Surfspot Rincon auf ihren Brettern und winkten uns zu. Pelikane flogen erschrocken auf, als wir uns näherten, und sie sahen genauso filmisch und unfassbar aus wie Neverland mit seinen Zeichentrickfilmen auf dem Videowürfel, seinen Statuen und Schwänen und seiner unaufhörlich lärmenden Musik.
Unsere Nähe zur Meeresoberfläche verstärkte das Geräusch der Rotorblätter, aber Elizabeth war, vom Lärm unbeeindruckt, weiter in Redelaune. Sie lehnte sich vor und schrie mir ins Ohr: »Haben Sie so was schon mal gemacht?«
»In Vietnam!«, rief ich.
»Nein – ich meine hier!« Sie wirkte verärgert, als hätte ich ihr absichtlich widersprochen. »Manchmal bekommen wir Wasser ab. Wir fliegen manchmal so tief, dass wir nass werden! Hui!«
Der Hubschrauber flog an Ventura vorbei, bis wir in Richtung Festland abdrehten und über Erdbeerfelder und Obstbäume in den dunklen Himmel nach Osten flogen, zum Van-Nuys-Flughafen, wo bereits eine Limousine wartete.
Elizabeth blickte aber zurück Richtung Westen, in den Himmel mit seinem schwindenden Licht.
»Wie ein Nocturne von Whistler«, sagte sie ruhig. Die Mädchenstimme war verschwunden. Der Ton war jetzt ein ganz anderer, nachdenklich, erwachsen, ein wenig traurig, mit der typisch elizabethanischen Koloratur, dem Ergebnis von jahrzehntelangem Hedonismus. Mich beeindruckte auch die Präzision ihrer Bemerkung über den Himmel, der wirklich genau wie bei Whistler aussah, mit Lichtklecksen und den Schatten im Zwielicht über der Gegend, wo Neverland lag.
»Sie sind also Wendy, und Michael ist Peter?«, hatte ich sie einen Monat zuvor in ihrem Haus in Bel Air gefragt.
»Ja. Ja. Es gibt eine Art von Magie zwischen uns.«
»Magie« klang in dieser Umgebung etwas merkwürdig. Wenn sie aufrecht dastand, mit ihrem beeindruckenden Kopf und dem ebenmäßigen Gesicht auf dem kleinen, viel zerbrechlicheren Körper, sah sie aus wie eine entlaufene Schachfigur. Sie ist kaum eins sechzig groß. Rückenprobleme, drei Hüftoperationen, ein Hirntumor, ein gebrochener Knöchel, »und ich bin siebzehnmal gestürzt – ich war wie ›Die fliegende Nonne‹!« Das alles allein in den letzten paar Jahren hat ihr einen beschwerlichen Gang verliehen, leicht seitwärts, und auch der erinnerte an die eigentümlichen Züge einer Schachfigur.
Elizabeth saß auf der Couch, auf Kissen gebettet zur Entlastung des Rückens, und trank Wasser. Ihre Füße stemmte sie in dünnen Hausschuhen gegen einen Couchtisch, auf dem verstreut unzählige Meteoriten herumlagen (oder waren es Geoden?), mindestens vierzig, in deren Innern lila Kristalle funkelten. An der Wand hinter Elizabeth reihte sich Meisterwerk an Meisterwerk, van Gogh presste sich an Monet, Rouault an Mary Cassatt, Matisse hing über Modigliani und drei Utrillos eng beieinander, und neben der Tiffanylampe und dem Tisch aus geschliffenem Glas und Kristall lag schließlich noch ein Diamant in der Größe einer Kokosnuss. »Von Michael«, erklärte sie mir später. »Er meinte, er wolle mir den größten Diamanten der Welt schenken. Es ist ein Kristall – toll, oder? Kommen Sie, heben Sie ihn mal hoch!« Er muss um die zehn Kilo gewogen haben. Die Strahlen des sich in ihm brechenden Lichts fielen auf den Frans Hals über dem Kamin, auf dessen Sims ein paar bronzene Pferdeskulpturen von Liza Todd standen. Picasso hing über dem Aquarium. Der Teppich war weiß, vom gleichen Weiß wie Elizabeths Haar, Sugars Fell, ihre Hausschuhe und die meisten ihrer Möbel. Nebenan war das Trophäenzimmer, im Flur das Michael-Jackson-Porträt (»Für meine wahre Liebe Elizabeth – ich werde Dich immer lieben, Michael«) und ein Hockney, in der Bibliothek zwei Warhols – einer davon ein Siebdruckporträt von Elizabeth –, und vier Augustus Johns auf dem Klo.
Es war später Nachmittag. Elizabeth, Nachtmensch und eine notorisch schlechte Schläferin, war erst kurz zuvor aus dem Bett aufgestanden, wo sie das Album Romanza des italienischen Sängers Andrea Bocelli gehört hatte. Ein für sie zu jener Zeit ganz normaler Tag: irgendwann am Nachmittag aufstehen, viel Musik hören, bisschen fernsehen, ums Haus gehen, ein Gespräch mit mir. Für später gab es eine Verabredung, aber nichts Besonderes. Rod Steiger sollte vorbeikommen. Seit eineinhalb Jahren holt er Elizabeth in seinem kleinen Honda ab und geht mit ihr Burger oder Brathähnchen essen.
»Ich hatte fast vier Jahre lang Agoraphobie«, sagte sie. Medizinische Fachausdrücke gehen ihr leicht über die Zunge. »Ich habe das Haus nicht verlassen, auch das Bett kaum. Rod Steiger hat mich rausgeholt. Er sagte, ich sei depressiv. Dann habe ich angefangen, ihn zu treffen.«
»Treffen« ist ein unerträglich unklares Wort. Neben Rod Steiger, der jede romantische Beziehung zu ihr verneint, trifft sie zurzeit auch noch einen anderen Mann, Cary Schwartz, einen Zahnarzt aus Beverly Hills, Mitte fünfzig, der sie an ihrem Geburtstag im Hotel Bellagio in Las Vegas mit seinen zwei erwachsenen Söhnen begleitete, und José Eber, ihren Friseur, und Dr. Arnie Klein – Michael Jacksons Dermatologen – und Michael Jackson selbst. Sowohl Dr. Klein als auch José haben mir das Erinnerungsfoto vom Geburtstag gezeigt, alle strahlend am Restauranttisch vereint, während Michael Jackson mit blendend kreideweißer Haut Elizabeth sein Geschenk überreicht, eine juwelenbesetzte Elefantenskulptur von der Größe eines Footballs. Inspiriert dazu hatte ihn der große, echte, trompetende Elefant Gypsy, den sie ihm geschenkt hatte.
Die Freundschaft mit Michael Jackson ist ihr offensichtlich sehr wichtig, aber angesichts ihres turbulenten Lebens, so unwahrscheinlich es klingen mag, als solche zunächst nichts Ungewöhnliches.
»Mir sind in meinem Leben Sachen passiert, die die Leute nicht glauben würden«, sagte sie, als sie darüber sprach, wie unerträglich sie es fände, über ihre Vergangenheit nachdenken zu müssen, und dass sie niemals eine Autobiographie schreiben könnte. »Weil einiges so schmerzhaft war, dass ich es nicht noch einmal durchleben wollte. Was auch einer der Gründe dafür ist, warum ich Psychiater immer gemieden habe. Ich könnte zu einigen Erfahrungen nicht zurückgehen und alles noch einmal ganz durchleben. Ich glaube, ich würde den Verstand verlieren.«
Ein Schriftsteller sitzt jahrelang am Schreibtisch, phantasiert, erfindet ganze Lebensläufe, mit mehreren Ehen und Vermögen und furchtbaren Unfällen – eine erschöpfende, aber doch ziemlich geordnete, risikofreie Beschäftigung, für die es lediglich Stift und Papier braucht. Elizabeth Taylor aber hat – fleischgewordene Phantasie – ihre Wünsche immer ausgelebt, als eine Reihe sich überschneidender Leben, mit einer Besetzung von mehreren Tausend Darstellern. Aber Begriffe wie »ein pralles Leben« reichen nicht hin: sie ist sogar schon, so behauptet sie, gestorben.
»Ich ging durch einen Tunnel«, erzählte sie mir, als sie über ihren Luftröhrenschnitt im Jahr 1959 sprach, bei dem sie für tot erklärt wurde. »Ich sah das weiße Licht, und es sagte zu mir: ›Du musst zurück.‹ Es ist wirklich so passiert. Ich habe nie darüber geredet, weil ich von so was noch nie gehört hatte und dachte: Das ist eine Folge von Looney Tunes!«
Sie sagt offen, dass sie das Gegenteil eines nachdenklichen, reflexiven Menschen sei. Vielleicht ist dieser Mangel an Selbstreflexion, ihr Unwille, in die Vergangenheit zu blicken, zugleich auch die Voraussetzung für ihren Optimismus.
Als Mrs. Larry Fortensky musste sie, so räumt sie ein, die Zähne zusammenbeißen, um mit ihrem Mann zu einem Eheberater zu gehen. »Ich dachte dann aber: Warum nicht? Alles ausprobieren.«
Nun war es aber so, dass Larry den Berater kannte – und sogar schon vorher bei ihm gewesen war, während einer seiner oder beider vorherigen Ehen. »Sie redeten miteinander auf eine Art, die so was wie ein Code wurde. Ich fühlte mich außen vor. Aber wir haben es gemacht. Sind ins Auto gestiegen und hin. Und dann haben wir bis zum nächsten Termin nicht mehr miteinander gesprochen.«
Worauf sie in Gelächter ausbrach, mit einer eigentümlichen Art fröhlichen Spotts über sich selbst, der sie so sympathisch macht. Dieses fatalistische Lachen auf eigene Kosten kommt bei ihr immer nach der Erwähnung absurder Katastrophen – Ehekatastrophen, Krankheiten, Unfällen oder eben der Auferstanden-von-den-Toten-Geschichte. Es beruhigt einen. Der Subtext ist: »Ich muss verrückt sein!« Zugleich ist es auch eine Übersprungshandlung, da, so sagt sie, das Mitleid oder Bedauern anderer sie völlig wehrlos in Tränen ausbrechen ließe.
Was als Freundschaft mit Michael Jackson begann, hat sich zu einer Art Fall entwickelt, in dem sie seine einzige Verteidigerin geworden zu sein scheint.
»Wie stehen Sie zu seiner« – ich suchte nach einem Wort – »Exzentrizität? Empfinden Sie sie als problematisch?«
»Er ist magisch. Und ich glaube, dass alle wirklich magischen Menschen diese echte Exzentrizität haben müssen.« In ihrem Bewusstsein gibt es tatsächlich kein einziges Atom, das auch nur den leisesten negativen Gedanken zu Jacko zulassen würde. »Er ist einer der liebevollsten, süßesten, wahrhaftigsten Menschen, die ich je geliebt habe. Er ist ein Teil meines Herzens. Und wir würden alles füreinander tun.«
Diese vehemente Wendy, die als Jugendliche bereits reich und weltberühmt war und ihre Familie seit ihrem neunten Lebensjahr ernährte, konnte sich, so erzählt sie, leicht in Michael einfühlen, auch er ein Kinderstar, dem man seine Kindheit geraubt hatte, brutal behandelt von seinem Vater. In Neverland gibt es eine Dampfmaschine namens »Katherine« und eine »Katherine-Straße«; keine »Joseph-Straße« und auch sonst trägt dort nichts den Namen seines Vaters.
Außerdem hatte Michael, ein obsessiver Ikonograph, bereits jahrelang Bilder von Elizabeth Taylor gesammelt, so wie auch von Diana Ross, Marilyn Monroe und Charlie Chaplin – und im Übrigen auch von Micky Maus und Peter Pan, denen allen er über die Jahre seines Lebens, das eigentlich eher einer Metamorphose gleicht, ähnlich geworden ist. Es wird Michael auch aufgefallen sein, dass Elizabeth während der sechzig Jahre ihres Ruhms ähnliche Veränderungen durchlaufen hat. Das reizende kleine Mädchen hat sich kompromisslos von Velvet Brown in Frau Feuerstein verwandelt, über die Zwischenstationen Cleopatra und die Frau aus Bath. Jeder Film (es gibt fünfundfünfzig, plus neun Fernsehfilme), jede Ehe (acht), jede Liebesaffäre (ungefähr zwanzig sind dokumentiert) hat ein neues Gesicht und eine neue Figur hervorgebracht, ein neues Bild, während die Frau dahinter dieselbe blieb: freimütig, lustig, ehrlich, impulsiv, neugierig (»Ich probiere alles«), weltzugewandt, risikofreudig und mit einem noch immer unstillbaren Hunger auf mehr.
Als Michael ihr völlig aus dem Nichts (sie waren sich noch nie begegnet) Karten für eines seiner Thriller-Konzerte im Dodger Stadium anbot, griff sie zu – und sicherte sich vierzehn Tickets. Das Datum war vielversprechend: der 27. Februar, ihr Geburtstag und der ihres Sohnes. Sie bekamen aber Plätze in einer VIP-Lounge hinter einer Glasscheibe, weit entfernt von der Bühne. »Man hätte es genauso gut im Fernsehen schauen können.« Mit dem Versprechen, eine Videoaufnahme des Konzerts zu besorgen, nahm sie ihre große Entourage mit zu sich nach Hause.
»Michael rief am nächsten Tag unter Tränen an und sagte: ›Es tut mir so leid. Ich fühle mich schrecklich.‹« Sie kamen ins Gespräch und redeten zwei Stunden. »Und dann telefonierten wir jeden Tag.« Es vergingen Wochen mit diesen Gesprächen, Monate. »Wir haben uns im Grunde am Telefon kennengelernt, drei Monate lang.«
Eines Tages schlug Michael vor, dass er vorbeikommen könne, Elizabeth nahm den Vorschlag gern an. Michael fragte: »Kann ich meinen Schimpansen mitbringen?«, und Elizabeth sagte: »Ja klar, ich liebe Tiere.« Und so kam Michael Hand in Hand mit seinem Schimpansen, Bubbles.
»Seitdem sind wir unzertrennlich«, sagte Elizabeth. »Ich hätte eigentlich auf diese Reise nach Südafrika mitkommen sollen.«
»Um Präsident Mandela zu treffen?«
»Ich nenne ihn Nelson«, sagte Elizabeth. »Er hat mich darum gebeten. Nelson rief mich an und bat mich, Michael zu begleiten. Wir telefonieren manchmal. ›Hi, Nelson!‹ Hahaha!«
»Triffst du dich oft mit Michael?«
»Öfter, als die Leute denken – öfter, als ich selbst denke«, sagte sie. Sie gehen verkleidet ins Kino in Westwood und anderswo, setzen sich in die letzte Reihe und halten Händchen. Bevor ich da nachsetzen konnte, sagte sie: »Alles an Michael ist wahrhaftig. Und er hat so etwas Liebes und Kindliches – nicht Kindisches, Kindliches –, das wir beide teilen und empfinden.«
Sie sagte das im bewundernden Tonfall der kleinen Wendy, aber in dieser scheinbar süßen Art liegt auch etwas von einem besitzergreifenden Kind, etwas Trotziges, fast Despotisches.
»Ich liebe ihn. Er trägt eine Verletzbarkeit in sich, die ihn mir noch mehr ans Herz wachsen lässt«, sagte sie. »Wir haben so viel Spaß zusammen. Einfach beim Spielen.«
»Ja, wir versuchen, in Phanatasiewelten zu entkommen«, erzählte mir Michael Jackson. »Wir machen tolle Picknicks. Es ist so schön, mit ihr zusammen zu sein. Ich kann mich mit ihr wirklich entspannen, weil wir das gleiche Leben hatten und die gleichen Erfahrungen gemacht haben.«
»Welche sind das?«
»Die große Tragödie der Kinderstars. Und uns gefallen die gleichen Sachen. Zirkus. Vergnügungsparks. Tiere.«
Er hatte mich zu einer vorher genau ausgemachten Zeit angerufen. Ohne jedes zwischengeschaltete Sekretariat mit Ansagen wie »Mr. Jackson ist jetzt am Apparat«. Die Boulevardblätter hatten diese Woche Überschriften wie JACKO SUIZIDGEFÄHRDET UNTER STÄNDIGER BEOBACHTUNG, JACKO IN DER KLAPSMÜHLE, und, mit einer südafrikanischen Datums- und Ortsangabe, DER KING OF POP WACKO JACKO BEIM GLEITSCHIRMFLIEGEN MIT 13-JÄHRIGEM JUNGEN. Tatsächlich war er in New York City, wo er gerade ein neues Album aufnahm.
Mein Telefon klingelte, ich nahm ab, und er sagte: »Hier ist Michael Jackson.« Die Stimme war gehaucht, hell, jungenhaft – zögerlich, dabei aber zittrig beflissen und hilfsbereit. Das betraf aber nur den singenden Tonfall, die Substanz war fester, wie die Stimme eines blinden Kindes, das klare Richtungsanweisungen in der Dunkelheit gibt.
»Wie würden Sie Elizabeth beschreiben?«, fragte ich ihn.
»Sie ist eine warme, kuschlige Decke, in die ich mich gern schmiege und einwickle. Ich kann mich ihr anvertrauen und ihr vertrauen. In meinem Beruf kann man niemandem vertrauen.«
»Wieso?«
»Weil du nie weißt, wer wirklich dein Freund ist. Wenn man so berühmt ist und so viele Leute um sich hat. Man ist völlig isoliert dabei. Erfolg zu haben bedeutet, ein Gefangener zu werden. Du kannst nicht mehr ausgehen und normale Sachen machen. Die Leute beobachten die ganze Zeit, was du tust.«
»Haben Sie das schon so erlebt?«
»Ja, oft. Sie versuchen herauszufinden, was du liest und was du kaufst. Sie wollen alles wissen. Draußen sind immer Paparazzi. Sie nehmen mir meine Privatsphäre. Sie verdrehen die Realität. Sie sind mein Albtraum. Elizabeth ist jemand, der mich liebt – wirklich liebt.«
»Ich habe sie gefragt, ob Sie beide wie Wendy und Peter sind.«
»Aber Elizabeth ist auch wie eine Mutter – und mehr. Sie ist eine Freundin. Sie ist Mutter Teresa, Prinzessin Diana, die Königin von England und Wendy.«
Er kam noch mal auf das Thema Berühmtheit und Isolation zurück. »Sie bringt Leute dazu, merkwürdige Dinge zu tun. Viele unserer Stars sind wie berauscht vom Ruhm – sie können damit nicht umgehen. Nach einem Konzert ist der Adrenalinspiegel in einer anderen Sphäre. Man kann nicht schlafen. Es ist zwei Uhr morgens, und man ist hellwach. Wenn du von der Bühne kommst, schwebst du.«
»Und wie gehen Sie damit um?«
»Ich schaue Zeichentrickfilme. Ich liebe Zeichentrick. Ich spiele Videospiele. Manchmal lese ich.«
»Sie lesen Bücher?«
»Ja. Ich mag Kurzgeschichten und so.«
»Ganz bestimmte?«
»Somerset Maugham«, sagte er prompt, dann, mit einer Pause nach jedem Namen, »Whitman. Hemingway. Twain.«
»Und was für Videospiele?«
»Ich mag X-Men. Pinball. Jurassic Park. Solche mit Kampfsport – Mortal Kombat.«
»Ich habe ein paar Videospiele in Neverland gespielt. Es gab ein besonders tolles namens Beast Buster.«
»Ah, ja, das ist großartig. Ich suche alle Spiele selbst aus. Beast Buster ist allerdings vielleicht etwas zu gewalttätig. Ich nehme meistens ein paar mit auf Tournee.«
»Wie geht das? Die Videospielautomaten sind ziemlich groß, oder?«
»Wir reisen immer mit zwei Frachtflugzeugen.«
»Verstehe. Haben Sie Lieder geschrieben, bei denen Sie Elizabeth im Kopf hatten?«
»Childhood.«
»Ist das das Lied mit der Zeile: ›Has anyone seen my childhood?‹«
»Ja. Es geht so«, worauf er mit singender Stimme zu zitieren anfing: »Before you judge me, try to …« Es folgten noch die nächsten sechs Verse.
»Ist das nicht das Lied vom Karussell in Neverland?«
»Doch! Doch!«, sagte er begeistert.
Dann sprachen wir über die berühmte Hochzeit in Neverland und über Larry, von dem Michael sagte, dass er ihn mochte. Über Elizabeth als Inspirationsquelle und ihre gemeinsame Freundin Carole Bayer Sager, die einige Lieder des Albums Off the Wall geschrieben hatte. Über die Kindheit, wie Elizabeth als kleines Mädchen ihre Familie ernährte.
»Ich habe das auch gemacht. Ich war auch ein Kind, das seine Familie ernährte. Mein Vater verwaltete das Geld. Ein Teil wurde für mich für später zurückgelegt, aber das meiste von dem Geld ging an die ganze Familie. Ich habe einfach die ganze Zeit gearbeitet.«
»Dann hatten Sie also gar keine Kindheit – Sie haben sie verloren. Wenn Sie noch einmal anfangen könnten, was würden Sie anders wollen?«
»Obwohl ich viel verpasst habe, würde ich gar nichts ändern.«
»Ich höre Ihre kleinen Kinder im Hintergrund.« Das Glucksen war immer lauter geworden, wie Wasserwirbel in einem Abfluss. »Wie würden Sie reagieren, wenn die auch einmal auf der Bühne stehen und das Leben führen wollten, das Sie geführt haben?«
»Sie können tun, was sie wollen. Wenn sie das machen wollen, dann ist das okay.«
»Was wollen Sie bei ihrer Erziehung anders machen als bei Ihrer eigenen?«
»Sie sollen mehr Spaß haben. Mehr Liebe bekommen. Nicht so isoliert leben.«
»Elizabeth sagt, sie finde es schmerzhaft, auf ihr Leben zurückzublicken. Fällt Ihnen das auch schwer?«
»Nein, nicht im Sinne einer Gesamtsicht auf das eigene Leben, wenn man von den einzelnen Momenten absieht.«
Die etwas verklausulierte und fast gelehrt klingende Ausdrucksweise überraschte mich – eine weitere Michael-Jackson-Überraschung. Ich hatte schon bei »wie berauscht« gestutzt und bei der »anderen Sphäre«, und jetzt auch bei »im Sinne«. »Ich bin nicht ganz sicher, dass ich verstehe, was Sie mit ›Gesamtsicht‹ meinen.«
»Die Kindheit zum Beispiel. Ich kann auf sie als Gesamtheit blicken. Den Bogen meiner Kindheit.«
»Aber es gibt doch irgendwann in der Kindheit einen Moment, wo man sich besonders verletzlich fühlt. Haben Sie so etwas empfunden? Elizabeth sagte, sie habe sich gefühlt, als gehöre sie der Filmfirma.«
»Manchmal mussten wir mitten in der Nacht los für einen Auftritt – das konnte auch drei Uhr morgens sein. Unser Vater zwang uns dazu, er weckte uns. Ich war sieben oder acht. Manchmal spielten wir in Clubs, manchmal bei Privatpartys bei Leuten zu Hause. Wir mussten auftreten.« In Chicago, New York, Indiana, Philadelphia, fügte er hinzu – im ganzen Land. »Ich lag im Bett und schlief und hörte dann meinen Vater. ›Aufstehen! Wir haben einen Auftritt!‹«
»Aber wenn Sie dann auf der Bühne waren, war das nicht auch aufregend?«
»Ja. Ich habe es geliebt, auf der Bühne zu stehen. Ich habe die Auftritte geliebt.«
»Und wie erlebten Sie die andere Seite dieses Business? War das komisch für Sie, wenn jemand nach der Show zu Ihnen kam und Sie ansprach?«
»Ich mochte das nicht. Ich habe den direkten Kontakt mit Menschen noch nie gemocht. Auch heute ist das noch so, ich hasse es, nach dem Konzert Leute treffen zu müssen. Ich werde schüchtern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
»Aber Sie haben Oprah ein Interview gegeben.«
»Das war hart, mit Oprah. Weil es im Fernsehen war – und Fernsehen beherrsche ich überhaupt nicht. Ich weiß, dass alle zusehen und über mich urteilen. Das ist wirklich schwierig.«
»Ist das ein Gefühl, das Sie erst in jüngerer Zeit haben, so genau beobachtet zu werden?«
»Nein«, sagte er entschieden, »ich habe das immer schon so empfunden.«
»Auch, als Sie sieben oder acht waren?«
»Ich mag es nicht.«
»Dann ist das auch der Grund, vermute ich, warum es die perfekte Art des Kennenlernens für Sie war, als Sie mit Elizabeth erst mal zwei bis drei Monate nur am Telefon sprachen. So wie wir jetzt ja auch.«
»Ja.«
An einer Stelle unseres Gesprächs zitierte ich, als Michael die Formulierung der »verlorenen Kindheit« benutzte, einen Satz von Léon Bloy: »Mit der verlorenen Kindheit Judas’ wurde Jesus verraten.« Am anderen Ende der Leitung hörte ich »Wow«. Er bat mich, zu erklären, was das bedeutete, und dann um weitere Ausführungen. Was für eine Art Kindheit hatte Judas? Was war ihm widerfahren? Wo hat er gelebt? Welche Menschen kannte er? Es folgte ein zwanzigminütiges Gespräch mit Michael Jackson über apokryphe Bibelstellen, und eine Stunde später redeten wir über einen geplanten Auftritt in Honolulu und die Fortschritte mit seinem neuen Album. Dann kamen wir auf Elizabeth zurück. Er erzählte mir, was für eine Freude es für ihn gewesen sei, sie und ihre ganze Entourage nach Las Vegas einzuladen – und ihr den juwelenbesetzten Elefanten zu schenken. Ich sagte, dass ich ein Foto der Geburtstagsfeier gesehen hätte.
»Es war toll. Genau so sind wir. Wir gehen aus und haben Spaß.«
Angesichts der Vergangenheit von Elizabeth scheint der Satz, den sie zu Oprah sagte, dass nämlich »Michael der am wenigsten merkwürdige Mann, den ich jemals gekannt habe« sei, nicht so übertrieben, wie er zunächst klingen mag. Man tat sie damals als leichtgläubig ab, aber es ist eigentlich eine kluge Erwiderung, auch wenn man bedenkt, dass sie mit einigen der seltsamsten, gewalttätigsten, süchtigsten, verdorbensten, polymorph perversesten Männern, die man sich vorstellen kann, verheiratet, zusammen und verstrickt war, mit Säufern, Brutalos, verurteilten Straftätern, Kriminellen im kleinen und großen Stil. Henry Wynberg, einer ihrer Liebhaber, wurde überführt, die Kilometerzähler der Gebrauchtwagen manipuliert zu haben, die er verkaufte. Ihre ersten Schritte im Parfümbusiness machte Elizabeth zusammen mit Wynberg.
Sie wurde von Nicky Hilton verprügelt, von Richard Burton betrogen, von Eddie Fisher beschimpft. Sie verkaufte ihren 69-Karat-Diamanten und ihren lila Rolls-Royce, um John Warner in den Senat zu verhelfen. Und Larry Fortensky – der arme, Biere kippende Larry, der Elizabeth den ersten Flug seines Lebens und seine erste Auslandsreise verdankte –, Larry also, dem es vielleicht guttäte, einen Teil der zwei Millionen Dollar, die ihm die Scheidung einbrachte, in einen Kurs für Aggressionsbewältigung zu investieren. Und dann wäre da noch die Reihe angeblicher Liebhaber, von Max Lerner bis Ryan O’Neal, irgendwo dazwischen liegen noch Carl Bernstein, Bob Dylan und der frühere iranische Botschafter.
Neben diesem Haufen muss Michael, der weder raucht noch trinkt, tatsächlich wie Peter Pan wirken. Er ist berühmt für seinen Flüsterton. Hui! ist auch ein typischer Ausruf von ihm. Seine Großzügigkeit gegenüber dieser Frau, die es liebt, Geschenke zu bekommen, macht ihn gleichermaßen zu ihrem Gönner und Spielgefährten, wenngleich sie selbst ihr Verhältnis nur als das von Spielgefährten beschreibt.
Mir schien es aber so, als sei für Elizabeth jede ihrer Beziehungen auch eine Art Rollenspiel, als sei eine Ehe ein Film mit Anfang, Mittelteil und Ende; alle ihre Ehen dabei jedoch ganz verschiedene Filme mit unterschiedlichen männlichen Hauptdarstellern, unterschiedlichen Kostümen, Orten und Handlungen; jede hatte dabei sogar so etwas wie einen »Look«, als hätte ein einfallsreicher Art-Direktor bei der Ausstattung mitgearbeitet.
Geht man die Jahrzehnte von Bildern durch, fällt auf, wie verblüffend unähnlich sich die verschiedenen Elizabeths sind: die frische, junge, typisch amerikanische Mrs. Hilton, die britische Mrs. Wilding, die jüdische Mrs. Todd, die Bühnengattin Mrs. Fisher, die laute und ein wenig walisische Mrs. Burton, die dickliche Kandidatengattin Mrs. Warner und schließlich die schlanke Mrs. Fortensky, mit Lederjacke und Jeans, berühmt dafür, fabelhaft aussehend auf Larrys Baustellen aufzutauchen. Ihr Aussehen veränderte sich sogar schon mit den Liebhabern: tief gebräunt im Arm von George Hamilton, ein bisschen Gangsterbraut neben Wynberg, und mit lateinamerikanisch schwarz glänzendem Haar und einem gepunkteten Rüschenkleid mit ihrem mexikanischen Liebhaber Victor Luna.
Einige der Ehen waren Melodramen, ein paar Tragödien waren dabei, eine Farce, ein oder zwei Komödien. Nicky Hilton – jung, reich, saufend, verschwenderisch – kam direkt aus einem Drehbuch von F. Scott Fitzgerald; der Wilding-Versuch – britischer Schauspieler, der nach Los Angeles kommt und dort scheitert – war ein angloamerikanischer Kulturkonflikt; die kurze, intensive Ehe mit Todd, die tragisch mit einem Flugzeugabsturz endete, hatte eine Fortsetzung, mit Gesang – die Ehe mit Todds Freund Eddie Fisher, ein grotesker und stockender Lounge-Act-Film über das Scheitern und Tabletten; die Burton-Geschichte war ein Zweiteiler, mit heftigem Trinken und Prassen, hochemotional, komplex und leidenschaftlich, ein Beleg für Freuds These, dass bei allen Liebesaffären vier Personen anwesend sind. Auf einem ihrer Utrillos ist ein Schloss in der Schweiz dargestellt, in dessen Nähe sie sich während der Dreharbeiten zu Cleopatra heimlich mit Burton traf; sie schätzt das Bild weniger als ein künstlerisches Meisterwerk als dafür, die Szenerie abzubilden, in der sie einen der romantischsten Momente mit einer ihrer zwei großen Lieben (die andere war Todd) erlebte. Die letzten beiden Ehen – mit dem aufstrebenden Politiker John Warner und dem Lastwagenfahrer Larry – waren schließlich reine Komödien, mit dem ganzen qualvollen Schmerz, der zu wahren Komödien gehört.
Die Ehefrau als Rolle? Ehen als Filme? Ich entschloss mich, sie zu fragen.
Eines Abends sah ich, kurz bevor ich mit Elizabeth verabredet war, John Warner im Fernsehen, er redete gerade über den Krieg im Kosovo. Er ist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Senat, aber auch die wohlwollendste Beschreibung des Senators lässt ihn als tölpelhaft und eitel erscheinen – wenig überzeugend, selbstherrlich, und seine nah beieinanderstehenden Augen und sein schmaler Schädel erinnern an das anbiedernde Gesicht eines Cocker Spaniels.
Über die Ehe mit John Warner sagte sie: »Ich dachte, wenn ich sie nicht bald beende, werde ich verrückt – raus aus der Konstellation, wo du nie eine eigene Meinung haben darfst, immer nur die der Kandidatengattin.«
»Das klingt wie ein Filmtitel, Die Kandidatengattin«, sagte ich und fragte, ob ihre Ehen ihr manchmal vorgekommen seien wie Filme, so konkret und unwirklich zugleich.
Elizabeth überlegte eine Weile und sagte dann: »Man beginnt die Arbeit an einem Film nicht mit der Erwartung, dass er scheitert. Man heiratet mit der Erwartung, dass die Ehe für immer hält. Darum heiratet man überhaupt.«
Das war aber gar nicht mein Punkt; es ging dabei nicht um die Absicht, sondern um das filmartige Ergebnis. Mir schien, dass ein Kinderstar, dem man früh beigebracht hatte, den wechselnden Anforderungen der jeweiligen Umstände gerecht zu werden, ideal geeignet war für ein Leben unendlicher Anpassung, für eine Vielzahl wechselnder Rollen. Natürlich schließt niemand eine Ehe mit der Erwartung, dass sie endet, aber alle ihre Ehen hatten ein Ende gefunden, und ihre Liebesbeziehungen waren zerbrochen.
Elizabeth war natürlich die falsche Person für ein Gespräch darüber, aber alles, was sie mir erzählt hatte, deutete darauf hin, dass ihre Ehe Die Kandidatengattin ein wesentlich spannenderer Film war als die Kinofilme, die sie zu dieser Zeit gedreht hatte: Das Lächeln einer Sommernacht, Winter Kills, Mord im Spiegel, Return Engagement.
»Ich musste mich streng an die Parteilinie halten«, sagte Elizabeth. »Ich durfte kein Lila tragen. Der Ausschuss republikanischer Frauen teilte mir mit, dass das mit dem Königtum verbunden werde. Ich meinte darauf: ›Na und?‹
›Und es steht für Leidenschaftlichkeit.‹ Ich sagte: ›Und wo liegt das Problem?‹ Die darauf: ›Aber du bist doch die Kandidatengattin!‹«
Schnitt.
Elizabeth kaufte sich einen konservativen Anzug – »Ich hasse Anzüge!« – und machte zwei Monate lang Wahlkampf, fünf oder sechs Orte pro Tag, keine Zeit zum Essen, der Kandidat wirbt in Reden frenetisch um Stimmen, die Kandidatengattin lächelt tapfer. Auf dem Weg zu einer Veranstaltung der Republikaner betreten sie das Gebäude durch den Hintereingang, der Kandidat und seine Gattin sind in Eile.
Sie kommen an einer Platte mit Essen vorbei, und der Kandidat Warner, dessen Kosename für seine Frau »Pooters« [»Muschi«] war, sagt: »Hier sind ein paar Brathähnchen, Pooters. Bedien dich, du brauchst was in den Magen, nimm dir eine Hähnchenbrust oder so. Das ist unsere letzte Chance für heute, etwas zu essen.«
»Ich nahm mir also ein Stück Hähnchenbrust«, sagte Elizabeth, »und plötzlich – aargh! Kennst du diese fünf Zentimeter langen Knochen? Einer blieb mir im Hals stecken. John Belushi hat einen ganzen Sketch darüber gemacht, auf Saturday Night Live, der Saukerl! An einem Hühnerknochen erstickt in Little Gap, Virginia!«
In einer etwas eigentümlichen Erste-Hilfe-Aktion griff sich Elizabeth ein Brötchen, brach es entzwei, und »schluckte die Hälfte runter, um den Knochen weiter nach unten zu schieben, weil mein Gesicht offenbar die Farbe änderte«.
Es funktionierte aber nicht. Elizabeth wurde ins Krankenhaus gebracht und beschrieb jetzt detailliert, da sie beim Erzählen offenbar Gefallen an der Sache gefunden hatte, wie der Arzt ihr einen langen Gummischlauch in den Hals schob. »Um den Knochen in meinen Magen zu kriegen – ohne Narkose, nicht mal Aspirin –, und sie schafften es auch. Aber die Witze! Ein Jahr lang wurde ich damit aufgezogen!«
Nach dem Wahlsieg Warners gaben die republikanischen Damen ein Mittagessen zu Ehren Elizabeths, um ihr für ihren Beitrag zu dem Erfolg zu danken. Dabei hatten sie keine Vorstellung davon, wie groß ihr Beitrag wirklich war: Elizabeth hatte ein besonders extravagantes Geschenk von Richard Burton verkauft, »meinen riesigen 69-Karat-Diamanten … um meinen Teil der Ehe zu erfüllen«.
Für das Mittagessen »holte ich meinen lila Hosenanzug aus den Mottenkugeln, ließ ihn schön frisch machen und trug ihn in meinem ganzen Glanz. Ich sagte ›Judy‹ – das war die Wahlkampfleiterin –‚ ›ich trage ihn dir zu Ehren!‹«
Wenn es ein Film wäre, wäre diese Szene der Höhepunkt, ungefähr nach der Hälfte. Was dann folgen würde, lässt sich mit einem Satz andeuten, den Elizabeth zu mir sagte: »Ich fand es als Kandidatengattin unheimlich schwer, meinen Mund zu halten.« Warner war jetzt im Senat. Elizabeth war überflüssig geworden. »Washington ist für eine Frau eine der grausamsten Städte der ganzen Welt.« Sie hatte nichts zu tun. Er war, so sagt sie, besessen von der Idee, zu jeder namentlichen Abstimmung im Senat zu erscheinen; sein Ziel war eine Anwesenheitsquote von hundert Prozent. Und es gelang ihm. »Er hat es geschafft, er war bei jeder einzelnen namentlichen Abstimmung anwesend. ›John Warner?‹ – ›Hier!‹« Von dieser Anstrengung im Senat ganz ermüdet, kam er abends nach Hause.
»Er sagte dann: ›Schenk dir doch ein Glas Jack Daniels ein, Pooters, und geh nach oben und sieh fern.‹«
»Also schenkte sich Pooters ein großes Glas Jack Daniels ein und ging nach oben und guckte fern und wartete auf den neuen Tag. Und so ging es immer weiter, und die Jack Daniels’ wurden größer und größer, und ich dachte, wenn ich damit nicht aufhöre, dann trinke ich mich entweder zu Tode oder in einen solchen dauernden Vollrausch, dass das kein Leben mehr ist.«
An diesem Tiefpunkt in Washington angekommen, so Elizabeths melodramatische und selbstironische Erzählung weiter, habe sie gedacht: »Was ist die größte Herausforderung, die ich mir für mich auf der Welt vorstellen kann, das körperlich und geistig Schwierigste, aber gerade so im Bereich des Möglichen? Ah, ein Theaterstück am Broadway.«
Gegen den Rat fast aller Bekannten und Freunde entschied sie sich für The Little Foxes. »Ich ging auf eine Abnehmfarm, um Gewicht zu verlieren und wieder etwas Energie zu bekommen – um mit dem Trinken aufzuhören und mich gut zu fühlen. Den Theatertext nahm ich mit.«
Die Proben fanden in Florida statt, und Warner erschien zwar nicht zur Premiere, aber Tennessee Williams. Er hatte zu Elizabeth mal gesagt, dass er in ihr immer schon eine »Tennessee-Williams-Heldin« gesehen habe, und sie hatte ihm recht gegeben, als sie seine Heldinnen in Die Katze auf dem heißen Blechdach, Plötzlich im letzten Sommer und Süßer Vogel Jugend spielte. Sie sagte, sie habe The Little Foxes als Befreiung empfunden; sie mochte die Theaterleute und den Applaus und die familiäre Atmosphäre bei den Aufführungen. Die Inszenierung ging auf Tour und kam rum, und das tat auch Elizabeth, auf alle möglichen Arten. Bald war sie von Warner geschieden und trat jetzt mit dem Stück in London auf.
Es ist das perfekte Ende für Die Kandidatengattin. Der Star, der das Schauspiel aufgegeben hat, um im echten Leben in die Rolle der Frau eines aufstrebenden Politikers zu schlüpfen, die nach seiner Wahl aber begreift, dass sie nicht mehr gebraucht wird. Als ihr klar wird, dass sie als Washingtoner Ehefrau zugrunde geht, entscheidet sie sich für die Freiheit und besorgt sich eine Rolle auf dem Theater, eine weitere Rolle innerhalb einer Rolle. Sie kann nur sie selbst sein und »Freiheit und Freude empfinden«, wenn sie schauspielert.
Und dann verliebt sich die Schauspielerin, die durch ein Theaterstück befreit worden war, in Tony Geary, einen Seifenopernstar, und hat ein paar Gastauftritte in der Fernsehserie General Hospital.
Von Leben zu Leben, von Rolle zu Rolle. Es vergehen zehn Jahre, und dann beginnt der nächste Film, Die Frau des Lastwagenfahrers. Die Juwelen sind weg, Elizabeth trägt jetzt Jeans und ist die ergebene Ehefrau eines einsilbigen Arbeiters namens Larry. Er ist noch nie mit einem Flugzeug geflogen und hat noch nie die USA verlassen. »Mir machte das so einen Spaß, mit ihm an Orte zu reisen, wo ich auch noch nie gewesen war, sodass ich keinen Vorsprung vor ihm hatte und wir das Neue zusammen genießen konnten.« Sie nimmt ihn mit auf Flüge – nach Marokko, nach Thailand. Weil sie Gäste des thailändischen Königshauses sind, werden sie von einer Motorradeskorte begleitet. Wann immer sie durch die Stadt fahren, sehen sie keine anderen Autos; die Straßen sind für sie abgesperrt. Larry glaubt in seiner ganzen Unschuld, dass alle Auslandsreisen so sind, mit leeren Straßen und salutierenden Polizisten. Er hasst aber ausländisches Essen. Ihm ist langweilig. »Er wollte immer zu McDonald’s, egal wo wir waren.«
Wieder zu Hause in Bel Air, »stand ich morgens um vier auf, um mit ihm zu frühstücken. Wenn Larry zur Arbeit fuhr, ging ich zurück ins Bett. Wenn er dann nach Hause kam, war es herrlich – er war verschwitzt, hatte schmutzige Hände, er war wunderschön und spielte mit seinen Brieftauben.«
»Ich war so stolz, dass er arbeitete. Ich fand es irgendwie verletzend, als er aufhörte.«
Und als Larry der Lastwagenfahrer aufgehört hatte zu arbeiten und angefangen zu trinken, bekam er manchmal einen seiner legendären Wutausbrüche. Ohne seine Arbeit schaute er den ganzen Tag fern und trank Bier. Das konnte nur mit dem Abschied des Lastwagenfahrers aus Bel Air enden. Film vorbei.
Ich war weit entfernt davon, diese unseligen Liebesgeschichten durch den Vergleich mit Filmen kleinreden zu wollen, und Elizabeth schien mir große Achtung dafür zu verdienen, dass sie sich mit Herz und Seele diesen Abenteuern verschrieb, dafür, dass sie sich immer wieder mit solcher Begeisterung in die Rolle der Ehefrau begab. Durch die Rollenwechsel hat sie sich ihre Vitalität bewahrt, wenngleich ihr Biograph Sheridan Morley einmal zu mir sagte, dass sie ihn an bestimmte Figuren aus Romanen von Henry James erinnerte: »Unschuldig, aber im Mittelpunkt von Tod und Zerstörung.«
Mit der Ausnahme von Eddie Fisher (»Sagen wir mal, dass wir nicht gerade beste Freunde sind«) hat sie ein relativ enges Verhältnis zu ihren Exmännern. Sie macht sich zwar über sie lustig, aber niemals lieblos; wenn es Gewalt gab, lässt sie die Fakten für sich sprechen.
»Ein ambivalentes Vergnügen, die Jungs zu entdecken«, sagte sie nach einer langen, schwelgerischen Erinnerung daran, wie gern sie als kleines Mädchen auf Pferden ritt. Zuerst hatte Elizabeth zwei oder drei strikt beaufsichtigte Romanzen, um dann, nach einer kurzen Phase des Werbens, Nicky Hilton zu heiraten. »Ich war noch Jungfrau – es war halbherzig. Was für eine Dummheit, glauben Sie mir.«
Als sie weitersprach, wurde ihre Stimme trockener und verzagter, sie kauerte auf dem Sofa, fast, als ziehe sich ihr Körper zusammen. »Zwei Wochen nach der Hochzeit fing er an zu trinken – Ich hatte gedacht, er ist ein netter, unverfälschter, typisch amerikanischer Junge. Zwei Wochen danach fing bumm! bumm! die Gewalt an. Ich habe ihn nach neun Monaten Ehe verlassen … nachdem« – sie machte eine Pause und blickte irgendwohin in der Ferne – »mir ein Baby aus dem Bauch getreten wurde.«
»Das ist schrecklich«, sagte ich.
»Er war betrunken. Ich dachte, dafür bin ich nicht auf der Welt. Gott hat mich nicht auf die Erde geschickt, dass man mir ein Baby aus dem Bauch tritt. Ich hatte furchtbare Schmerzen. Ich sah das Baby im Klo. Ich wusste nicht, dass ich schwanger war, es ging also nicht um etwas Böswilliges oder Absichtliches. Es passierte einfach.«
Ohne ein weiteres Wort stand sie auf, hielt sich den Bauch und verließ das Zimmer. Es vergingen einige Minuten, bis sie zurückkam und sagte, dass die Erinnerung ihr Schmerzen im Unterleib bereitet habe. »Ich habe noch nie darüber gesprochen«, sagte sie und wechselte das Thema zu Montgomery Clift und wie sie ihm seinen ersten Liebhaber verschafft habe.
Woher wusste sie, dass Monty schwul war?
»Ich weiß nicht, woher ich das wusste. Ich liebte Monty von ganzem Herzen, spürte aber, dass das zwischen uns nichts werden konnte. Es hatte mir niemand erklärt, aber ich wusste es. Monty war nicht offen schwul, und ich glaube, ich wusste, womit er kämpfte. Es quälte ihn sein ganzes Leben. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass es nichts Schlimmes ist. Dass die Natur ihn so gewollt hat.«
Wenn es eine Konstante in ihrem sich immer wandelnden Leben gibt, dann ist es die Freundschaft mit schwulen Männern. Ehemänner und Liebhaber sind gekommen und gegangen, aber es gab immer einen schwulen Mann – und meist mehr als einen –, der die Rolle des Begleiters einnahm, der Vertrauensperson, des Freundes, fast einer Schwester. Roddy MacDowell war ihr Freund von 1942, als sie zusammen in Heimweh spielten, bis zu seinem Tod 1998. Montgomery Clift. James Dean. Rock Hudson. Tennessee Williams. Halston. Malcolm Forbes. Andy Warhol. Truman Capote. Schauspieler, Regisseure, Modedesigner, Friseure, Schriftsteller, fast alles sie bewundernde Freunde und, das gibt selbst sie zu, auch die engsten Freunde in ihrem Leben. Ihre Liebhaber waren gewalttätig, aber es gibt nicht einen einzigen bekannten Fall auch nur eines Knatsches mit einem ihrer schwulen Freunde.
Als sich Aids zu verbreiten begann und einige ihrer Freunde das Leben kostete, reagierte sie. Eine Fast-Märtyrerin der hedonistischen Maßlosigkeit scheint nur auf den ersten Blick eine unwahrscheinliche Kandidatin für gute Taten; tatsächlich ist es eher so, dass ein im großen Stil und voller sexueller Exzesse geführtes Leben die ganz normalen Lehrjahre für spätere Moralapostel sind, wobei das Motiv der späteren Selbstaufopferung oft ganz einfach Sühne ist. Geschockt von den vielen Aids-Todesfällen, profilierte sich Elizabeth dadurch, dass sie auf die Krankheit aufmerksam machte und die Erste in Hollywood war, die Geld für die Aids-Forschung sammelte, zunächst mit der American Foundation for AIDS Research (AMFAR), danach mit der Elizabeth Taylor AIDS Foundation.
»Wenn du berühmt bist, kannst du so viele gute Dinge tun«, sagte sie zu mir.
»Wenn du etwas machst, das sich so sehr lohnt, fühlst du dich besser. Ich hatte die gesamten letzten fünfzig Jahre versucht, meine Privatsphäre zu schützen. Und jetzt dachte ich, warte mal, deine Berühmtheit macht dich immer wütend – du kannst es einfach umdrehen und sie für etwas Positives nutzen. Ich habe meinen Ruhm immer verabscheut, bis mir klar wurde, dass ich ihn nutzen kann.«
Am Anfang des Ausbruchs von Aids »verbogen sich die Leute, sie wurden wütend und hasserfüllt. Sie machten aber nichts. Es regte mich wirklich auf.«
Sie richtete die erste Spendenveranstaltung in Hollywood aus, 1985 ein einschneidendes Ereignis, zum Schrecken vor allem derer im Filmbusiness, die geheimzuhalten versuchten, dass es in Hollywood Schwule gab. Die Veranstaltung war ein Erfolg und brachte eine Million Dollar ein. Es folgten viele weitere.
»Ich bin diese gefürchtete berühmte Persönlichkeit. Ich rege sie auf«, sagt Elizabeth. Schon immer gefiel ihr die Vorstellung, rebellisch zu sein, jetzt ergab sich die Chance, dass die Rebellion auch funktionierte. Ihr Einsatz hat der Aids-Forschung so viel Geld eingebracht – ungefähr 150 Millionen Dollar –, dass selbst die skeptischsten Beobachter den enormen Fortschritt eingestehen, den dieses Geld bei der Erforschung von Aids gebracht hat, besonders durch die finanziellen Mittel für die Entwicklung des lebensverlängernden Proteasen-Hemmstoffs.
»Darum lasse ich mich auch fotografieren – um berühmt zu bleiben. Dass die Leute nicht sagen: ›Und wer ist die Olle?‹«
Sie lacht über den Ruhm in Hollywood, wie er sich verändert hat seit den Tagen, als sie ein Kinderstar war. »Unter Vertrag zu stehen war ein Grauen.« Das ist eine der Erfahrungen, die Michael Jackson mit ihr teilt und in der er sich ihr verbunden fühlt. Elizabeth beschreibt es so: »Du wirst für 500000 Dollar ausgeliehen und bekommst 5000 die Woche – was mich wirklich ankotzte, Entschuldigung. Es war einfach nicht gerecht.«
Aber trotz der Unabhängigkeit und dem großen Geld scheint in Hollywood heutzutage irgendetwas zu fehlen. Das Starsystem ist es nicht, obwohl man Elizabeth als den letzten echten Star bezeichnen könnte. Es liegt nicht einmal am Niedergang der großen Studios und dem Aufstieg der unabhängigen Filmemacher. Nicht an den fehlenden Skandalen und Hochzeiten und Morden – es gibt schon noch ein paar. Was also ist es?
»Es gibt keinen Busen mehr«, sagt Elizabeth. »Und wenn, dann sind es künstliche Ballons. Man sieht die ja schon aus der Ferne. Es ist alles irgendwie androgyn geworden. Das ist einfach nicht sexy.«
»Also ist Hollywood busenlos heutzutage – das ist der Punkt?«, fragte ich. »Ich will Ihnen keine Worte in den Mund legen.«
Sie lachte und sagte: »Hab ich das nicht so gesagt?«
An dem Abend kam Rod Steiger in seinem kleinen Honda vorbei, er trug Turnschuhe. Mit seinem kahl rasierten Schädel, den breiten Schultern und ganz in Schwarz gekleidet, hätte er Mussolini an seinem freien Tag sein können, der mal eben bei Clara Petacci vorbeischaut. Steiger hatte wegen seiner Depression acht Jahre lang nicht arbeiten können und war fast pleite, als er, mit Hilfe von Medikamenten und Ärzten, wieder zu spielen anfing. Eineinhalb Jahre vorher hatte er Elizabeth besucht, die er kaum kannte, um ihr vorzuschlagen, mit ihm in Somewhere zu spielen – das Drehbuch hatte er mitverfasst, eine Fortsetzung des Zauberers von Oz, die Figuren in späteren Jahren. Elizabeth hatte er in dieser Version für die ältere Dorothy vorgesehen. Beim Anblick von Elizabeth erschrak er. Sie war niedergeschlagen und ans Haus gefesselt, wenn nicht sogar klinisch depressiv und dazu klaustrophob, und da Steiger das Gleiche durchgemacht hatte, beschloss er, sie zu seiner Mission zu machen. Er bestand darauf, mit ihr auszugehen, und sorgte dafür, dass sie unter Leute ging. Und so fand Elizabeth zurück in die Welt. Steiger schrieb ein Gedicht über sie mit dem Titel »Der Preis« – der Preis, den sie für das Leben zahlte, das sie geführt hatte. Steiger, der in ihr »eine Zauberin« sieht, »die zum Opfer ihrer Macht zu zaubern wurde«, sagt: »Sie würde überall hingehen, wo es frische Luft gibt.«
Michael Jackson ist frische Luft. Vielleicht ist ihr ultimativer Film der, in dem sie jetzt mit ihm spielt – ihrem Charakter und Leben eher entsprechend als Steigers Update des Zauberers von Oz. In Michaels Haus in Neverland liegen auf dem Couchtisch in der Bibliothek zwei Bücher, Peter Pan und ein Bilderbuch, Michaels HIStory. Das ganze Haus ist voller ikonographischer Bezüge zu Peter Pan. Fast bewusst scheinen Elizabeth und Michael die Rollen in einer Fortsetzung von J.M. Barries Buch zu spielen, aber Peter und Wendy ist in ihrer Version seltsamer, bunter, vollständiger und länger als die Ehefilme, die ich gegenüber einer skeptisch reagierenden Elizabeth in Bel Air erwähnt hatte – Die Frau des Schlagerstars, Die Kandidatengattin, Die Frau des Lastwagenfahrers und andere haben weit weniger Potenzial als dieser über die gealterte Wendy und den zurückgezogenen, sich gegen das Altern sträubenden Peter. Es gibt keinen Konflikt oder etwas Vergleichbares; keinen Sex, keinen Kampf, keine Entbehrung. Ich hatte den Eindruck, sie umarmen sich viel und tauschen Vertraulichkeiten aus. Alles dreht sich um die verlorene Kindheit, heimliche Freuden, Picknicks, Essensschlachten und die unmittelbare Befriedigung von Bedürfnissen. Wenn sie Lust auf einen Elefanten oder ein Konzert oder ein Spiel oder ein Flugzeug haben, das sie fortbringt, bekommen sie es umgehend. Die Neverland Ranch ist für ihre Zwecke wie gemacht: die mädchenhafte Mutter, der kindlich mäzenatenhafte Sohn, sexuelle Schwingungen in der Luft – das ganze Anfassen, Halten, Necken, Umarmen, das Leben als Spiel und Unmengen von Geld – sogar Piraten! Der Film Peter und Wendy hat jetzt schon gezeigt, dass er gut läuft. Die Freundschaft hat bereits länger Bestand als jede ihrer Ehen.
Elizabeth hat einen Hunger aufs Leben, und Hunger war das Wort, das mir immer wieder in den Sinn kam, wenn ich an sie dachte: es war eine Lust, ein Hunger, der nie gestillt schien. In diesem Hunger ist sie ganz sie selbst. Es mag metaphorisch klingen, aber sie ist kein metaphorischer Mensch. Sie steht mit den Füßen fest auf dem Boden und nimmt die Dinge beim Wort; ihr Hunger ist dem Wortsinn entsprechend ein ganz reales Verlangen, etwas zu verschlingen. Sie hat oft erzählt, dass sie nicht deswegen dick wurde, weil sie unglücklich war; sie wurde es, weil sie es liebte zu essen. Und sie mochte am liebsten die fettigsten Sachen – Eis, Brathähnchen. Steiger bringt ihr Hotdogs aus einem Imbiss in Malibu mit, der Zahnarzt geht mit ihr Burger essen.
Alle, die sie kennen (und viele, die sie nicht kennen), haben eine Theorie über ihr Leben. Die meisten drehen sich darum, wie sagenhaft sie ist, oder haben den Exzess zum Thema, ihre neun Leben, ihre Unfälle, ihre Ernährung, wieder andere die Merkwürdigkeit, dass sie im Zentrum so vieler Katastrophen steht. Mike Nichols, der Regisseur ihres ersten und eines ihrer besten Filme, Wer hat Angst vor Virginia Woolf?, hat es am prägnantesten formuliert: »Es gibt drei Sachen, die ich sie noch nie habe machen sehen: lügen, lieblos sein, pünktlich sein.«
Auch wenn Elizabeth sagt, dass sie selbst ihr eigenes Leben und Verhalten nicht analysiere, ist ihre Unpünktlichkeit vielleicht der Aspekt, dessen genauere Untersuchung am vielversprechendsten ist. Ihre Unpünktlichkeit ist fast schon ein Titel, »Ihre Durchlaucht, die Unpünktlichkeit«. Geschichten über ihre Unpünktlichkeit begleiten alles, was sie je gemacht hat, was bereits als solches bemerkenswert ist, da sie offenbar noch nie etwas pünktlich vollendet hat. Ihre Filmkarriere begann, als sie zehn war, der einzige bekannte Fall, dass sie je zu früh dran war.
Unpünktlichkeit ist ein Grundthema ihres Lebens, ebenso wie Krankheit, aber die beiden stehen bei ihr in keinem Verhältnis zueinander. Krankheiten erklären nicht ihre Unpünktlichkeit, und Unpünktlichkeit ist sogar ein viel zu schwaches Wort für ihr chronisches und unheilbares Zuspätkommen und Hinauszögern, das ans Despotische grenzt, wenn nicht gar ans Pathologische. Wir alle kennen und verabscheuen in der Tiefe unseres Herzens Menschen, die gewohnheitsmäßig zu spät kommen. Als ich in Bezug auf Elizabeth darüber nachdachte, wurde mir erst klar, was für ein ergiebiges Thema das ist, eines, das ein eigenes Buch verdienen würde, ein ganzes Lehrbuch, das vom Umfang her einem Buch über manipulative Persönlichkeiten oder Missbrauch in der Ehe in nichts nachstünde – zwei Themenfelder, mit denen sich das der Unpünktlichkeit überschneidet, da es sich nicht um ein einsames Leiden handelt, sondern um eines, das mindestens zwei Leute involviert, den Zuspätkommenden und den Wartenden. In Elizabeths Fall kann der Wartende zum Beispiel ich in ihrem Wohnzimmer sein, oder Hunderte Theaterzuschauer, die sich fragen, wann sich der Vorhang für The Little Foxes hebt, oder tausend Leute auf dem Set von Cleopatra, die ihre Ankunft erwarten, oder John Warner, der am Tag seiner Hochzeit nervös von einem Fuß auf den anderen trippelt, sie kam nämlich auch zu diesem Termin zu spät. Im Theater wurde der Vorhang gehalten. Regisseure tobten vergeblich. Staatsoberhäupter, Queen Elizabeth II., der Papst, ihre engsten Freunde – keiner hatte das Privileg, sie pünktlich zu treffen. Sie macht bei ihrer Unpünktlichkeit keine Unterschiede. Aber wie ist es bei Flugzeugen? Ich habe jemanden gefragt, der manchmal mit ihr reist. Flugzeuge haben exakte Flugpläne, und sie müssen auf die Minute genau abheben. Trotzdem haben auch Linienflüge schon oft auf sie gewartet. Hat sich der Abflug Ihres Flugzeugs auf dem Flughafen Los Angeles schon mal aus unerklärlichen Gründen verzögert? Nicht unwahrscheinlich, dass Elizabeth einen Sitz in der Ersten Klasse hatte und jemand kurz durchrief.
Es mag vielleicht offensichtlich sein, dass Unpünktlichkeit ein neurotisches Anspruchsdenken offenbart, einen Machtanspruch. Sie erhöht den Spieleinsatz in einer Beziehung. Sie ist ein beständiges Element beim Umwerben und der Sexualität: die erregte Person wird warten gelassen, der Akt wird verzögert, bis der oder die Geliebte erscheint, und dann kommt es noch zu weiteren Verzögerungen, bis schließlich der siebente Schleier fällt. Triff mich in der Umkleide – dort werden wir uns lieben, lautete die Zeile einer Stripperin in einem etwas zwielichtigen Theaterstück, das ich als Jugendlicher am Scollay Square in Boston sah. Falls ich mich verspäte, fang schon mal ohne mich an.
Unpünktlichkeit ist eine Eigenschaft von Diven, die es ihnen ermöglicht, einen Auftritt zu haben. Es ist außerdem auf klassische Art passiv-aggressiv. Dass Narzissmus zur Unpünktlichkeit gehört, lässt sich schwer leugnen. Was diese egozentrische Forderung aber so absurd macht, ist die Erwartung des Zuspätkommenden, dass der andere pünktlich ist. Wobei das kein Widerspruch ist. Wer zu spät kommt, legt einen hohen Wert auf Pünktlichkeit; es muss alles losgehen können, wenn der Zuspätkommende eintrifft; der Zuspätkommende darf seinerseits nie warten gelassen werden – das ist eine der Grundforderungen der Unpünktlichkeit. Wenn Elizabeth eintrifft, hebt sich der Vorhang, rollt die Kamera, werden die Bilder geschossen, spielt die Musik, fängt die Aufführung an. Kein anderer darf sich verspäten. Ich war Zeuge, wie Elizabeth sagte: »Wenn er in fünfzehn Minuten nicht hier ist, kann er mich am Arsch lecken. Dann sehen wir uns nie wieder.«
Über sie hat noch nie jemand so etwas gesagt. Sie erwartet, dass man ihre Regeln akzeptiert, ihre Unpünktlichkeit funktioniert also als eine Art Test. Wenn du nicht bereit bist, auf sie zu warten, interessiert sie sich nicht für dich. Du darfst nie erwarten, dass sie auf dich wartet; du musst immer pünktlich sein, obwohl du weißt, dass sie es nicht sein wird. Welches Recht hast du, zu spät zu kommen? Es ist ihr Privileg, ein kleiner Tusch, der daran erinnern soll, was sie alles gemacht und erreicht hat. Darin ein königliches Attribut zu sehen, wäre insofern falsch, als die Mitglieder von Königshäusern für ihre Pünktlichkeit berühmt sind. Es ist eher typisch für Herrschsüchtige, Manipulatoren, Kontrollfreaks, für zutiefst unsichere Menschen. Es ist charakteristisch für tyrannische Typen, kokette Frauen, Menschen, die ein Gefühl der Sicherheit brauchen, für alle, die Kontrolle über andere Menschen haben wollen. Du musst auf mich warten; ich werde nie auf dich warten.
Was ich mich wirklich gefragt habe – angesichts der Tatsache, dass sie keine Filme mehr dreht, kaum arbeitet, nicht liest, sich mit wenig beschäftigen muss neben ihren Dates und ihrem Hund –, ist: Was zum Himmel macht sie, wenn sie nicht dort ist, wo sie eigentlich gerade sein sollte? Wie ein kleines Mädchen entschuldigte sich Elizabeth jedes Mal unaufrichtig dafür, dass sie zu spät zu unseren Treffen kam, und ich legte jedes Mal Wert darauf, zu erfahren, was sie denn noch machen musste. »Ich war oben, singen und tanzen«, ganz hingerissen von der Musik Andrea Bocellis, meinte sie einmal. Aber sie betreibt auch einen ungeheuren Aufwand, zieht sich immer wieder um – wechselt ganze Outfits –, macht ihr Make-up neu, schleudert ihre Schuhe in die Ecke und probiert andere an, grübelt über ihren Schmuck, schmust mit Sugar, telefoniert.
Diese zutiefst unliebenswürdige Eigenschaft beendet Freundschaften, was aber, da sie als Test für Freundschaften gedacht ist, unvermeidlich ist. Bei Elizabeth ist es eine akzeptierte Verhaltensweise, vergleichbar mit einer Behinderung, als wäre sie dafür bemitleidenswert, wie eine Hinkende, oder als hätte sie Zuckungen, nur dass es in ihrem Fall halt um jemanden mit einer Zeitstörung geht. Für mich war es allerdings vor allem ein weiteres Detail im fortwährenden Drama von Peter und Wendy, da es doch meist die Eigenschaft von bedürftigen Kindern ist, die Zeit hinauszuzögern, ohne selbst den tieferen Grund dafür zu kennen, und im Fall von bedürftigen Kindern gibt es immer einen tieferen Grund.
Es ist ein Wesenszug von Elizabeth, aber sie geht in ihm nicht auf. Während des Schreibens an dieser Geschichte verbrachte ich genug Zeit mit ihr, um sie in Momenten zu erleben, wo sie ganz bei sich war, Momente, in denen – wie in einem Film – ein Blick oder ein Satz alles sagt.
Da war die erschreckende Geschichte mit Nicky Hilton – aber weniger ihr Bericht als wie sie direkt danach aufstand und langsam das Zimmer verließ, die Hände auf dem Bauch, ganz offensichtlich unter körperlichen Schmerzen.
Und in Neverland, in Michaels Esszimmer, ein viel heiterer Moment, als sie sich mit dem Koch über das Essen beriet. Sie entschied sich schließlich für ein großes Käseomelette mit Ketchup. Als sie sich gerade darüber herzumachen begann, sah sie, wie jemand anders einen Teller mit Pommes frites bekam – die dünnen, tiefgefrorenen, wie die von McDonald’s –, und sagte mit echter Begeisterung in der hungrigen Stimme: »Hey, wo hast du die denn her?« Und kurz darauf saß auch sie vor einem riesigen Teller Pommes.
»Bitte, lieber Gott, mach mein Leben übergroß«, war immer schon ein Gebet von Elizabeth, so wie Essen immer schon ein wichtiges Thema von ihr war. Ein Freund von ihr erzählte mir einmal, wie sie in den Kühlschrank guckte und liebevoll mit dem Essen darin zu sprechen anfing: »Ich werde dich essen … und dann esse ich dich … und danach dann dich …«
Eines Tages erzählte sie mir, ganz langsam, mit viel Gefühl, von einem Fotoshooting für ihre Parfümlinie White Diamonds – ein Geschäft, das ihr ein beträchtliches Einkommen sicherte und die Notwendigkeit beseitigte, jemals wieder als Schauspielerin zu arbeiten.
»Ich hatte einen 101-karätigen Diamanten am Finger«, sagte sie, mit einer Pause nach jedem Wort. Sie leckte sich die Lippen und gluckste dabei vor Freude. »Lupenrein!« Und, wieder mit Pausen zwischen den einzelnen Wörtern: »So viel zum Thema Rausch!«
Sie umfasste ihren Finger, auf dem der imaginäre Diamant mit Smaragdschliff steckte, und ein hungriger Schauer lief über ihren kleinen zerbrechlichen Körper, als sie den Finger zum Mund führte und fast kreischend rief: »Ich wollte ihn runterschlucken!«
Ein anderes Mal hörte sie eine Ballade von Bocelli und sang mit, verstummte kurz und sagte dann: »Più! Più! Ich liebe più! Was heißt più?«
»Es heißt ›mehr‹«, sagte ich.
»Più!«
Der Inbegriff von Elizabeth war eine Frage, die ich nicht selbst hören durfte, die mir aber aus zuverlässiger Quelle zugetragen wurde. Wir hatten bei ihr zu Hause ein besonders ergiebiges Gespräch gehabt und uns verabschiedet. Später am Tag sprach sie mit einem gemeinsamen Freund von uns und fragte ihn: »Ist Paul eigentlich verheiratet?«
(1999)