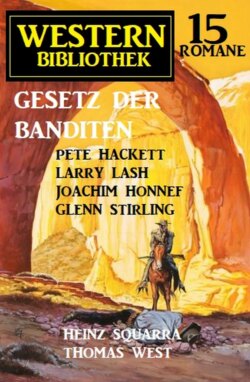Читать книгу Gesetz der Banditen: Western Bibliothek 15 Romane - Pete Hackett - Страница 69
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14
ОглавлениеEs ist schon heller Vormittag, als die Reiter verdreckt und müde in die Stadt zurückkommen.
Sharleen steht wieder am Fenster, und Jim, der munter geworden ist, blickt auf ihren Rücken.
„Sie haben ihn nicht“, hört er sie sagen. „Clint scheint sich alles gut ausgerechnet zu haben. Besser als Abe, der wohl mit allem Möglichen, aber nicht mit dir rechnete.“
Draußen reiten die Männer am Haus vorbei.
„Übrigens hat Weels wieder einen Zettel gefunden“, sagt das Mädchen. „Er lag neben dem Store. Diesmal wollen sie tausend Dollar haben. Und diesmal haben sie auch nicht aufgeschrieben, welches Haus sie dann in die Luft sprengen werden. Ob sich etwas geändert hat?“
„Weil Abe tot ist?“
„Ja.“
„Das ist schwer zu sagen, Sharleen. Ich kenne mich mit Clint nicht mehr aus. Ich weiß nur, dass wir aufeinander schießen werden, wenn wir uns treffen.“
Sharleen wendet sich um und kommt zur Mitte des Zimmers. Am Tisch bleibt sie stehen und stützt die Hände darauf.
„Niemand wird von dir verlangen, dass du noch einmal nach ihm suchst“, entgegnet sie.
„Heute sicher nicht. Aber bestimmt an dem Tag, an dem ich draußen stehen kann, ohne gehalten zu werden. Außerdem habe ich Clint etwas versprochen.“
„Was?“
„Dass ich als Raines Deputy kommen werde, wenn er nicht aufgibt.“
„Das wirst du nicht tun, Jim! Du bleibst im Bett liegen!“
Die Tür öffnet sich. Vor sich drängt der Arzt den Marshal in den Raum. Raine tritt an das Bett heran und blickt auf Jim.
„Er ist uns wieder entkommen“, meint er flach. „Diesmal haben wir ihn bis in die Berge verfolgt. Dann war bei den meisten Männern die Angst größer als der Hass.“
„Ich verstehe.“
„Ich hatte dir noch sagen wollen, dass dir alle sehr dankbar sind.“
„Wegen Johnson?“
„Ja.“
„Es hat mir keinen Spaß gemacht, Marshal. Wir wollen nie mehr davon reden.“
„Ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir das Tal verlassen wollen“, sagt Sharleen, als die Männer schweigen. Raine wendet sich ihr langsam zu.
„Verlassen?“
„Ja. Er hat damit nichts zu tun - und Sie verstehen das sicher.“
„Die Leute meinten auf dem Rückweg, dass es einer allein versuchen müsste“, meint der Marshal. „Und zwar einer, der mit dem Colt schnell ist. Hier haben die meisten Männer nur ein Gewehr. Ein altes Gewehr, aus dem sie seit Jahren nicht mehr geschossen haben.“
„Die meisten Weidereiter nehmen ihren Colt, um Nägel in die Zäune zu schlagen, Marshal“, brummt Jim.
„Stimmt. Aber du gehörst nicht zu den meisten, mein Junge. Deshalb denken alle Männer an dich. Jim, warum wollt ihr aufgeben? McBee ist geschlagen. Er wird nie mehr an Sharleens Eigentum rütteln wollen. Wo wollt ihr denn hin? Warum willst du vor einem Mann fliehen, der zum vielfachen Mörder geworden ist und niemals mehr dein Bruder sein kann?“
„Sie fragen Vieles auf einmal, Marshal.“
„Ja, ich weiß. Eigentlich zu viel.“
„Genau. Sie waren schon einmal ganz anderer Meinung. Haben Sie das vergessen?“
„Ich vergesse nur selten etwas, Jim. Und dann war es bestimmt nicht wichtig. Ich will dir etwas sagen: Auf meinem Schreibtisch liegt ein Zettel. Tausend Dollar will ...“
„Weiß ich.“
„Siehst du, darum geht es. Wir haben keine Ahnung, was er nun für eine Teufelei vorhat. Aber wir wissen, dass er sie ausführt, wenn wir ihm das Geld nicht geben und sich niemand findet, der ihn endlich zur Strecke bringt. Die Soldaten suchen ihn schon über eine Woche ohne Erfolg. Im Gegenteil, während sie da oben nach ihm suchen, reitet er hier unten spazieren. Und dabei erledigt er sogar noch, was er uns angedroht hat. - Wir rechnen alle fest darauf, dass du uns hilfst!“
Als Jim Durbin am nächsten Tag auf die Straße tritt, stehen sie alle wie eine Mauer vor ihm. In ihren Augen ist nicht mehr der Hass wie damals, als sie auch so auf der Straße standen. Aber vielleicht wird es wieder so, wenn er ihnen sagt, dass er es nicht machen wird.
Der Marshal hat einen Stern in der Hand, auf dem sich ein Sonnenstrahl bricht. Es kommt Jim fast lächerlich vor, dass er den Stern nicht nehmen will, obwohl er es Clint so versprochen hat. Der Marshal kommt näher und steigt die Treppe herauf. Er heftet Jim den Stern an die Lederweste, ohne ihn zu fragen, ob er damit einverstanden ist. Der Arzt gibt Raine ein Buch mit abgeschabtem Deckel in die Hand, das er vor Jim hinhält.
„Leg die Hand darauf und sprich mir nach!“
Jim weiß genau, dass es jetzt nicht mehr sein Wille ist, als er die Hand auf das warme Buch legt. Und doch tut er es mit vollem Bewusstsein, hört Raine die Eidesformel sagen und spricht sie nach. Er denkt, dass sie ihn alle nur brauchen, weil sie glauben, er wäre seinem Bruder als einziger gewachsen.
Und da weiß er plötzlich, warum er es tut. Weil Clint sein Bruder ist!
„Feiges, gemeines Pack!“, ruft Sharleen mit klirrender Stimme. „Ihr braucht doch nur einen, der für euch den Kugelfang macht! Was hat er denn damit zu tun?“
Der Doc will sie ins Haus schieben, aber sie stößt seine Hand zurück.
„Ihr seid einer wie der andere!“, ruft sie. „Ich hasse euch dafür!“
Jim würde den Stern am liebsten von seiner Weste reißen und in den Staub schleudern. Warum musste Sharleen erst kommen und das sagen? Und warum kam sie nicht früher? Hatte sie vielleicht gehofft, er würde den Stern nicht nehmen?
Dann fällt ihm wieder ein, dass er es Clint so versprochen hat, und plötzlich weiß er überhaupt nicht mehr, was er tun soll.
„Stell dir mal vor, er würde noch lange in den Bergen da oben bleiben können“, meint der Marshal. „Er würde immer neue Verbrechen begehen, und es würde immer schlimmer. Würdest du dir dann nicht auch sagen, es wäre besser gewesen, früher zu reiten? - Jim, es sind Männer ermordet worden! Männer, die ihn vorher nie gesehen hatten. Als sie ihn verfolgten, taten sie nur ihre Pflicht.“
Jim steigt wie im Traum die Stufen hinunter und geht auf das Pferd zu, das sie herangeführt haben. Es ist gesattelt. Eine Winchester steckt im Scabbard. Sie geben ihm alles, was er braucht, um seinen Bruder zu töten.
„Jim, bleib!“, ruft das Mädchen.
Er steigt auf das Pferd, schaut sie an und schüttelt den Kopf.
„Es muss wohl nun so sein, Sharleen. Bleib hier in der Stadt!“
„Hier fehlt mir die Luft zum Atmen. Nein, hier bleibe ich nicht!“
Er zuckt die Schultern. Er muss auf diesem Weg weiter, und es ist gleichgültig, was dann kommt. Seine großen mexikanischen Sternsporenräder berühren leicht die Flanken des Pferdes. Vor ihm teilt sich die Menge wie die Wellen eines Flusses vor einem Boot. Er reitet an ihnen vorbei und aus der Stadt hinaus. Ein bitterer Geschmack liegt auf seiner Zunge, der sich verstärkt, je näher die drohende graue Kette der Berge ihm rückt.
Er hält auf einer kahlen Höhe und blickt ins Tal hinunter. In der Ferne schimmert der Arkansas River. Jim spürt die Schmerzen, die wieder überall in seinem Körper bohren. Sie haben ihn in den Sattel getrieben, obwohl er eigentlich nicht gesund genug dazu ist.
Hinter dem Fluss sieht er ein paar Gebäude undeutlich unter dem Dunst der Hitzeschleier. Plötzlich weiß er, dass es Sharleens kleine Ranch ist. Er hat schon einmal hier an der gleichen Stelle gehalten.
Jim wendet das Pferd und reitet auf der Bergschulter nach links. Seit drei Tagen ist er hier. Er hat weder Clint noch die Soldaten zu Gesicht bekommen. Vielleicht haben sie aufgegeben und sind in ihr Fort zurück. Aber als er an den jungen Offizier denkt, kommen ihm Zweifel daran.
Der Weg führt in eine Schlucht. Steil türmen sich zu beiden Seiten Felswände in die Höhe. Ein Tal öffnet sich. Direkt vor ihm steckt ein abgebrochener Ast im Boden. Daran ist ein Zettel befestigt. Jim wirft einen Blick durch das Tal. Nirgends ist ein Mensch zu sehen. Aber neben dem Ast ist der Boden von Pferdehufen aufgewühlt. Oben am Ast hängt ein Stück Papier, das der laue Wind knisternd hin und her bewegt.
Er reitet näher und reißt das Papier ab. Er erkennt die steilen, ungelenken Schriftzüge seines Bruders, der geschrieben hat: ,Nun hast du lange genug nach mir gesucht. Dreimal wäre es leicht gewesen, dich zu töten. Diese Nacht brannte bei Sharleen Licht. Anscheinend ist es ihr in der Stadt zu langweilig geworden. Wir können uns bei ihr treffen. Aber bedenke, dass ich eher dort sein kann als du. Komm allein, wenn du wirklich sehr an ihr hängst! Clint'
Jim knüllt den Zettel zusammen und schiebt ihn in die Tasche. Warum ist sie nur nicht in der Stadt geblieben?
Er reitet weiter, durchquert schnell das Tal und jagt in halsbrecherischem Tempo den Canyon hinunter. Dabei weiß er ganz genau, dass Clint früher dort sein wird als er.
Eine Meile weiter trifft er plötzlich auf die Soldaten. Der Lieutenant lässt seinen Colt sinken, als er Jim erkennt. Er reitet näher und blickt auf den Stern an Durbins Weste.
„Ich wollte Ihnen noch danken“, sagt Jim.
„Wofür?“
„Sie konnten mich damals auch liegenlassen, Lieutenant. Es wäre mein Tod gewesen.“
„Schon gut, Durbin. Ich tue immer das, was ich für meine Pflicht halte. Haben Sie ihn getroffen?“
„Nein.“
„Wollen Sie nach Wichita zurück?“
Jim nickt.
„Ja“, stößt er rau hervor. „Es ist sinnlos, hier zu suchen. Geben Sie auch auf?“
„Nein. Nicht, ehe ich ihn habe.“
„Das muss auch jeder selbst wissen.“
„Eben. Ich wünsche Ihnen einen guten Ritt nach Wichita, Durbin.“
Jim blickt den Mann scharf an, aber in dessen Gesicht zuckt kein Muskel. Da nickt er und reitet schnell weiter.
„Er hat es verdammt eilig, Sir“, brummt der Sergeant mit zusammengezogenen Augen.
„Ja. Vielleicht wegen dem Mädchen, das auf ihn wartet.“
„Kann ich mir schlecht denken.“
„Ich mir eigentlich auch. Heben Sie doch mal den Zettel dort auf. Er hat ihn aus der Tasche verloren, als er an hielt.“
Der Sergeant blickt in der Richtung, in der der Lieutenant nickt. Er sieht den zusammengeknüllten Zettel, steigt ab und hebt ihn auf.
„Lesen kann ich selbst“, sagt der junge Offizier scharf, als der Sergeant ihn entfalten will. Er bekommt ihn, überfliegt die Zeilen schnell und beginnt zu lächeln.
„Was steht da, Sir?“
„Dass wir Clint Durbin morgen bei Sonnenaufgang nach Dodge City bringen werden, vorausgesetzt, wir stellen uns sehr geschickt an. Lassen Sie satteln, Sergeant!“
Der Soldat zerbeißt einen Fluch zwischen den Zähnen, weil er genau weiß, dass dieser Blödsinn nicht auf dem Zettel stehen kann. Dann gibt er das Kommando zum Satteln.
Als Jim den Fluss erreicht, hat sich sein Herzschlag beruhigt. Inzwischen ist es dunkel geworden. Da drüben hinter der Bodenwelle liegt die kleine Ranch, und dort wird sich zeigen, welche Entscheidung das Schicksal getroffen hat. Er durchfurtet den Arkansas River an einer seichten Stelle und reitet zur Höhe der Bodenwelle hinauf. Unten im Tal sieht er die Gebäude wie große dunkle Klumpen. Nirgends ist Lichtschein zu sehen. Und doch spürt er, dass Sharleen und auch Clint da sind. Er hätte vielleicht einen Bogen schlagen sollen. Aber Clint wird es schon so gemacht haben, dass er so und so bestimmt, wie das Spiel nun laufen soll.
Das Pferd geht von selbst weiter. Es muss die Nähe eines Stalles gewittert haben.
Als Jim neben dem Brunnen ist, rührt sich immer noch nichts. Natürlich wird Clint nicht auf ihn schießen. Er will mit ihm reden, weiß der Teufel, über was. Schießen konnte er in den Bergen. Dort wäre für ihn alles einfacher gewesen.
Er steigt ab und führt das Pferd in den Stall. Dann nähert er sich langsam dem Haus. Als er die Tür aufstößt, erkennt er Sharleen. Sie sitzt auf einem Stuhl mit Armlehnen, an den sie offenbar festgebunden ist. Wie ein Klecks leuchtet ihr bleiches Gesicht durch die Dunkelheit. Hinter ihr schiebt sich Clint in die Höhe. Jim weiß, dass er es ist, obwohl er ihn kaum erkennen kann.
„Mach die Tür zu!“, sagt Clint.
Jim schiebt die Tür mit dem Fuß zu und legt den Riegel vor.
„So ist es gut“, meint Clint und lacht leise. Es klingt wie das Knurren eines Raubtieres. „Ich habe sie anbinden müssen. Sie hat auch einen Knebel im Mund. Aber es ist ihr bestimmt nichts geschehen. Übrigens hat sie mir schon gesagt, dass du die tausend Dollar nicht hast. Ich ahnte das, als ich dich gestern sah. Dein Gesicht sah so wild aus. Deshalb wollte ich dich da oben nicht ansprechen.“
„Sag doch, was du wirklich willst, Clint!“, presst Jim durch die Zähne.
„Du bist zu aufgeregt. Ich hatte dich fragen wollen, wer Johnson erschossen hat. Sharleen sagt, es wäre Weels gewesen. Ich kann das nicht glauben, Jim. Weels habe ich als kleinen, feigen Kerl in Erinnerung, dessen größte Angst die vor dem Sterben war.“
„Vielleicht haben wir vor dem Sterben alle Angst, Clint.“
„Kann sein. Aber es ist keine Antwort auf meine Frage. Wer?“
„Ich.“
Clint kommt halb um den Stuhl herum. Nun erst kann Jim die Waffe erkennen, die auf ihn gerichtet ist.
„Du?“
„Ja, ich. Mit dem Schrotgewehr des Arztes. Die Entfernung war so kurz, dass das gehackte Blei ihn sofort getötet hat.“
„Ich hatte immer so ein komisches Gefühl, als müsste es so gewesen sein. Aber ich wollte es nicht glauben. Zuerst dachte ich natürlich, sie hätten ihn geschnappt. Aber dann konnte ich einen Mann anhalten, der durch die Stadt gekommen war. Er wusste nur nicht, wer es gewesen war.“
„Nun weißt du es ganz genau, Clint. Willst du sonst noch etwas?“
„Abe war der letzte meiner Freunde. Hast du auch daran gedacht?“
„Ja, Clint. Als ich schoss, dachte ich an alles auf einmal. Auch an die Soldaten, die ermordet worden waren. Und an Weels, den Abe töten wollte, obwohl der Storekeeper keine Waffe bei sich hatte.“
„Deswegen hast du auch den Stern genommen, nicht wahr?“
„Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Ich hatte es dir so versprochen. Und ich dachte, dass einer schließlich reiten müsste. Sie erwarteten es alle von mir, weil ich Durbin heiße. Vielleicht war das richtig so. Ich weiß es bestimmt nicht.“
„Klingt, als wolltest du dich entschuldigen“, meint Clint. „Aber das willst du doch gar nicht. Es tut mir sehr leid, dass ich dich nun töten muss, mein Junge.“ Jim spürt, dass sich auf einmal alle Muskeln in seinem Körper anspannen.
Das also ist es in Wirklichkeit, was Clint hierher getrieben hat. Er will ihn töten. Aber er wollte die Sache spannend machen, was ihm draußen in den Bergen nicht gelungen wäre. Hier hat er alle Trümpfe auf seiner Seite, weil vor ihm die gefesselte Sharleen Stewart sitzt, die er als Faustpfand benutzt.
„Du dreckiger Halunke“, sagt er leidenschaftslos, als wäre es nichts weiter als eine ganz sachliche Feststellung. „Schämst du dich nicht, dich hinter einem Mädchen zu verstecken?“
„Nein, Jim. Wie soll sich ein Mann in meiner Lage noch schämen können. Ich wollte dir noch erklären, dass ein entschlossener Mann nicht gleich tot ist, wenn er gut getroffen wird. Es reicht ihm immer noch, etwas Bestimmtes auszuführen.“
„Ich verstehe. Wirst du sie fortlassen, wenn ich tot bin?“
„Ich werde gehen, Jim. Und ihr wird absolut nichts geschehen, wenn du vernünftig bist. Jeder Mann hier draußen hasst es, wenn eine Frau in Männerstreitigkeiten verstrickt wird. Aber manchmal muss der Satan Fliegen fressen. Wenn du ihr noch etwas sagen willst, dann sage es jetzt.“
Jim sieht, wie sich Sharleen in den Fesseln aufbäumt. Sicher will sie die Stricke sprengen, obwohl ihr das nicht gelingen kann. Mit der linken Hand nimmt Clint ihr das Tuch ab, das er um ihren Kopf geschlungen hat. Sharleen spuckt den Knebel aus.
„Wirf dich nieder, Jim!“, ruft sie mit überkippender Stimme.
Jim lehnt sich mit dem Rücken gegen die Wand. Schweiß brennt auf seinem Körper. Jetzt ist sein Bruder sein Todfeind geworden. Erst in dieser Stunde, da er nach etwas gegriffen hat, das ihn nichts angeht. Nach dem er nicht greifen durfte. Aber das alles nützt Jim nichts mehr. Die Worte des Mädchens sind an seinen Ohren vorbei geweht.
„Hörst du denn nicht!“, schreit sie.
„Er ist ein netter Junge“, meint Clint. „Genau so habe ich ihn immer eingeschätzt. Er lässt sich für dich töten, Sharleen. Dafür solltest du ihm immer Blumen auf sein Grab legen. - Oder wollen wir uns anders einigen, Jim?“
Jim Durbin glaubt seinen Ohren nicht trauen zu dürfen. Will Clint in Wirklichkeit noch ganz etwas anderes.
„Schließlich hast du vom Sterben nichts. Wenn wir jetzt einen Pakt schließen, machen wir das ganze Territorium verrückt.“
„Ist das der Grund, aus dem du wirklich hierher gegangen bist?“
„Jedenfalls ist es einer davon. Ich habe mir vorgenommen, die Sache mit dir in dieser Nacht so oder so zu entscheiden. Und ich dachte mir, dass meine Argumente auf dich vielleicht Eindruck machen.“
„Denkst du nicht, dass ich dich dafür immer hassen werde, Clint?“
„Darüber habe ich nicht weiter nachgedacht. Auch der Hass schleift sich mit der Zeit ab. Dein Wort genügt mir. - Also?“
„Schieß nur, Clint! Du würdest der Erste sein, der mich erpresst hätte.“
„Natürlich. Du willst deinen Stolz mit ins Grab nehmen. Du gehörst noch zu denen, die meinen, ein schönes Begräbnis wäre auch eine feine Sache. Du vergisst nur, dass der Tote in keinem Fall etwas davon hat und von den Lebenden auch noch verdammt schnell vergessen wird. Willst du wirklich immer ein Narr bleiben?“
„Der Narr bist du doch gewesen, Clint. Und ich wette, du hast das längst erkannt. Es ist nur zu spät.“ Jim sieht auf einmal, dass Sharleen den linken Fuß aus der Schlinge gezogen hat. Clint kann davon nichts bemerken. Und plötzlich tritt sie hart auf den Boden und wirft sich mit dem Stuhl zur Seite. Clint steht frei. Ein Flammenblitz fährt aus der Mündung seiner Waffe und rast Jim entgegen. Er hört das dumpfe Pochen, als die Kugel in die Wand schlägt. Dann zuckt seine eigene Hand im Rückstoß, ohne dass er weiß, wann er den Revolver gezogen hat. Er riecht den faden Pulvergestank und sieht Clint zur Seite springen.
Da fliegt die Tür auf, die in den Nebenraum führt. Ein Mann taucht dort auf und wirft etwas.
Clint taumelt gegen die Wand und bricht zusammen.
„Schießen Sie nicht, Durbin, ich bin es!“, ruft der junge Lieutenant.
Jims Arm mit der Waffe sinkt nach unten.