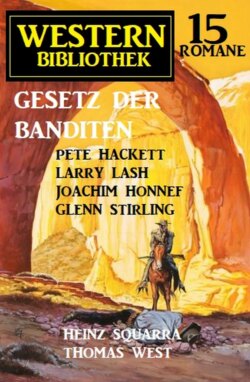Читать книгу Gesetz der Banditen: Western Bibliothek 15 Romane - Pete Hackett - Страница 72
На сайте Литреса книга снята с продажи.
16
ОглавлениеGluthitze lastet über der Treibherdenstadt. Lautes Grölen ist in den Saloons zu hören, die sich um die Verladerampen gruppieren.
Jim reitet vorbei. Schon von Weitem sieht er das Blechschild vor dem Haus des Marshals, hinter dem sich das Jail befindet. Er steigt beim Mietstall ab und sieht den Richter, der ihn erkennt und über die Straße kommt.
„Haben Sie eigentlich den Platz gefunden, an dem sich Ihr Bruder aufgehalten hat, Durbin?“
„Nein.“
„In der Stadt reden die Saloonstramps davon, dass Clint dort noch über zweitausend Dollar haben soll. Und er will natürlich nicht sagen, wo es ist. Ob das stimmen kann?“
„Ich glaube ja, Richter.“
„Vielleicht können Sie sich denken, dass viele Männer in der Stadt sind, die für zweitausend Dollar Kopf und Kragen riskieren.“
„Ich kann es mir denken.“
„Wollen Sie mit Ihrem Bruder darüber reden?“
„Nein.“
„Warum nicht?“
„Weil er es mir auch nicht sagt, Richter. Hat Ihnen der Lieutenant nicht gesagt, was passiert ist und wie er ihn fangen konnte?“
„Doch.“
„Vielleicht sagt er es Ihnen, wenn Sie ihm dafür etwas versprechen.“
„Was soll ich ihm denn noch versprechen? Er ist ein Mörder.“
„Das ist es ja, was er sich selbst ausgerechnet hat. Ich kann Ihnen nicht helfen.“
„Warum sind Sie hierher gekommen, Durbin?“
„Ich weiß nicht. Bestimmt, Richter, ich weiß es nicht!“
David Solar geht über die Straße zurück. Jim führt sein Pferd in den Mietstall. Ja, er weiß wirklich nicht, warum er hierhergekommen ist. Aber vielleicht kommt er noch darauf.
Als er wieder auf die Straße tritt, sieht er den Marshal aus seinem Office kommen. Fünf andere Männer mit Sternen an den bunten Flanellhemden folgen ihm.
„Los, baut euch hinter dem Haus auf!“, kommandiert der Marshal. „Schießt auf jeden, der sich nähern will! Da hinten kann kein Mensch etwas verloren haben.“
Die fünf Deputies gehen um das Haus herum. Der Marshal hat also Angst, dass jemand versuchen könnte, Clint zu befreien, in der Hoffnung, dadurch an das verschwundene Geld zu kommen, von dem vor kurzer Zeit alle noch glaubten, es wäre längst von der Bande ausgegeben worden.
Jim geht zu einem Saloon weiter. Als er an die Theke tritt, steht er plötzlich Lieutenant Walker gegenüber, der sich mit einem Barmädchen unterhält. Als der Offizier gegangen ist, bemerkt Jim, wie das Mädchen mit einem dunkel aussehenden Burschen spricht. Er hört es sagen: „Der weiß nichts. Es gibt nur den einen Weg!“
Der dunkle Bursche nickt und geht.
„Whisky“, sagt Jim, als er den forschenden Blick des Keepers bemerkt. Das Mädchen geht durch eine kleine Tür im Hintergrund.
„Sind Sie wegen des Prozesses gekommen - oder wegen des Geldes?“, fragt der Keeper, als er das Glas über die Schankplatte schiebt.
„Ich bin zufällig hier“, gibt Jim zurück, der froh ist, dass Walker ihn nicht gesehen hat und sonst niemand weiß, wer er ist. Er trinkt den Whisky, bezahlt und geht wieder hinaus.
Eigentlich müsste er dem Marshal jetzt sagen, was geplant ist. Aber der Mann weiß es vielleicht selbst. Zumindest ist er wachsam, wie seine Deputies beweisen. Jim ertappt sich bei dem Gedanken, dass es gut wäre, wenn Clint entkommt und vielleicht auf der Flucht erschossen wird. Er könnte dann wenigstens wie ein Mann sterben.
Er sieht den Richter wieder auf sich zukommen.
„Haben Sie schon ein Zimmer?“, fragt ihn der Mann.
„Nein. Mir ist erst vorhin eingefallen, dass ich nicht genug Geld habe“, erwidert Jim.
„Sie können in meinem Haus schlafen.“
„Damit ich in Ihrer Nähe bin und Sie kontrollieren können, was ich mache?“
„Damit Sie sich nicht noch mit ins Unglück stürzen, Durbin.“
„Danke, Richter.“
„Kommen Sie mit!“
Jim folgt dem Mann.
Mitten in der Nacht schreckt Jim in die Höhe. Er hört Schüsse, deren Echo zwischen den Kistenholzhäusern hin und her weht. Schreie erschallen. Die Tür wird aufgerissen. Vollkommen angezogen steht der Richter im Rahmen.
„Wollten Sie sich davon überzeugen, ob ich noch da bin?“, fragt Jim.
„Vielleicht, Durbin. Es ist gut, dass Sie ein kluger Mann sind. Kommen Sie!“
Jim steht auf und zieht die Hose an. Die Weste streift er über, während er hinter Solar durch das Haus hastet. Als sie auf die Straße kommen, bricht das Coltfeuer schlagartig ab. Der große Marshal kommt auf den Richter zu.
„Sieben haben es versucht“, meint er. „Fünf davon hat der Teufel geholt. Vielleicht bringen meine Leute den Rest auch noch.“
Jim geht ein Stück weiter. Er sieht einen Mann auf der Straße liegen, den ein anderer im Prince Albert Mantel gerade auf den Rücken wälzt.
„Tot“, sagt der Mann, als er sich aufrichtet. Jim erkennt den dunklen Burschen wieder, mit dem das Saloongirl gesprochen hat.
„Holt den Coroner!“, sagt der Mann im Prince Albert Mantel zu den herumstehenden Leuten.
„Dann können wir ja wieder gehen, Durbin“, murmelt der Richter neben Jim. „Hoffen wir, dass der Rest der Nacht ruhig verläuft.“
Sie gehen zum Haus des Richters zurück.
„Ich muss ihn zum Tode verurteilen“, meint Solar, als sie wieder in seinem Haus sind. „Niemand hätte für ein anderes Urteil Verständnis. Aber es könnte jemand ein Gnadengesuch mit Militärgouverneur des Territoriums einreichen.“
„Das abgelehnt wird.“
Solar zuckt die Schultern.
„Das weiß vorher niemand.“
„Es sind Soldaten erschossen worden.“
„Das ist es ja. Aber wegen des Geldes ...“
„Ich glaube nicht, dass Clint sich für eine so fragwürdige Abmachung interessiert, Richter.“
„Sonst habe ich ihm nichts zu bieten.“
„Sie haben ihm so und so nichts zu bieten. Und er weiß es. Er wird sein Wissen mit ins Grab nehmen.“
„Sie müssen ihn natürlich besser kennen als ich, Durbin.“
„Dafür ist er eben mein Bruder“, sagt Jim bitter und wendet sich ab.
David Solar hat einen Colt am Lauf gepackt und schlägt mit dem Kolben auf die Tischplatte.
„Bis du tot bist!“, sagt er in die Stille, die plötzlich in dem überfüllten Saloon eingetreten ist. Leises Gemurmel hebt an. Jim sieht, dass das Gesicht seines Bruders gelb aussieht. Es ist von Schweiß überströmt. Vielleicht ist Clint so hart, dass ihm der Tod nichts mehr ausmacht. Aber die Art - die Art, wie der Richter eben gesprochen hat - die muss einem Mann zutiefst zuwider sein.
„Die Verhandlung ist geschlossen“, sagt der Richter.
Zwei Deputies ziehen den Gefangenen in die Höhe. Sie haben Clints Hände mit einer kurzen Kette gefesselt. Vor sich schieben die Männer ihn hinaus. Ihre Colts drücken in seinen Rücken. Jim sieht, dass sie die Hämmer der Waffen gespannt haben.
Plötzlich wirft sich Clint vorwärts. Jim denkt, dass jetzt zwei Schüsse aufpeitschen müssen, aber das geschieht nicht. Der Marshal springt von der Seite heran und bringt Clint durch einen abgezirkelten Schlag zu Fall.
„Das hast du dir nicht sehr gut ausgerechnet, Durbin“, schnauft der Marshal heiser. „Du sollst doch hängen!“
Sie zerren ihn wieder in die Höhe und schleppen ihn weiter. Jim wird weiß im Gesicht und muss gegen starke Übelkeit ankämpfen.
Das dort ist sein Bruder. Ein hilfloses Opfer, das sie genau zwischen sich haben und dem sie nun nie mehr eine Chance geben werden.
Jim Durbin hämmert das Blut in den Schläfen. Es ist ihm, als müsste er sich jetzt übergeben. Und auf einmal weiß er, dass es richtiger gewesen wäre, er hätte die kleine Ranch am Arkansas River nicht verlassen, denn sein Hiersein hat nichts geändert.
Eine Hand greift nach seinem Arm. Er sieht den Richter neben sich.
„Kommen Sie!“, sagt Solar. Er schiebt Jim neben sich hinaus und zu seinem Haus hinüber. Als sie im Wohnraum stehen, stellt der Richter zwei Gläser auf den Tisch und entkorkt eine Flasche.
„Aus Kentucky“, sagt er. „Ich schätze, das tut Ihnen gut.“
Jim trinkt den scharfen Whisky, aber er merkt, dass es ihm davon nicht besser wird.
„Wann?“, fragt er.
„In vier Tagen, Durbin. Bis dahin kann jemand versuchen, seine Begnadigung beim Militärgouverneur zu erwirken.“
„Sie meinen mich?“
Solar zuckt die Schultern.
„Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand daran interessiert ist.“
„Natürlich nicht. Ob der Militärgouverneur ...“
„Es kommt vielleicht darauf an, wie es ihm erklärt wird und was man ihm vorweisen kann.“
„Vorweisen ...?“
„Sie sollten noch einmal mit Ihrem Bruder reden, Durbin. Wenn Sie dem Militärgouverneur den Ort sagen können, an dem er das Geld finden kann, lässt er vielleicht Gnade vor Recht ergehen. Das ist der einzige Weg, den es noch gibt.“
„Ja, ich verstehe.“ Jim geht auf die Tür zu. Der Richter folgt ihm.
Als sie das Office des Marshals betreten, zieht der Richter Jim den Colt aus der Halfter. Er legt ihn auf den Schreibtisch.
„Er will allein mit ihm reden“, wendet er sich an den Marshal.
Der Mann schließt die blechbeschlagene Tür auf. Jim blickt in den dunklen Gang hinein, von dem rechts und links die Zellen durch dicke Gitterstäbe abgeteilt sind.
„Wir haben nur diesen einen Gefangenen“, erklärt der Marshal.
Jim tritt in den dunklen Gang hinein. Hinter ihm fällt die Tür mit einem leisen Knall zu, bei dem er zusammenzuckt.
Jim Durbin sieht das Gesicht seines Bruders durch das Gitter. Clint liegen die Augen tief in den Höhlen. Sie sind von dunklen Ringen umgeben.
„Was willst du noch?“, fragt Clint grollend, aber seine Stimme schwankt unsicher. „Haben Sie dich geschickt?“
„Ja, Clint.“
„Und das wagst du auch noch zu sagen?“
„Ja, Clint. Es ist zu spät, als dass wir noch mit Spitzfindigkeiten hantieren sollten. Das weißt du besser als ich.“ Jim lehnt sich gegen das Gitter der leeren Zelle in seinem Rücken. „Es wird auch niemand mehr versuchen, dir zu helfen“, redet er weiter. „In der letzten Nacht sind fünf Männer in der Stadt erschossen worden. Nur zwei konnten entkommen.“
„Weiß ich.“
„Ich würde zum Militärgouverneur reiten. Niemand kann ihm deine Geschichte glaubwürdiger erzählen als ich, Clint.“
Clint kommt an das Gitter und krampft die Hände um zwei der angerosteten Stäbe.
„Du?“, fragt er. „Nachdem ich Sharleen ...“
„Ja, ich, Clint.“
„Gib mir deinen Colt, Jim! Du weißt, dass unser Vater immer sagte, es wäre alles nur halb so schlimm, wenn ein Mann wie ein Mann sterben kann.“
„Meinen Colt hat der Marshal, Clint. Er weiß, dass alle Männer in diesem Land über diesen Punkt gleich denken. Vielleicht würde dich der Militärgouverneur begnadigen, wenn ich ihm sagen kann, wo er das Geld findet. Jede Sache hat ihren Preis, das weißt du ja. Ohne das Geld werde ich wie gegen eine Mauer rennen.“
„Begnadigen!“, sagt Clint verächtlich. „Weißt du, was das heißt? Sie würden mich in die Glimmerschieferbrüche schleppen, und dort würde mich die unmenschliche Arbeit und die gnadenlose Hitze töten!“
„Deine Auswahl ist sehr gering, Clint. Ich würde es dem Galgen vorziehen. Es tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Glaube mir, ich würde es tun.“
Clint starrt seinen Bruder sprachlos an.
„Und ich hatte gedacht, du wartest nur auf den Tag, an dem sie es mit mir zu Ende bringen“, stößt er nach einer Weile hervor.
„Du hast dich geirrt. Fertige mir eine Skizze an, Clint! Hier ist Papier und Bleistift.“
Clint greift nach dem Papier und dem Stift und geht zu der Holzpritsche, auf der er vorhin gesessen hat. Als er zurückkommt, sagt er: „Dort, wo die Linie anfängt, hat das Schild gestanden, das ich dir aufstellte, Jim. Du wirst die Höhle leicht finden. Das tue ich nur für dich, mein Junge. Damit sie nicht ewig um das Geld trauern müssen und dich dafür hassen, weil du ein Durbin bist.“
„Ich werde dem Militärgouverneur alles erklären, Clint!“
„Gibst du mir die Hand?“
Jim greift nach der heißen Hand, die sich durch das Gitter streckt. Dann geht er rückwärts zur Tür, und ein unbestimmtes Gefühl sagt ihm, dass er Clint niemals mehr sehen wird.
Der Richter steht neben dem Schreibtisch, als Jim das Office betritt.
„Und?“
Jim legt die Skizze neben seinen Colt.
„Ich würde die Stelle finden“, sagt er. „Aber ehe ich Soldaten in die Arbuckle Mountains führe, will ich mit dem Militärgouverneur reden. Werden Sie alles aufschieben, bis ich zurück bin?“
„Natürlich, Durbin. Das ist meine Pflicht.“ Der Richter schiebt Jim den Colt in die Halfter und geht mit ihm hinaus.
„Ich wünsche Ihnen Glück“, murmelt er. „Wissen Sie, was ich nicht verstehe?“
Jim blickt ihn an, ohne etwas zu sagen.
„Dass zwei Brüder so verschieden sein können“, fährt der Richter fort.
„Wir waren früher sehr gleich“, erwidert Jim. „Nur war Clint immer etwas impulsiver als ich.“
An einem frühen Morgen kommt Jim Durbin in die Stadt zurück. Er sieht Menschen überall vor den Häusern mit den hohen falschen Fassaden stehen. Der Richter lehnt an einen Stützpfosten des Vordaches vor dem Office des Marshals. Jim hält bei ihm an.
„Ich habe ...“
„Ein Bote kam schon vor drei Stunden“, unterbricht ihn der Richter. „Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben und Glück gehabt, Durbin. Aber alles war umsonst.“
„Umsonst?“, fragt Jim heiser, und er ahnt, dass irgendetwas ganz anders gelaufen ist, als er es sich vorstellte.
„Ja, umsonst.“
Auf der anderen Straßenseite rollt ein flacher Wagen vorbei, auf dem ein schmuckloser Sarg steht.
„Dort“, meint der Richter und nickt in der Richtung des Wagens.
Jim weiß, was der Mann meint und starrt den Sarg an. Ein Maulesel zieht den Wagen langsam weiter.
„Nein!“, schreit er.
„Doch, Durbin. Gestern Abend hat Clint dem Deputy, der ihm das Essen brachte, die Waffe entrissen und sich erschossen. Ich glaube, so hat er es sich immer gewünscht.“
„Aber er wusste doch ...“
„Er wollte nur noch wie ein Mann sterben, Durbin.“
„Aber es durfte doch niemand eine Waffe haben, der zu ihm geht?“
Ein langer Blick des Richters trifft ihn.
„Vielleicht habe ich einmal eine Ausnahme gemacht“, sagt er. „Für Sie, Durbin!“
Jim sieht den Richter über die Fahrbahn gehen und dem Wagen folgen. Und plötzlich hat er das Gefühl, als würden die Ruhe und der tiefe Frieden, die von einem stillen Grab ausgehen, an dessen Ende ein verwittertes Holzkreuz steht, auf ihn übergreifen.
ENDE