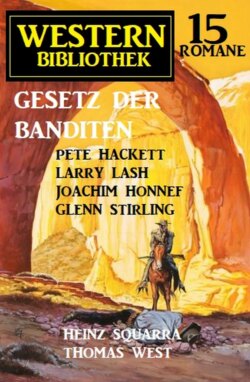Читать книгу Gesetz der Banditen: Western Bibliothek 15 Romane - Pete Hackett - Страница 65
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
Оглавление„Das sind achtzig Dollar“, sagt Sharleen und schiebt das Geld über den Tisch. „Nimm es, Jim! Vielleicht ist er damit zufrieden.“
„So habe ich das nicht gemeint. Nein, Geld kann er von mir nicht bekommen. Ich will noch einmal versuchen, nur daran zu denken, dass er mein Bruder ist.“
Die Lampe flackert, als er aufsteht und zum Fenster geht. Draußen ist es tiefe Nacht. Das leise Rauschen des Flusses dringt aus der Niederung herauf. Die Kette der Berge ist nur zu ahnen.
„Und wenn Clint nicht hören will?“, fragt das Mädchen hinter ihm.
Er wendet sich um. Er sieht die Angst in ihren Augen und weiß, dass alles davon abhängen wird, wie sich Clint entscheidet, falls er ihn überhaupt trifft.
„Dann bleiben für mich nur noch zwei Wege“, entgegnet er. „Entweder ich gehe von hier fort, oder ich stelle mich auf die Seite der Leute, mit denen ich in Zukunft zusammen leben muss. Irgendwann muss sich jeder entscheiden.“
Sharleen kauert sich neben dem Kamin nieder, als würde sie frieren.
„Ich weiß, wie schrecklich das alles ist“, sagt sie nach einer Weile. „Aber wir haben nichts. McBee ist geschlagen und wird an meinem Land kein Interesse mehr haben. Wenn wir fortgehen, sind wir bettelarm, und überall, wohin wir kommen, werden wir es bleiben.“
„Ich habe über alles nachgedacht, Sharleen. Wenn ich fortgehe, gehe ich allein.“ Er geht schnell hinaus, weil er nicht will, dass sie etwas erwidert. Sie hat ihm einmal gesagt, dass hier das Grab ihres Vaters ist, von dem sie sich nicht trennen will. Nein, wenn er fortgeht, so wird er allein gehen. Einmal wird der Tag kommen, an dem sie ihn vergessen hat. Aber warum soll er eigentlich gehen? Warum ausgerechnet er?
Clint soll gehen. Er hat hier nichts zu verlieren. Jim schämt sich über seine Gedanken, weil er weiß, dass er einem Mörder helfen will. Cook war ein Lump, und Jim erinnert sich, dass ein Mann in den Treibherdenstädten nur fünf Dollar zu rauben brauchte, wenn er eine Kugel in den Kopf bekommen wollte. Und McBee hat auch nur das bekommen, was er sich mit seiner Unduldsamkeit und Brutalität verdient hatte.
Jim holt sein Pferd und legt ihm den Sattel auf. Als er den Bauchgurt anzieht, hört er Sharleen hinter sich über den Hof kommen.
„Sage ihm, dass ich ihn darum bitte, fortzugehen, Jim!“
„Ja, Sharleen.“
Der Morgen graut. Die Helligkeit schiebt sich wie von einer unsichtbaren Hand geschoben in das Bergtal herunter. Tau hängt an den Spitzen der Gräser und auf den Blättern der Büffelbohnensprossen, die am Fuß des schmalen, steilen Felsens wuchern, der sich wie ein Finger in die Höhe schiebt. Er ist ungefähr zwanzig Meter hoch.
Jim Durbin hält sein Pferd an und blickt sich im Tal um. Das Grau des anbrechenden Tages und das Grau der steilen Felswände vermischten sich miteinander. Nirgends ist ein Mensch zu sehen. Aber er weiß, dass Abe Johnson und sein Bruder ihn längst bemerkt haben müssen. Vielleicht beobachteten sie ihn schon, als er sich den Arbuckle Mountains näherte.
Jim steigt ab, lockert den Sattelgurt und lässt das Pferd laufen. Er setzt sich am Felsen nieder und wartet. Eine Stunde später ist es so hell, dass er jede Einzelheit im Felsenkessel erkennen kann. Drei Hohlwege münden in das Tal.
Plötzlich rollt irgendwo ein Stein in die Tiefe. Dann klappernder Hufschlag, der sich nähert. Das Echo kommt von überall, so dass Jim nicht weiß, aus welchem der Wege der Reiter kommen wird.
Nach ein paar Minuten taucht der Reiter auf. Er kommt aus dem rechten Hohlweg und hält sein Pferd an. Jim erkennt seinen Bruder. Zugleich hört er den Hufschlag eines zweiten Reiters, der jäh verklingt. Er blickt zum linken Weg, aber dort ist niemand. Da weiß er, dass Abe Johnson nun hinter ihm ist. Vielleicht hat er sein Gewehr schon in der Hand.
Rechts der Reiter ist Clint. Jim scheint es, als wäre das Gesicht seines Bruders schmäler und sehr rau geworden. Er hat sich rasiert. Irgendetwas von früher ist also in ihm haften geblieben. Aber vielleicht weiß er das selbst nicht einmal.
Jim steht auf und lehnt sich gegen den kalten Felsen. Clint treibt sein Pferd durch einen kratzigen Zuruf an. Zehn Meter vor Jim hält er wieder an. Er grinst, aber es wirkt gezwungen und unecht. Hinter Jim klingt der Hufschlag ebenfalls wieder auf, wird vom Gras fast verschluckt und erstirbt dann. Knackend wird ein Gewehrverschluss repetiert.
Clint lacht leise. Es klingt so unecht, wie sein Grinsen aussieht.
„Entschuldige, dass wir dich so lange warten ließen“, meint er. „Wir mussten erst nachsehen, ob noch mehr kommen. Manchmal kann sich auch ein Haufen von der anderen Seite nähern.“
„Ich bin allein.“
„Das wissen wir nun, Jim. Ich habe es auch nicht anders erwartet. Aber mit Vertrauen allein komme ich heute nicht mehr sehr weit. Sie konnten dir auch gegen deinen Willen gefolgt sein. - Bringst du das Geld?“
„Nein, Clint.“
Das Grinsen verschwindet aus dem rauen Gesicht, und Johnson, den Jim immer noch nicht sehen kann, sagt: „Das dachte ich mir gleich. Er ist der geblieben, den ich immer kannte. Natürlich will er uns jetzt irgendetwas einreden.“
Jim schaut nun doch über die Schulter. Johnsons Pferd wird vom Felsen halb verdeckt. Aber der Reiter selbst ist zu sehen. Das Gewehr, das er in den Händen hält, ist auf Jim gerichtet.
„Du hast die dreihundert Bucks also nicht mitgebracht?“, fragt Clint.
„Nein. Ich wollte dir sagen, dass Cook tot ist.“
„Tot?“
„Ja.“
„Dann hätten wir ja fünfhundert verlangen müssen“, meint Johnson. „Aber wer sollte das wissen.“
„Eben“, brummt Clint. „Warum bist du gekommen, Bruder, wenn du die Bucks nicht hast?“
„Ich wollte dir noch sagen, dass du es zu weit getrieben hast. Cook war ein Schwein. Aber das Recht, ihn zu töten, hattest du nicht, Clint. Raine wollte mich schon zu seinem Deputy machen. Wenn es dir irgendwie gelingen sollte, auch Weels zu töten oder seinen Store zu vernichten, dann werde ich den Stern nehmen. Denn dann kann ich nicht mehr anders.“
„Mit anderen Worten, du willst, dass wir aufgeben und verschwinden?“
„Ja, das will ich. Eigentlich darf ich das gar nicht mehr sagen.“
„Sie erwarten wohl von dir, dass du mich tötest oder gefangennimmst?“
„Vielleicht, Clint. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Sie sind alle hinter dir her.“
„Um mich brauchst du keine Angst zu haben. Nur die Guten sterben jung, Jim. Wir sind nun so lange hier, dass sie uns in den Bergen nie bekommen. Wir wollen Geld machen, und wir haben einen feinen Plan entwickelt, wie du siehst. Irgendwie fliegt der Store in die Luft, wenn das Geld bis morgen nicht hier ist. Dann werden die Leute genau wissen, dass mit mir nicht zu spaßen ist.“
„Und er bleibt natürlich hier“, setzt Johnson hinzu.
„Nein“, sagt Clint scharf. „Ich habe eingesehen, dass er uns nichts nützt. Er ist nur eine Gefahr für uns. Jim, du reitest zurück und sagst den Leuten, dass sie das Geld zusammenlegen sollen. Morgen muss es hier sein. Es ist am besten, du bringst es selbst.“
„Ich werde kein Geld bringen, Clint. Ich bitte dich, aufzugeben!“
Johnson lacht klirrend.
„Er bittet dich, Clint! Hast du das gehört?“
Clints Gesicht verzieht sich zu einem Grinsen, und Jim würde seine Worte am liebsten zurückholen. Aber es geht nicht. Sie sind ausgesprochen. Und das Grinsen trifft ihn wie ein Schlag ins Gesicht. So weit ist es mit Clint schon gekommen. Vielleicht hat die Tatsache, dass sie Brüder sind, für ihn schon lange keine Bedeutung mehr.
„Na los, auf was wartest du noch!“, zischt Clint.
„Vielleicht will er dich jetzt töten“, meint Johnson. „Denke an mein Gewehr, Jim!“
„Clint, was hat Weels damit zu tun, dass McBee uns hungern ließ?“
„Eine ganze Menge. Sie haben alle hinter dem warmen Ofen gesessen, mein Junge. Dafür hasse ich sie. Inzwischen spielt das alles keine Rolle mehr. Ich habe damals getan, was getan werden musste. Mein Plan ist nicht so aufgegangen, wie ich es mir ausgerechnet hatte. Nun arbeiten Abe und ich nach einem anderen Plan. - Reite!“
Jim geht zu seinem Pferd und zieht den Sattelgurt an. Er sieht, dass die Mündung von Johnsons Gewehr jede seiner Bewegungen mitmacht. Er weiß, dass Abe schießen wird, wenn ihm etwas verdächtig vorkommt. Vielleicht wartet er nur darauf, um einen Grund zu haben, der Clint einleuchten muss. Er steigt auf und wendet das Pferd.
„Wenn ich zurückkomme, werde ich vielleicht Raines Deputy sein“, sagt er. „Dann kann ich dir keinen Rat mehr geben.“
„Du wirst den Leuten sagen, dass sie klug sein sollen! Denn du weißt, dass du gegen uns keine Chance hast. Wir wollen keine Helden sein, Jim. Wenn wir dich erwarten, dann wird das immer so wie jetzt aussehen. Wir geben keinem eine Chance!“
Jim reitet an Johnson vorbei. Die Entfernung ist zu groß, als dass er etwas unternehmen könnte. Das enthebt ihn der Entscheidung, von der Sharleen einmal gesagt hat, sie müsste ihm das Herz zerbrechen.
Hinter ihm erschallt Johnsons kratziges Lachen, das ihm noch in den Ohren gellt, als er längst den Canyon nach unten reitet und nichts als den klappernden Hufschlag seines Pferdes hören kann.
Es ist Mittag, als er die kleine Ranch erreicht. Er zählt zwanzig Pferde, die im Hof stehen. Neben dem Schuppen ist ein Feuer angezündet worden, um das Soldaten sitzen. Sie haben einen eisernen Dreifuß aufgestellt, an dem ein Kupferkessel über dem Feuer hängt.
Jim sieht den jungen Lieutenant aus dem Haus kommen, den er hier schon einmal traf. Das Gesicht des Mannes sieht finster und irgendwie entschlossen aus. Jim pariert sein Pferd und nickt dem Mann zu. Sharleen taucht in der offenen Tür auf.
„Ich überlege seit zwei Tagen, ob ich Sie nicht wegen Irreführung vor den Richter schleppen sollte, Durbin“, knurrt der Offizier.
Jim sieht, dass sich ein Teil der Soldaten erhoben hat. Der Lieutenant weiß also Bescheid. Es hat nichts genützt, dass er ihn damals in dem Glauben reiten ließ, er wäre Stewart und nichts als ein kleiner Rancher, der seine Ruhe haben will.
„Tun Sie sich nur keinen Zwang an“, gibt er zurück. „Der Richter wird sich gewiss freuen.“
„Sicher, Durbin. Inzwischen habe ich aber erfahren, wohin Sie geritten sind. Haben Sie Ihren Bruder getroffen?“
„Ja.“
„Lebt er noch?“
„Ja.“
„Das dachte ich mir. Deshalb werden wir diesmal mitkommen. Sie brauchen also nichts zu tun, als uns zu führen. Alles andere erledigen wir.“
„Ihr irrt euch alle, wenn ihr denkt, ich wüsste, wo er zu treffen ist.“
„Sie haben ihn doch getroffen.“
„Natürlich. Das heißt, ich habe an einem Felsen gewartet. Und er kam. Wenn Sie mit Ihren Leuten und mir warten, wird er nicht kommen.“
„Versuchen Sie nicht, mich auf den Leim zu führen, Durbin! Sie wissen, wo wir ihn finden und ausheben können.“
„Er weiß es nicht!“, ruft Sharleen. „Das habe ich Ihnen doch die ganze Zeit schon gesagt!“
Der Lieutenant gibt seinen Männern ein Zeichen. Die bilden einen Ring um Jim.
„Kommen Sie freiwillig mit?“
„Ich muss nach Wichita.“
„Sie müssen mit mir in die Arbuckle Mountains, Durbin. Weil ich mir vorgenommen habe, Ihren Bruder zur Strecke zu bringen.“
„Sie müssen sich wohl Sporen verdienen?“
„Ich habe mal einen Fehler gemacht, Durbin. Einen winzigen Fehler. Das brachte mir die Versetzung in dieses verdammte Land ein. Jetzt sehe ich meine Chance. Sie können sich darauf verlassen, dass ich keine Rücksicht auf Gefühle nehme, die fehl am Platz sind. - Also kommen Sie freiwillig mit? Ich lasse Sie auch binden.“
„Tun Sie sich nur keinen Zwang an!“
„Sie sagen immer wieder das Gleiche, Durbin.“
„Ich kann Ihnen noch etwas sagen: Sie werden meinen Bruder nicht finden. Aber er sicher Sie. Die Frage ist, wie viele Ihrer Leute Sie zurückbringen und wie Ihr Vorgesetzter dann darüber denkt. Vielleicht schickt er Sie nach Wyoming. Dann sind Sie zweimal strafversetzt worden.“
Der Lieutenant hebt die Hand. Jim spürt zwei kräftige Hände an seinem Bein und tritt. Jemand springt hinter ihm in die Höhe. Das Pferd bäumt sich auf. Jim wird zu Boden gerissen. Er sieht vier Gesichter über sich und weiß, dass seine Gegenwehr sinnlos ist. Sie zerren seine Hände hoch und binden sie schnell zusammen.
„Ich werde das melden!“, ruft Sharleen.
„Am besten, Sie tun gar nichts, Miss“, knurrt der Lieutenant. „Denken Sie daran, dass wir einen Mörder jagen! - Los, bindet ihn auf sein Pferd!“
„Jim!“, ruft das Mädchen, als sie ihn auf sein Pferd gehoben haben und festbinden.
Er schüttelt den Kopf und versucht zu lächeln.
Als sich die Abenddämmerung über die Berge senkt, erreicht der Reitertrupp das Bergtal, in dem der spitze Felsen in den Himmel sticht.
Der Lieutenant hebt die Hand. Die Soldaten halten hinter ihm an.
„Hier wollen Sie ihn also getroffen haben?“, wendet sich der Offizier an Jim.
„Ja. Wenn Sie einen Kundschafter bei sich haben, dann wird er die Spuren sicher noch finden.“
„Ich habe keinen Kundschafter. Ich brauche auch keinen. Ich habe Sie doch, Durbin. Stellen Sie fest, wohin die beiden von hier aus geritten sind.“
Jim reitet zu dem Felsen weiter. Er folgt der Spur, die zum linken Canyon führt und dort auf dem harten Boden endet.
„Weiter!“, kommandiert der Offizier.
Sie reiten in den Weg hinein. Als sie eine Meile weitergekommen sind, ist es so dunkel, dass sie keine dreißig Meter voraus blicken können.
Plötzlich kracht ein Schuss. Jims Pferd bricht auf der Stelle zusammen, und er selbst wird halb unter dem Pferd begraben.
„Feuer!“, kommandiert der Offizier.
Gewehre krachen. Neben Jim erschallt ein Schrei und ein Soldat stürzt getroffen zu Boden. Das Sirren der Kugeln, der beißende Pulverdampf und die zuckenden Mündungsflammen erfüllen die Schlucht. Wieder ein Schrei und dann die bellende Stimme des Lieutenants: „Zurück!“
Hufschlag und Funken, die von den Hufen aufstieben. Ein gellendes Gelächter, das vielfach von den Felswänden zurückweht.
Dann Stille.
Jim versucht sich zu bewegen, es gelingt ihm aber nicht. Er sieht zwei Klumpen auf dem Boden liegen - zwei tote Männer.
Plötzlich krachen wieder Schüsse. Irgendwo erschallt ein Fluch. Der Lieutenant ist mit seiner Truppe also nur ein Stück zurück und dann umgekehrt. Dann ein Schrei.
„Verschwindet, ihr Hohlköpfe, sonst müsst ihr alle sterben!“, hört Jim die heisere Stimme seines Bruders. Danach folgen in rascher Folge Schüsse und dann wieder Hufschlag, der langsam schwächer wird. Schritte nähern sich. Jim blickt auf und erkennt Clint, der ein Messer in der Hand hat.
„Hast du dich anbinden lassen, damit es aussieht, als würdest du gegen deinen Willen mitkommen?“, fragt Clint.
Jim gibt keine Antwort. Da sieht er Abe Johnson auftauchen.
„Ich bin noch immer bereit, dir diese Arbeit abzunehmen, Clint“, murmelt er. „Du weißt doch nun, dass sie getan werden muss!“
Clint reibt sich mit der Hand über das eckige Kinn. Es sieht aus, als müsste er angestrengt nachdenken. Dann schiebt er das Gewehr zur Seite.
„Wir nehmen ihn mit“, meint er. „Ich habe eine gute Idee, die uns todsicher an die Bucks bringt.“
„Was für eine?“
„Wir holen Sharleen. Sie wird freiwillig mitkommen, wenn ich ihr sage, dass es ihm schlecht geht. Und dann schicken wir ihn noch einmal nach Wichita. Dann bekommen wir das Geld, weil er weiß, dass er es bringen muss.“
Jim starrt seinen Bruder sprachlos an. Kann das wirklich sein? Kann das noch der Mann sein, der einmal der Cowboy Clint Durbin war?
„Was hast du denn?“, brummt Clint. „Ist es dir jetzt, als würdest du mich zum ersten Mal in deinem Leben sehen?“
„Ja, Clint.“
„Ich habe dich immer aus diesem Spiel heraushalten wollen. Du warst für mich der beste Mensch, den ich kannte. Aber nun kämpfst du gegen mich. Es spielt keine Rolle, wie du es getarnt hast. Sie haben dich dazu gebracht, an ihrem Spiel teilzunehmen. Schon heute Morgen!“
Jim weiß, dass er Clint nicht vom Gegenteil überzeugen kann. Er will auch schon gar nicht mehr. Johnson schneidet die Riemen durch, die die Handfesseln mit dem Sattelhorn verbinden.
„Dass wir dem Mädel nichts tun, brauche ich sicher nicht extra zu betonen“, sagt Clint. „Ich denke, du siehst ein, dass wir auf dich Druck ausüben müssen. Jim, du musst endlich begreifen, dass ich jetzt in einer anderen Welt lebe! Du konntest fortgehen!“
Jim antwortet nicht. Er könnte sagen, dass es an ihm, Clint, gewesen wäre, das Land zu verlassen. Aber er weiß, dass jedes Wort sinnlos ist.
„Los, schneide die Stricke an seinem Bein durch und ziehe ihn hervor!“, brummt Clint.
Johnson will sich wieder bücken, als ein dünnes Geräusch durch die Schlucht dringt. Clint zieht sein Gewehr hoch und schießt den Weg hinunter. Die Kugel klatscht gegen eine Felswand und steigt wimmernd in die dunkle Höhe.
„Schneller, sie kommen offenbar zurück!“
Johnsons Messer zerschneidet den Riemen und den Sattelgurt. Er zerrt Jim unter dem Leib des Pferdes hervor und stellt ihn auf die Beine. Das eine ist noch an den Sattelgurt gebunden. Da krachen wieder Schüsse.
„Dort!“, ruft Clint und springt rückwärts. Johnson folgt ihm und schreit: „Komm mit, Jim! Hörst du, komm mit!“
Jim sieht, dass Abe die Waffe auf ihn richtet. Er lässt sich fallen, sieht den aufsprühenden Flammenblitz und spürt einen wahnsinnigen Schmerz in der Hüfte. Über ihn hinweg pfeifen Kugeln, und dann rennen Männer an ihm vorbei. Über ihm taucht das Gesicht des Lieutenants auf.
„Kehren Sie um, hier ist die Hölle“, sagt Jim schwer. „Und holen Sie Miss Stewart von der Ranch. Sie ist in Gefahr.“ Jim merkt, dass die Ohnmacht wie eine schwarze Wand auf ihn zukommt und die Schmerzen auslöscht. Er wehrt sich dagegen, aber es nützt ihm nichts.
Als er zu sich kommt, ist es Tag. Er sieht Sonnenlicht durch ein Fenster fallen. Irgendwo knarren Dielen. Dann sieht er Doc Arien, der ein Stück Holz in der Hand hat.
„Wo ist Sharleen?“, fragt Jim spröde.
„Hier in der Stadt, Durbin. Um sie brauchen Sie keine Angst zu haben. Ihr Bruder und Johnson haben fünf Soldaten ermordet.“
„Davon wollen wir jetzt nicht reden“, meldet sich die Stimme des Marshals.
„Los, nehmen Sie das zwischen die Zähne!“, knurrt Arien. „Jetzt werden wir gleich sehen, was Sie für ein Kerl sind.“
Jim beißt in das Holz, das der Doc ihm in den Mund geschoben hat. Da sieht er den Kopf Raines auftauchen.
„Glüht die Stange?“, fragt der Arzt.
„Ja“, sagt die Stimme des dritten Mannes.
„Dann los! Marshal, wenn er verrückt spielt, schläfern Sie ihn ein!“
Das Gesicht des Arztes verschwindet. Jim spürt eine Berührung an der Hüfte und es ist ihm, als würde ein Messer in seinen Leib gestoßen. Vor seinen Augen beginnen sich die Gegenstände im Zimmer zu drehen, und die Decke will scheinbar auf ihn niederstürzen. Das Holz zersplittert knackend zwischen seinen Zähnen. Sein Körper bäumt sich auf. Da trifft ihn eine Faust ans Kinn und wirft ihn zurück. Minutenlang liegt er still, bis ihn ein so wilder Schmerz durchzuckt, dass die Bewusstlosigkeit zerreißt. Sein Schrei erfüllt das ganze Haus. Der Geruch verbrannten Fleisches breitet sich aus. Klappernd rollt eine Eisenstange über den Boden.
„Das war alles“, sagt der Doc. „Nun wollen wir mal sehen, wie du die nächsten drei Tage überstehst.“