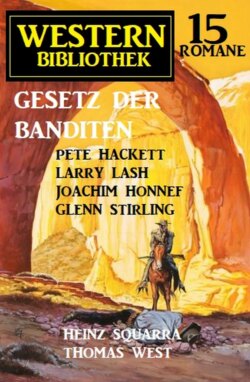Читать книгу Gesetz der Banditen: Western Bibliothek 15 Romane - Pete Hackett - Страница 54
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеEs ist schon dunkel, als Jim die Umrisse der Hütte in der wehenden Schneewand auftauchen sieht. Das Pferd stößt mit dem Kopf gegen die Tür.
„Sharleen, ich bin es!“, schreit Jim mit heiserer Stimme.
Die Tür wird geöffnet. Jim duckt sich so tief auf den Hals des Pferdes, dass er hineinreiten kann. Drinnen lässt er sich seitlich aus dem Sattel gleiten und muss sich am Horn festhalten, um nicht von den steif gefrorenen Beinen gerissen zu werden.
Sharleen blickt noch einen Moment nach draußen, dann wendet sie sich um. Wie ein Nebelstreifen leuchtet ihr bleiches Gesicht durch die fahle Dunkelheit. Jim sieht, dass ein Brett in der Wand zum Anbau fehlt. Sharleen wird es gelöst haben, um das Feuer weiter unterhalten zu können. Er taumelt zu der Bank, in der er die letzten Wochen geschlafen hat, und setzt sich.
Sharleen hat die Tür geschlossen.
„Warum kommt der Doc nicht?“, fragt sie.
Jim weiß nicht, wie er ihr alles erklären soll. Er vergräbt das Gesicht in den eisigen Händen. Er hört ihren leichten Schritt und sieht den verzerrten Schatten, der sich auf dem festgestampften Boden abzeichnet, als sie stehenbleibt. Langsam hebt er den Kopf, bemerkt die Tränen in ihren Augenwinkeln und würde am liebsten in den Boden versinken.
„Du bist geschlagen worden“, sagt sie. „Sie haben dich überfallen, nicht wahr?“
„Nein, Sharleen. Ich muss das Geld verloren haben.“
Sie setzt sich ihm gegenüber auf die Bank, in der Clint immer geschlafen hat. Clint ... Er fragt sich, ob er ihn dafür töten würde, wenn er jetzt hier wäre. Ja, vielleicht. Aber irgendetwas in ihm sträubt sich dagegen, das zu glauben, was geschehen ist. Der Keeper hat es gesehen.
„Der Doc sagte, er würde ohne Geld keine Meile aus der Stadt hinausreiten“, fährt er fort. „Er meint, er würde das im Sommer nicht tun und im Winter gleich gar nicht. Und dann hat er noch gesagt, dass das in allen Branchen genauso wäre. Hier draußen hätte keiner etwas zu verschenken und würde ohne Lohn nichts riskieren.“
Eine Weile herrscht Schweigen. Nur hin und wieder unterbricht ein dünnes Knacken im Feuer die Stille.
„Du sagst nicht die Wahrheit“, stellt das Mädchen schließlich fest. „Du hast sie wiedergetroffen, Jim! Du hast Clint und die anderen in der Stadt getroffen, nicht wahr?“ Ihr forschender Blick scheint bis in sein Herz zu dringen, und er nickt, ohne es zu wollen.
„Sie waren im Saloon“, gibt er zu. „Sharleen, ich werde das Geld besorgen.“
„Woher?“
„Ich weiß, wohin sie geritten sind. Vielleicht sind sie gar nicht sehr überrascht, wenn sie mich im Morgengrauen sehen.“
„Nein, Jim! Wenn sie dir das Geld geraubt haben, werden sie dich auch töten. Hast du Clint nicht gesagt, dass mein Vater krank ist und wir den Doc brauchen?“
„Doch.“
„Dann ... dann müsste ich Angst um dich haben, Jim. Bitte, verfolge sie nicht! Auf unserer Ranch ist noch Geld. Vielleicht ist es wichtiger, wenn du im Morgengrauen wieder in der Stadt sein kannst.“
Jim Durbin weiß, dass er nicht mehr seinem Willen folgt, als er aufsteht und zur Tür geht.
„Setz du dich auf das Pferd!“, meint er. „Ich werde es führen.“
Mitternacht ist vorbei, als sie die Gebäude von Stewarts winziger Ranch in der Nähe des Arkansas River erreichen. Ein ohrenbetäubendes Krachen schlägt an ihre Ohren. Nur wenig vor ihnen donnert etwas zu Boden, und Schnee stiebt in die Höhe. Jim sieht einen kahlen Flügel aufragen, an dem sich sofort der wehende Schnee fängt.
„Was war das?“, fragt das Mädchen.
„Das Windrad, Sharleen. Du musst keine Angst haben. Das Gerüst scheint morsch gewesen zu sein.“ Er hebt sie aus dem Sattel und schiebt sie zur Tür. Als sie das Haus betreten, liegt der Rancher auf den Dielen neben dem Tisch. Ein Stuhl ist umgestürzt.
„Dad!“, schreit das Mädchen entsetzt und rennt auf den Mann zu. Als Sharleen Alan Stewart umgedreht hat, sieht Jim, dass der Mann noch lebt. Er hebt ihn auf und trägt ihn in den nächsten Raum, in dem das Bett steht.
„Zünde eine Lampe an!“, sagt er.
Sharleen reißt ein Schwefelholz über die Tischplatte und steckt den Docht der Lampe an. Ihre Hand zittert, als sie die Lampe in den angrenzenden Raum trägt.
„Er hat offenbar nachsehen wollen, wo du bleibst“, meint Jim, „Aber seine Kraft hat nicht gereicht. Hol jetzt das Geld! Ich nehme ein anderes Pferd und reite sofort zur Stadt zurück.“
Sharleen geht zu einem einfachen Schrank, den Holzwürmer angenagt haben. Als sie mit dem Geldschein zurückkommt, hat Stewart die Augen offen.
„Jim, bist du ... das?“, murmelt er mit hohl klingender Stimme.
„Ja.“
„Ist der Doc ...“ Die Stimme des Kranken bricht ab.
„Er kommt bald“, sagt Jim. „Es kann nicht mehr lange dauern.“
„Es sticht so sehr.“
„Wo?“
„Da hinten“, murmelt der Kranke gepresst und macht eine unbestimmte Bewegung.
„Es ist die Lunge“, flüstert Sharleen kaum hörbar. „Jim, ich habe furchtbare Angst. Wenn er ... wenn er ...“
Jim schiebt das Mädchen auf einen Stuhl.
„Ich werde zwei Pferde nehmen“, sagt er. „Das macht mich schneller.“ Er geht schnell hinaus, holt in der Remise zwei Pferde, die er beide sattelt, und reitet schnell davon. Noch ehe der Morgen graut, hat er die Stadt wieder erreicht. Abermals hämmert er gegen die Tür von Arlens Haus. Es dauert eine Weile, bis drinnen Licht aufspringt und ein verzerrtes Gesicht sich hinter der Scheibe und den festgefrorenen Eiskristallen zeigt.
„Arien, diesmal habe ich fünfzig Dollar!“, ruft Jim. „Los, kommen Sie!“
Das Fenster öffnet sich. Jim schiebt die Hand mit dem zusammengeknüllten Geldschein hinein.
„Warten Sie!“, brummt die ewig mürrische Stimme des Arztes.
Der Sturm hat sich gelegt, als sie die kleine Ranch in der Niederung zwischen den Hügeln erreichen. Auf den hohen Schneewehen vor den Gebäuden spiegelt sich bleiches Sonnenlicht. Noch immer ist es sehr kalt. Sharleen hat den Weg von der Haustür bis zum Brunnen freigeschaufelt. Sie steht mit zusammengezogenen Schultern vor der Tür, als die Reiter absteigen.
Der Doc geht auf sie zu.
„Er ist seit Stunden bewusstlos“, hört Jim Durbin sie sagen.
Arien zerbeißt einen Gruß auf der Zunge und geht an ihr vorbei ins Haus hinein. Das Mädchen folgt ihm langsam. Jim bringt die Pferde in den Stall und sattelt sie ab. Dann geht er ebenfalls zum Haus hinüber. Als er den Raum betritt, in dem der Smallrancher Alan Stewart liegt, richtet sich der Doc gerade auf. Jim erkennt, dass Stewarts Gesicht grau und eingefallen aussieht. Er hat die Augen noch immer fest geschlossen.
„Was ist mit ihm, Doc?“, fragt das Mädchen mit drängender, zitternder Stimme.
„Die Lunge, Miss. Er ist sehr krank! Er muss sich vor einiger Zeit erkältet haben und beobachtete es nicht weiter. Das machen fast alle Männer in diesem Land so.“
„Was kann man nun machen?“
„Im Moment ist er zu allem zu schwach, Sharleen. Außerdem sind meine Mittel sehr begrenzt.“
„Wenn Sie vor sechs Stunden schon hier gewesen wären“, mischt sich Jim ein, „wäre es dann etwas anderes ...“
Der Doc winkt ab.
„Unsinn“, brummt er. „Lungengeschichten sind schleichende Krankheiten, die einen Menschen langsam aushöhlen. Ich sagte doch, er hat sich irgendwann erkältet und es nicht beachtet. Dann wurde es Lungenentzündung.“
„Wann hätten Sie ihm helfen können?“, beharrt Jim eigensinnig.
„Vielleicht vor sechs Tagen“, entgegnet der Doc. „Woher sollte ich denn wissen, dass er mich erst braucht, wenn es zu spät ist. Ich komme in zwei Tagen wieder.“
Als der Arzt gegangen ist, sagt Sharleen: „Arien wurde vor sieben Jahren auf dem Weg zu einer Ranch von streifenden Navajos, die aus einem Reservat ausgebrochen waren, überfallen. Vielleicht erklärt das, warum er die Stadt so ungern verlässt und so viel dafür verlangt.“
„Ja, Sharleen. Ich frage mich nur, ob alles anders gewesen wäre, hätte ich die fünfzig Dollar noch gehabt.“
„Du sollst es vergessen, Jim. Dein Bruder wird nicht zurückkommen. Vielleicht hat das Geld ihn dazu veranlasst, etwas anderes nicht zu tun.“
„Was?“
„Das, was er und die anderen vorhatten. Du weißt doch, was es ist?“
„Nein“, gibt er scharf zurück und wendet sich um. „Ich weiß es nicht, und ich will damit auch nichts zu tun haben.“
Zwei Tage später kommt der Doc wieder. Mit ihm kommt Marshal Brad Raine, dessen Gesicht einer starren Maske gleicht. Die beiden Männer halten draußen an. Der Arzt geht ins Haus. Raine bleibt auf seinem Pferd sitzen.
„Kommen Sie her, Durbin!“, knurrt er. Jim geht zu ihm, obwohl er am liebsten sagen würde, er, Raine, sollte sich selbst den Weg machen, wenn er etwas will.
„Die Kutsche der Kansas Mail ist auf dem Weg von Fort Scott nach Fort Riley überfallen worden. Sie wissen vielleicht auch, dass der Sold für die Soldaten stets um diese Zeit befördert wird.“
„Ich habe davon gehört, Marshal.“
„Der Gunman ist in den Arm getroffen worden“, redet Raine weiter. „Der Kutscher wurde nur niedergeschlagen. Beide haben vier Männer beschrieben. Und zwar die vier, die die zweitausendfünfhundert Dollar aus der Stagecoach raubten und damit entkamen.“
„Ich frage mich, warum Sie mir das erzählen, Marshal.“
„Das wissen Sie doch, Durbin. Sie haben vorher schon gewusst, dass Ihr Bruder die Kutsche mit den anderen überfallen will. Es wäre Ihre Pflicht gewesen, mich davon in Kenntnis zu setzen. Warum haben Sie das nicht getan?“
„Ich habe es nicht gewusst“, erwidert Jim, der sich niemals in seinem Leben so verlassen vorgekommen ist wie in dieser Minute.
„So, nicht gewusst. Eins kann ich Ihnen sagen: Wenn ich Ihnen jemals das Gegenteil beweisen kann, verhafte ich Sie.“
„War das alles, Marshal?“
„Im Moment ja.“
Jim wendet sich um und geht zum Haus hinüber. Ja, er hat es gewusst. Er hat immer gehofft, sie würden doch noch anderen Sinnes werden und die Kutsche fahren lassen. Aber er hat es gewusst. Und nun ist es geschehen. Er hätte Clint verraten müssen. Clint, von dem er annimmt, dass er ihm das Geld eines kleinen, ausgelaugten Ranchers gestohlen hat.
Lynn Arien packt seine Instrumententasche zusammen, als Jim den Raum betritt, in dem der Kranke liegt. Stewart hat die Augen geschlossen.
„Er schläft“, sagt Sharleen leise.
Jim schaut den Doc an. Der zuckt die Schultern.
„Heute kann ich Ihnen genau sagen, dass die sechs Stunden vorgestern gar nichts ausgemacht hätten, Durbin“, murmelt er. „Er scheint sich erst ins Bett gelegt zu haben, als es nicht mehr anders ging.“
„Und wie ...?“
„Ich weiß nicht mehr als Sie. Er braucht Ruhe. Sorgen Sie dafür, dass er nicht aufsteht.“
Als die beiden Männer fortgeritten sind, setzt sich Jim an den Tisch im Vorderraum. Sharleen schließt die Tür.
„Ich habe verstanden, was der Marshal sagte“, meint sie.
„So?“
„Ja, Jim. Er hat recht mit seiner Vermutung, nicht wahr?“
Jim steht auf und geht zum Fenster. Er starrt über das weiße Land und sieht die Berge in der Ferne im Osten.
„Jim, es konnte doch auch sein, dass einer der Männer ermordet wird. Der Fahrer! Oder der Begleiter!“
Er wendet sich mit einem Ruck um und starrt sie an.
„Sie hatten ausgemacht, dass niemand ermordet werden soll“, sagt er scharf.
„Du hast es also gewusst“, stellt sie sachlich fest und wird noch einen Schein bleicher.
„Ja, ich wusste es. Bist du auch der Meinung, dass ich meinen Bruder hätte verraten müssen?“
„Jim, es wäre für ihn und für dich besser gewesen. Für uns alle! Nun ist er verloren. Er hat die Armee bestohlen. Wo er auftaucht, werden sie ihn stellen und hängen.“
„Daran kann ich nichts mehr ändern, Sharleen. Ich konnte ihn nicht dem Marshal ausliefern. Ich hätte vor einem Gericht gegen ihn aussagen müssen.“
„Es wäre ihm vielleicht nichts geschehen.“
„Warum macht ihr alle mir einen Vorwurf daraus? Warum nicht dem mächtigen McBee? Ist es denn ein Wunder, wenn vor Hunger fast wahnsinnige Männer auf solche Gedanken kommen?“ „Nein, Jim. Es war bis jetzt in fast jedem Winter das Gleiche. Du konntest Clint und die anderen retten, und eines Tages wären sie dir sicher dankbar dafür gewesen. Nun ist es zu spät.“
Ihr Vorwurf trifft ihn wie ein Peitschenhieb. Und auf einmal hat er das Gefühl, der Hauptschuldige an allem zu sein. Er, der auf sie eingeredet hat, bis er heiser war.
„Ich meine das anders als der Marshal“, hört er das Mädchen wie aus endloser Ferne sagen. „Sie wären vielleicht eine Weile eingesperrt worden. Mehr konnte ihnen bestimmt nicht geschehen, Jim.“
„Eingesperrt!“, schreit er. „Weißt du denn, was es für einen Mann wie Clint bedeutet, eingesperrt zu werden? Er würde sich befreien! Irgendwie! Und wäre dann genauso, wie er jetzt geworden ist. McBee hätte alles ändern können. Für ein paar Dollar!“
„Unsinn, Jim! Sie haben dir fünfzig Dollar geraubt! Davon hätten sie mehrere Wochen leben können. Und Clint musste wissen, dass du das niemals dem Marshal sagst.“
Durbin wendet sich wieder dem Fenster zu und schaut hinaus. Ja, vielleicht hat sie recht.
„Würdest du mir ein Pferd geben?“, fragt er.
„Zu was?“
„Ich muss ihn suchen.“
„Du solltest hierbleiben, Jim. Jetzt ist es zu spät. Jetzt sind sie wie wilde Tiere, die nur noch ihrem niederen Instinkt folgen. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss.“
„Dann werde ich laufen, Sharleen.“ Er nimmt die Wolfsfelljacke vom Haken und zieht sie an. Dann greift er nach der Winchester und schiebt Patronen aus den Schlaufen seines Gurtes in den seitlichen Füllschlitz. Sharleen sieht, dass ihn keine Macht der Welt mehr aufhalten kann. Er will jetzt etwas erledigen, wahrscheinlich ohne genau zu wissen, was er eigentlich erledigen will.
„Gut, Jim, nimm dir ein Pferd!“, sagt sie. „Aber vergiss nicht, dass wir dich brauchen, wenn McBee diese Weide nicht schlucken soll!“