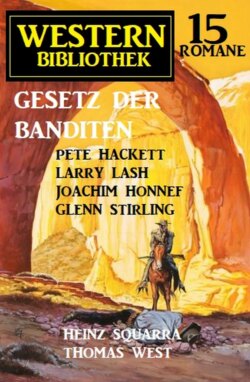Читать книгу Gesetz der Banditen: Western Bibliothek 15 Romane - Pete Hackett - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEine Handvoll entlassener Cowboys steht vor der Existenzfrage. Bittere Not, eine brutal harte Natur und nackte Verzweiflung lässt sie auf die verrücktesten Einfälle kommen. Aber schon keimt auch Hass und Feindschaft, besonders zwischen den Brüdern Jim und Clint Durbin ...
Der schmetternde Hieb trifft Jim Durbin mit voller Wucht gegen die Schläfe und schleudert ihn gegen die Hüttenwand. Ty Peedy, das drahtige Halbblut, springt nach und schlägt noch einmal zu, ehe Jim Durbin eine Bewegung der Gegenwehr machen kann.
„Genug“, sagt Clint Durbin schnaufend, als Jim an der Wand niedersinkt und auf den festgestampften Boden fällt.
Ty tritt langsam zurück. Die Haltung der drei anderen Männer entspannt sich. Der vierte, der in der halbgeöffneten Tür steht, hustet dünn. An ihm vorbei weht der scharfe Wind, treibt Schnee herein und fährt ins Feuer.
„Tür zu!“, knurrt Abe Johnson.
Leat Merrill stößt die Tür zu. Das Feuer beruhigt sich. Draußen tobt der Schneesturm um die Hütte und zerrt am Dach. Im Anbau rasseln die Pferde mit den Gebissketten und stampfen mit den Hufen.
„Ty, binde ihn!“, bestimmt Clint Durbin.
Ty beugt sich über den bewusstlosen Jim Durbin und bringt ein paar kurze Rohlederriemen aus der Hosentasche.
„Kommt ihr nun mit?“, fragt Leat Merrill.
Joe Noel, der große, schmale Reiter mit dem etwas bleich wirkenden Gesicht, stößt ein raues Lachen aus.
„Verschwinde, wenn du unbedingt ein Narr sein willst!“, schnaubt Clint Durbin. „Wir haben dir oft genug gesagt, dass wir nicht mitkommen.“
„Dann werdet ihr verhungern.“
„Wir verhungern schon nicht“, erwidert Joel Noel. „Wir haben bis jetzt gewartet, weil wir dachten, der Rancher habe ein Herz im Leib. Nun warten wir nicht mehr. Mach dir keine Sorgen um uns!“
„Die Männer warten in Dodge City. Sie geben zwanzig Bucks Handgeld.“
„Ja, Leat, das hast du schon mehrmals gesagt. Anschließend schleppen sie dich nach Wyoming, wo du den Dakotas verfüttert wirst. Geh doch, wenn dir so viel daran liegt!“
Leat Merrill blickt sie alle noch einmal der Reihe nach an. Zuerst den großen Clint Durbin mit den dunkel sprühenden Augen. Dann Abe Johnson, den krummbeinigen Texaner; Joe Noel, der fast wie ein Spieler aussieht, ohne jemals einer gewesen zu sein. Dann Tyren Peedy, das Halbblut, das sie wegen seiner Schnelligkeit und wegen seiner verborgenen Messer gefürchtet und um seine Sattelkünste beneidet haben. Das Halbblut, das alle Leute hassen, ohne zu wissen, warum. Und schließlich blickt Leat auf Jim Durbin, Clints Bruder, den sie zusammengeschlagen haben; vielleicht aus Enttäuschung darüber, dass er nur fünf Dollar von der Ranch mitbrachte. Vielleicht aber auch, weil er ihren Plänen wirklich im Wege steht.
„Na geh schon“, knurrt Abe Johnson. „Und einen schönen Gruß an General Terry.“
„Kennst du ihn?“
„Ich war einmal genauso verrückt wie du, Leat. Aber darüber rede ich nicht gern.“
Leat zieht die Tür auf. Schnee weht herein. Der Cowboy schiebt sich schnell hinaus und wuchtet die Tür zu. Joel Noel setzt sich an den rohen Tisch und bringt ein Paket Spielkarten aus der Hosentasche.
„Weiter“, sagt er. „Jetzt stört uns niemand mehr.“
Sie hören, wie Leat Merrill sein Pferd im Anbau sattelt und hinausführt. Die Türangeln knarren. Dann schnaubt das Pferd. Für einen Moment ist Hufschlag schwach zu hören, dann geht er im Heulen des Schneesturmes unter.
Joe Noel hat die Karten ausgeteilt. Ty setzt sich neben ihn auf eine umgestülpte Kiste und stößt sein Messer mit einer raschen Bewegung in die Tischplatte. Sein Blick hängt an dem Fünf Dollar Stück, das auf der Platte liegt, wohin es Jim Durbin legte, als er vor einer Viertelstunde in die Hütte kam.
Joe Noel teilt die Karten aus.
„Wir spielen jetzt um vier Steaks, und in der nächsten Runde um zwei Flaschen RotaugenWhisky“, meint er. „Einverstanden?“
Die Männer nicken.
„Zwei neue“, verlangt Clint Durbin. „Und noch etwas, worauf ihr euch alle einrichten könnt: die Befehle gebe ich!“
Er wirft zwei Karten verdeckt in die Mitte des Tisches. Joe Noel schiebt ihm zwei neue Karten zu, gibt Johnson drei und nimmt sich selbst eine.
„Aufdecken!“, schnarrt er.
Als die Karten offen vor den Männern liegen, sagt Johnson: „Um die Steaks musst du dich also kümmern, Clint. Dafür darfst du jetzt selbst mischen.“
Clint Durbin zieht die Karten zu sich herüber und mischt sie. Er teilt aus, kauft drei neue und legt auf.
„So ein Pech“, sagt Joe Noel grinsend. „Aber vielleicht spielt es auch keine Rolle, wer bestellt. Willst du Revanche?“
Clint Durbin, der wieder verloren hat, schüttelt den Kopf.
„Zu was? Zwei Flaschen reichen für uns. Mehr ist ungesund, denn wir brauchen einen halbwegs klaren Kopf. Also gehen wir.“ Er steht als Erster auf und nimmt seine Mackinawjacke von dem langen rostigen Nagel, der neben der Tür in die Wand getrieben ist. Als er sie angezogen hat, bewegt sich Jim Durbin und hebt den Kopf. Clint geht zu ihm und hockt sich auf die Absätze seiner Texasstiefel.
„Es tut mir leid, dass es so kommen musste“, murmelte er gepresst. „Du weißt, dass es nirgends auf der Welt einen Menschen gibt, der mir näher steht als du. Aber so ist es besser. Wir reiten jetzt. Denke an Sharleen und vergiss, dass du einen Bruder hast! Es macht dir selbst die Entscheidung leichter, denn nun brauchst du nicht mehr für den mächtigen McBee zu reiten. Du kannst zu Alan Stewart gehen und ihm helfen. Vielleicht nützt es ihm etwas.“
„Ihr wollt also ...?“
„Ja, Jim. Wir haben lange genug davon gesprochen. Du weißt ja selbst, dass der Rancher sich nur über uns lustig macht. Oder gibt es eine andere Erklärung dafür, dass er dir fünf Dollar Vorschuss für sechs Männer gab? Dieser Bastard! Im Sommer können wir schuften, im Winter schickt er seine Mannschaft zum Teufel.“
„Das ist überall so. Nicht nur hier. Wo ist Leat?“
„Auf dem Weg nach Dodge City. Er hat gesagt, Soldat wäre noch besser als Bandit. Das muss jeder selbst entscheiden. Wir haben ihn nicht zurückgehalten. Wir wollen auch dir keine Steine in den Weg rollen, Jim. Aber wir mussten dich binden, weil du das vielleicht willst. Du kennst ja unseren Plan.“ Clint Durbin steht mit einem heftigen Ruck auf und wendet sich der Tür zu. Als er die Hand schon auf dem Holzhebel des außenliegenden Riegels hat, schaut er noch einmal über die Schulter und sagt: „Vielleicht treffen wir uns irgendwann noch einmal, Jim. Denke daran, dass keiner von uns gern ein Bandit werden wollte! McBee hat uns dazu gezwungen.“
„Der Winter wird vorbeigehen, Clint!“
„Kann sein, Jim. In zwei Monaten vielleicht. Wenn wir Pech haben, erst in drei. Bis dahin würden wir hier verhungern. Wir haben nichts mehr! Selbst das Brennholz ist alle. Wir wollten dir gern glauben und hofften, dass ein reicher Mann nicht so unmenschlich sein kann, die Boys verhungern zu lassen, die einen langen Sommer über für ihn geschuftet haben. Aber du hast ja gesehen, dass unsere Befürchtungen stimmten. Denke daran, wenn wir uns irgendwo noch einmal treffen und die Vorzeichen sollten dann noch schlechter als jetzt sein.“ Clint Durbin zieht die Tür auf. Heulend fährt der Sturm in die Hütte herein. Einer nach dem anderen gehen die Männer hinaus. Zuletzt geht Ty, der noch einmal zurückschaut, während er sein Messer in den Stiefelschaft schiebt.
„Ty, der Weg wird euch unter den Galgen führen!“, schreit Jim.
Ty nickt, und ein wissendes, fades Lächeln erscheint um seine Mundwinkel.
„Das kann schon sein, Jim“, entgegnet er. „Aber Abe hat gesagt, dass der Strick nicht schlimmer sein kann als der Hunger, der einen Mann von innen her aushöhlt, wahnsinnig macht und dann auch tötet.“
Jim Durbin sieht die Tür zufallen. Im Anbau hört er die Männer ihre Pferde satteln.
„Hast du ihn befreit?“, hört er die Stimme seines Bruders durch die dünne Bretterwand dringen.
„Nein, Clint.“
„Das wollte ich dir auch geraten haben, mein Junge. Er wird sich selbst helfen. Aber er braucht ein paar Stunden dazu. Wir müssen Vorsprung haben, denn er geht mit dem Kopf durch die Wand.“
„Das weiß ich doch, Clint.“
Jim lässt den Kopf auf den eiskalten Boden sinken. Er weiß, dass sie keine Macht der Welt mehr aufhalten kann. Sie werden ihren Plan ausführen. Und dann werden sie gehetzt werden, wie man Wölfe hetzt.
Die Anbautür schlägt zu. Ein Pferd wiehert in das Toben des Schneesturmes hinein.
„Vorwärts!“, hört Durbin seinen Bruder rufen, und er fragt sich, ob es das letzte Wort war, das er von ihm vernahm.
Der Hufschlag verliert sich im Fauchen des Windes. Jim kriecht über den Boden auf die offene Feuerstelle auf dem abgeflachten Stein zu. Auf halbem Wege bleibt er liegen. In seinem Kopf dröhnt es immer noch. Sie haben hart zugeschlagen. Sie haben ihn auf eine Art jeder Entscheidung enthoben, mit der er nicht gerechnet hat.
Sein Kopf sinkt auf den Boden zurück. Er fühlt sich müde und zerschlagen. Alles war umsonst. Er hätte sich die langen Reden sparen können, mit denen er tagelang versucht hatte, ihren bereits gefassten Entschluss rückgängig zu machen. Und er konnte sich auch die Demütigung ersparen, zu dem mächtigen, arroganten McBee zu reiten, der im Winter für seine Reiter nichts erübrigt, weil es keinen Gewinn dafür gibt.
Er schiebt den Arm unter den Kopf, um die Kälte abzuhalten. Er denkt, dass er sich befreien und ihnen folgen müsste, obwohl er weiß, wie sinnlos das ist.
„Clint, bleib da!“, schreit er, obgleich er genau weiß, dass die Reiter ihn nicht mehr hören können und auch nicht hören wollen.
Jim Durbin kriecht weiter auf das Feuer zu. Er wird die Rohlederriemen durchbrennen und ihnen doch folgen. In Wichita kann er sie einholen. Als er die Hände ausstreckt, schieben sich die Ärmel seiner Wolfsfelljacke zurück. Die Hitze der Flammen erreicht seine Handgelenke. Er presst die Zähne aufeinander, um die Schmerzen zu töten. Kalter Schweiß bricht ihm aus allen Poren und brennt auf seiner Haut. Er denkt an Sharleen Stewart, die hübsche Tochter des Smallranchers, die ein Jahr lang darauf gewartet hat, dass er sich entschließt, aus McBees Mannschaft auszutreten. Er hat es nie getan, weil Stewart nicht in der Lage gewesen wäre, auch Clint und die anderen aufzunehmen. Sie hatten immer fest zusammengehalten. Und natürlich hatten sie vor Tagen gedacht, dass er auch diesmal an dem Spiel teilnehmen würde.
Die Riemen werden brüchig. Schwarzer Rauch steigt von ihnen auf. Jim zieht die Hände zurück und reibt den Riemen über die stumpfe Kante des Steines. Als er die Riemen mit einem knirschenden Geräusch zerreißt, befreit er sich die Beine und steht auf. Die Schmerzen an den Handgelenken werden schlimmer, aber er zwingt sich, nicht daran zu denken.
Jim Durbin verlässt die Hütte und geht zum Anbau. Als er die Tür aufzieht, kann er sein Pferd nicht sehen. Enttäuscht kehrt er um. Clint hat an alles gedacht. Und er hat gründlich dafür gesorgt, dass Jim ihnen wirklich nicht nachreiten kann. Vielleicht war er selbst nicht davon überzeugt, dass Jim mehrere Stunden brauchen würde, um sich zu befreien.
Er schiebt sich durch die meterhohe Schneewehe zur Hüttentür zurück. Der eisige Wind sticht wie mit tausend spitzen Nadeln sein Gesicht. Drinnen setzt er sich an der Wand neben dem Feuer nieder und vergräbt das Gesicht in den Händen. Natürlich hat er keine Chance, Wichita zu Fuß schneller zu erreichen, als sie die Stadt verlassen werden. Müdigkeit überkommt ihn mit elementarer Gewalt. Er streckt die Füße aus und stößt den Kupferkessel damit zur Seite. Diesen Kessel haben sie seit Tagen nicht mehr gebraucht. Genauso lange nicht mehr, wie sie nichts zwischen die Zähne bekamen.
Seine Gedanken verwirren sich. Er träumt. Plötzlich ist es um ihn glühend heißer Sommer, und wallender Staub hängt in der Luft ...
Im Traum erlebt er das noch einmal:
Das falbe Pferd bricht so jäh nach der Seite aus, dass er es nicht mehr halten kann und die Steigbügel verliert. Er wird nach links geschleudert und schrammt auf den Rücken. Er sieht den gewaltigen weißgesichtigen Stier auf sich zukommen.
„Nicht!“, ruft er.
Da schiebt sich von links ein Pinto dazwischen. Hart prallen die Körper der beiden Tiere zusammen. Clint Durbin wird durch die Luft gewirbelt und ebenfalls mit dem Rücken auf die Erde geschmettert. Der Stier rast weiter. Noch drei Längen! - Noch zwei!
Jim spürt, dass er unfähig ist, sich zu bewegen. Jetzt wird der Stier über ihn hinweggehen.
Da dröhnt ein Schuss auf. Urgewaltig wird der Lauf des Stieres gebremst. Er fällt wie ein schwerer Sack zur Seite, und der Staub, den er selbst aufwirbelt, senkt sich auf ihn.
Jim Durbin richtet sich auf, blickt zu seinem Bruder hinüber, der sein Leben für ihn wagte, ohne damit etwas zu erreichen. Und dann schaut er auf Ty Peedy, das Halbblut. Ty schiebt eben eine frische Patrone in den Lauf des noch rauchenden Sharpsgewehres und grinst.
„McBee wird traurig sein, wenn er hört, dass sein prächtigster Stier tot ist, Jim“, meint er. „Vielleicht hat er dann etwas gegen den, der ihn erschoss.“
Jim schlägt sich den Staub von seinem Flanellhemd.
„Vielleicht will er ihn davonjagen“, redet das Halbblut weiter.
„Da müsste er eine ganze Menge Reiter davonjagen“, sagt Clint Durbin und hebt seine siebenschüssige Spencer auf. „Nicht wahr, Jim?“
„Ja, Bruder. Danke, Ty. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir sind doch Freunde. Ich werde dir das nie vergessen!“
Gedämpfter Hufschlag ist zu hören. Das Schnauben eines Pferdes erreicht Jims Ohren. Er wirft den Kopf hoch und stößt sich hart an der Wand.
Jäh ist er munter. Ein fader Geschmack liegt auf seiner Zunge. Das Feuer ist fast erloschen. Die Kälte dringt durch jede Ritze in die Hütte herein. Benommen streicht er sich über den Kopf.
Da ist wieder das Schnauben eines Pferdes zu hören. Er richtet sich auf und tastet nach dem Frontiercolt. Das gehörte also nicht mehr zu seinem Traum.
„Jim!“, ruft eine helle Stimme unsicher und fragend, „Jim, bist du hier?“
Durbin lässt den kalten Kolben des Revolvers los und geht zur Tür. Er stößt sie auf, sieht den Kopf des Pferdes und darüber das schmale, vor Frost glasige Gesicht des Mädchens.
„Sharleen ... Was willst du hier?“
Die Tochter des Smallranchers versucht zu lächeln, aber es gelingt ihr nicht.
Jim ist mit zwei Schritten an ihrer Seite, hebt sie aus dem Sattel und schiebt sie zur Hütte. Er zieht das Pferd hinter sich her. Als er die Tür schließt, sagt das Mädchen: „Mein Vater, Jim. Es geht ihm schlecht. Ich wollte den Doc aus der Stadt holen, verfehlte aber den Weg.“
Jim drängt das zitternde Pferd gegen die Wand und greift nach der Hand des Mädchens.
„Er liegt seit gestern im Bett“, meint Sharleen.
„Der Doc wird Geld haben wollen.“
„Fünfzig Dollar habe ich mit, Jim.“
„Gib sie her! Ich reite in die Stadt. Warte hier auf mich!“
„Ich komme mit, Jim.“
„Nein, Sharleen. Ich muss dein Pferd nehmen.“
„Mein ...“ Sie blickt sich in der Hütte um und scheint erst jetzt zu bemerken, dass sie allein sind. „Wo ...?“
„Sie sind fort“, unterbricht er sie rau. „Ich weiß nicht, wohin.“
„Haben sie dein Pferd mitgenommen?“
„Ja, Sharleen. Wir hatten uns nicht mehr einigen können. Vor vier Tagen aßen wir den Rest des Maisbrotes. Zuerst hatten sie ein Rind fangen wollen. Dann sagten sie, dass es danach unmöglich sein würde, McBee zu entkommen, und es wäre sinnlos. Und nun sind sie fort.“
Das Mädchen kauert sich neben dem Feuer nieder und schiebt die spärlichen Holzreste in die Flammen.
„Du wirst hier warten“, sagt Jim Durbin. „In ein paar Stunden bin ich mit dem Doc zurück.“ Er gibt ihr seine Winchester 66 in die Hand und zieht den Sattelgurt des Pferdes nach.
„Jim, du weißt, was sie vorhaben!“, ruft das Mädchen, als er das Pferd hinausführen will.
„Nein, ich habe keine Ahnung.“
„Doch, du weißt es! Ihr habt darüber gesprochen!“ Sie steht plötzlich neben ihm und greift nach seinem Arm. „Sie haben dich gefesselt.“
„Unsinn.“
„Dort neben dem Feuer liegen noch die Riemen. Einen hast du durchgebrannt. Nicht wahr, du wusstest nicht, dass sie dein Pferd mitgenommen haben?“
„Sharleen, es ist sinnlos, darüber zu reden. Jeder muss den Weg selbst wählen, den er gehen will.“
Ihre Hand sinkt von seinem Arm. Sie wendet sich um und kauert sich wieder neben dem Feuer nieder.
„Ja, du hast recht“, hört er sie leise sagen. „Hoffentlich kommen sie nie zurück. Die Leute hier vergessen nicht, dass Clint dein Bruder ist.“
Er zieht das Tier hinaus und wirft die Tür hinter sich zu. Als er in den Sattel steigt, fragt er sich, ob er um den Doc zu holen nach Wichita reiten wird, oder um etwas anderes zu versuchen, von dem er weiß, dass es sinnlos ist.
„Los, verdammt!“, presst er durch die Zähne, weil das Pferd nicht gegen den Sturm laufen will. Er hilft mit seinen mexikanischen Sternsporenrädern nach, und da gehorcht das Tier.
Heulender Wind, stäubender Schnee und beißende Kälte kommen aus der Niederung des Arkansas River und wehen in die Stadt hinein. Hier und da ist der Boden der ausgefahrenen Frontstreet blankgefegt. Und hier und da haben sich Schneewehen vor den Kistenholzhäusern auf gebaut.