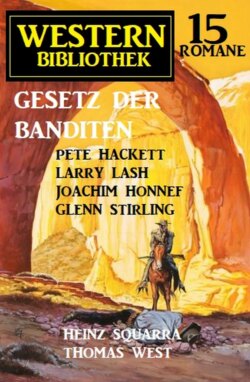Читать книгу Gesetz der Banditen: Western Bibliothek 15 Romane - Pete Hackett - Страница 59
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеEs ist Spätnachmittag, als die verstaubte Schwadron aus der Flussniederung kommt. Der junge Lieutenant, der die kleine Abteilung anführt, hat dunkle Ringe um die Augen. Er hält neben dem Brunnen und legt die rechte Hand, die in einem gelben Handschuh steckt, grüßend an den Hutrand.
Jim blickt den Mann aus schmalen Augen an. Er hat ihn niemals zuvor gesehen. Aber er erkennt an dem Alkalistaub, der sich in den blauen Tuchjacken der Soldaten festgesetzt hat, dass sie aus den Bergen kommen.
„Mister, meine Männer sind durstig“, schnarrt der junge Offizier. „Wir brauchten nur Wasser für uns und die Pferde.“
„Bitte“, gibt Jim zurück.
„Sergeant, lassen Sie absitzen!“
„Absitzen!“, donnert der bärtige Sergeant im Hintergrund.
Die Soldaten steigen mit hölzernen Bewegungen ab. Einer zieht den Eimer aus dem Brunnenschacht. Der Lieutenant streift seine Handschuhe ab, als er auf Jim zukommt.
„Wir waren zwei Wochen in den Arbuckle Mountains“, meint er. „Wir haben nach Clint Durbin gesucht. Kennen Sie ihn?"
„Ich habe in Wichita einen Steckbrief gesehen.“
„Dann wissen Sie ja Bescheid, Mister. Eine gefährliche Bande. Aber nur noch drei Mann. Wir waren ihnen schon dicht auf den Fersen. Da lösten sie eine Lawine aus, und wir mussten zurück. Zum Glück wurde niemand verletzt. Als wir dann auf die Höhe kamen, konnten wir die Spur nicht mehr finden.“
„Da gaben Sie auf?“
„Wo denken Sie hin. Das war vor einer Woche. Aber wir haben die Strolche nicht finden können.“
„Kommen Sie doch herein!“, sagt Sharleen, die in der Tür aufgetaucht ist.
„Danke, Madam ...“
„Stewart“, sagt sie.
Der Offizier geht an Jim vorbei ins Haus. Jim folgt ihm.
„Kaffee?“, fragt Sharleen.
„Ja, danke, Madam. - Übrigens, Mister Stewart, was ich noch sagen wollte: Die Armee hat eine Belohnung ausgesetzt.“
„So?“
„Zweihundert Dollar auf Clint Durbins Kopf. Sie sind hier der Nächste, den er erreichen kann, wenn er aus den Bergen kommt. Vielleicht wollen Sie sich das Geld verdienen. Er braucht nicht unbedingt von vorn getroffen zu werden.“
„Ich verstehe“, sagt Jim und geht wieder hinaus. Er denkt, dass es vielleicht gut ist, dass der junge Lieutenant nicht weiß, wer er wirklich ist.
Eine Stunde später reitet die Schwadron in nördlicher Richtung weiter. So werden sie nicht zu McBee kommen. Und so erfahren sie vielleicht nie, wer er ist.
„Er hat gedacht, wir wären verheiratet“, sagt Sharleen.
Jim blickt an ihr vorbei. Er weiß genau, was sie ihm damit sagen will.
„Wir wollen darüber nicht reden, Sharleen“, gibt er zurück. „Jetzt nicht.“
Die Sonne steht riesengroß über den Arbuckle Mountains. Schräg fallen ihre Strahlen auf die Ranch und spiegeln sich in den Fenstern des Haupthauses. McBee steht an der Verandabrüstung und schaut dem Reiter entgegen. Ein grimmiges, zufriedenes Grinsen sitzt wie fest eingegerbt in seinem rauen Gesicht. Die Männer, die an der langen Wand des Bunkhauses lehnen, schieben die Hände flach hinter ihre Patronengurte, in denen die gelben Geschosshülsen funkeln. Nichts als der schleifende Hufschlag des Pferdes ist zu hören. Manchmal vermischt sich damit das Knarren des Sattelleders.
Jim Durbin hat seine Sattelrolle hinter sich festgeschnallt. Er sieht ihnen allen an, was für eine Freude sie daran haben, dass er kommt. Er muss die Zähne zusammenbeißen, um sein Pferd nicht herumzuwerfen und zu fliehen. Zu fliehen vor der Demütigung, die sie ihm bestimmt zugedacht haben. Als er vor der Veranda anhält, geht der Rancher zur Freitreppe und steigt sie herunter. Auf der vorletzten Stufe hält er an.
„Ich hatte gedacht, wir müssten dich holen“, meint er immer noch höhnisch grinsend. „Es ist für dich gut, dass du ein kluger Junge bist. Steig ab, Jim!“
Jim steigt ab und nimmt die Zügel kurz. In diesem Moment fragt er sich, wie sehr McBee ihn noch reizen muss, bis er ihn wie einen tollwütigen Hund über den Haufen schießen wird.
„Ich habe eine feine Arbeit für dich“, redet der Rancher weiter. „Du weißt ja, dass ich hinter dem Haus Schwarzerde angefahren habe, damit dort Mais wachsen kann. Bis jetzt hatte noch niemand Zeit, den Boden umzulegen. Das wirst du heute machen. Die vier Ochsen im Stall sind ausgeruht. Also, ich denke, heute Abend kannst du fertig sein.“
Jim ist es, als habe ihn ein Peitschenhieb mitten ins Gesicht getroffen. Er sieht, dass das Grinsen des Ranchers breiter geworden ist. Natürlich weiß jeder der Männer, dass es eine Zumutung für einen Cowboy ist. Jim schluckt alles hinunter, was sich auf seine Zunge gedrängt hat. Er führt sein Pferd zur Remise, holt die Ochsen und spannt sie ein. Er zerrt den von Spinnenweben überzogenen Pflug aus dem Schuppen, schirrt die Ochsen davor und lenkt das Gespann über den Hof.
Einer der Cowboys bricht in schallendes Gelächter aus. Jim lässt das Kopfgeschirr des Leitbullen los, geht zu dem Mann hin und fegt ihn mit einem einzigen wilden Hieb von den Beinen.
Die anderen wollen alle gleichzeitig über ihn herfallen, als die klirrende Stimme des Ranchers schreit: „Zurück, ihr verdammten Narren! Wer soll uns denn das Feld umpflügen, wenn er auf dem Boden liegt.“
Jim geht zu dem Leitbullen zurück, greift nach dem Kopfgeschirr und zieht den klappernden Pflug weiter. Als er hinter das Haupthaus kommt, legt er die Pflugschar um, stemmt sich auf die ausladenden Holzarme des Pfluges und treibt die Ochsen an. Am Ende des verwilderten Feldes wendet er den Pflug. Er sieht, dass alle Männer hinter dem Haus stehen und ihm zusehen. Vielleicht hat McBee, der auch dabei ist, ihnen heute freigegeben, damit sie das Schauspiel nicht versäumen.
Aber vielleicht haben sie sich auch mehr davon versprochen, als er halten wird. Er geht hinter dem Pflug her. Bald beginnen ihm die Arme zu schmerzen.
Als die Sonne fast über ihm steht, hat er die Hälfte des Feldes umgelegt. Die Arme und Beine spürt er nicht mehr. Nur der feste Wille, sie um den Spaß zu bringen, hält ihn noch auf den Beinen.
Die Weidereiter haben ihren Platz nicht verlassen.
„Schneller!“, brüllt McBee.
Jim kümmert sich nicht darum. Er merkt, dass die Pflugschar mehrmals aus dem harten, verkrusteten Boden springt. Als er den Pflug wieder wendet, sieht er den Mann, den er niederschlug, mit einer langen Peitsche über das Feld kommen. Der Cowboy hebt die Peitsche und schlägt nach den Köpfen der beiden vorderen Bullen, so dass sie nach der Seite ausbrechen, die beiden anderen Tiere und den Pflug hinter sich herreißen.
Und nun stehen sie sich gegenüber. Ein gemeines, hinterhältiges Lachen kommt tief aus der Brust des Mannes.
„Seid ihr so sehr enttäuscht?“, fragt Jim.
Der Mann schwingt die Peitsche auf und ab. Das bleibeschwerte Ende wirbelt Staub auf.
„Wenn du damit nach mir schlägst, werde ich dich erschießen. Es ist besser, du überlegst dir das reiflich.“
„Bist du sehr schnell?“
„Du hättest die fragen sollen, die schon im letzten Sommer auf dieser Weide waren. Dann wüsstest du es und wärst vielleicht gar nicht hierhergekommen. Oder hat McBee dich geschickt?“
„Vielleicht. Was denkst du, werden sie mit dir machen, wenn du auf mich schießt?“
„Das wird für dich bestimmt uninteressant sein.“
„Los, Henry!“, kreischt eine Stimme. „Sonst muss ich es machen.“
„McBee will nämlich aus dir herausholen, wo sich dein Bruder versteckt hält. Du weißt es doch. Deshalb hat er dich hierher bestellt.“
„Ich weiß, Henry.“
„Dann bist du ein Narr, dass du gekommen bist. Es gab für dich tausend Wege, aus diesem Spiel auszusteigen. Ich muss dir jetzt ...“
„Die tausend Wege, von denen du redest, sind lang, Henry. Wenn du nach mir schlägst, gibt es für dich nur einen Weg. Einen verdammt kurzen Weg, der direkt in die Hölle führt! Du stehst schon dort, wo er anfängt!“
Dem Reiter weicht die Farbe langsam aus dem Gesicht.
„Ja“, sagt er flach. „Ja, Durbin, du bist so einer. Du schießt, obwohl du weißt, dass du dann nicht mehr mit Schlägen davonkommen kannst!“
„So ist es, Henry. Deshalb solltest du ein kluger Junge sein und zurückgehen, auch wenn sie dann über dich lachen werden.“
Henry lässt die Peitsche aus der Hand fallen und wendet sich ab. Zusammengeduckt wie ein geprügeltes Tier geht er zu den anderen zurück.
„Was?“, fragt ein bulliger Kerl.
„Angst“, meint ein anderer. „Nackte Angst vor einem Kerl, den wir fest in der Zange haben.“
Mehrere lachen. Da kommt der bullige Mann mit dem breiten, verkniffenen Mund, der gefurchten Stirn und der Knollennase über das Feld und hebt die Peitsche auf. Jim sieht das Glimmen in den Augen des triebhaften Mannes und weiß, dass er bei ihm seine Worte verschwenden würde. Er sieht die Peitsche hochschwingen und greift zum Kolben.
Da brüllt weit hinter ihm ein Gewehr auf. Der Mann mit der Peitsche zuckt zusammen, öffnet die Hand und fällt hinter der Peitsche her, die in eine Furche gefallen ist.
Jim schaut über die Schulter. Über der langen Rotdornhecke hinter dem Feld weht ein dünnes, weißgraues Pulverdampfwölkchen. Und plötzlich bricht ein Reiter aus den Büschen und fegt zum Fluss hinunter. Obwohl Jim nur den Rücken des Mannes sehen kann, glaubt er, seinen Bruder zu erkennen, und ein Gefühl überkommt ihn, das er vorher nicht gekannt hat.
Schreie und Flüche erschallen hinter ihm. McBee kommandiert irgendetwas, das Jim nicht versteht. Der Reiter verschwindet hinter dem Hügel. Dann donnern sie an ihm vorbei. Dreck wird in sein Gesicht und gegen seine Kleider geschleudert. Ihre Pferde brechen durch die Hecke und jagen den Hügel hinauf. Als er sich umwendet, schaut er in das starre Gesicht des Mannes, der in die Furche gerollt ist. Glasige Augen blicken ihm tot entgegen. Und dahinter tauchen die mit Fransen besetzten Stiefel des Ranchers auf.
Jim blickt auf. Neben McBee steht ein zweiter Mann. Ein junger Bursche mit einem geröteten Gesicht. Er trägt ein buntes Kattunhemd, blaue, neue Lewishosen, vor die er lederne Capperais geschnallt hat. In der Hand hält er die mörderische Sharps mit der 52er Bohrung, deren Kugeln das Herz eines Mannes in tausend Fetzen reißen können.
Zwei andere gehen rechts und links um Jim herum.
„Das war wunderbar“, meint der Rancher. „Noch einen besseren Beweis dafür, dass ihr gut zusammenarbeitet, konntest du uns nicht liefern. Du hast doch gesehen, dass es Clint war?“
Jim schweigt. Er fragt sich, warum er McBee immer noch nicht niedergeschossen hat. Er hat doch keine Angst davor.
„Er will nicht reden“, sagt einer der beiden, die nun hinter Durbin sind.
„Ihm werden die Worte von selbst aus dem Munde fallen“, verspricht McBee dunkel und hebt die Hand. Jim springt vorwärts und schmettert dem Rancher die Faust ins Gesicht. Er hat das Gefühl, gegen einen Granitbrocken geschlagen zu haben, und McBee verzieht nur leicht die Mundwinkel. Da trifft es seinen Hinterkopf. Er stolpert vorwärts, läuft in einen Rammer und sinkt zusammen. Sie zerren ihn hoch, schlingen ein Lasso um seinen Leib und schleifen ihn über das Feld. Am Brunnen binden sie ihn an den Zügelholm.
McBee geht zum Chuckwagen, der neben einem Schuppen abgestellt ist. Dort macht er eine lange Peitsche los und kommt zurück. Als er sie gerade ausgerollt hat, sagt einer der Cowboys: „Der Marshal, Boss. Ich glaube, den kannst du jetzt gar nicht gebrauchen.“
McBee schleudert die Peitsche mit einem Fluch in den offenen Stall hinein und schaut dem ankommenden Reiter entgegen. Jim hört sein Blut in den Schläfen pochen. Wahrscheinlich hätten sie ihn jetzt geschlagen, bis er tot gewesen wäre, denn es hätte nach dem ersten Hieb kein Zurück mehr gegeben. Aber auch ohne Peitschenhiebe ist der Hass nun so groß, dass die Welt für sie beide zu klein geworden ist.
Der Marshal von Wichita hält neben dem Brunnen an und blickt sich im Kreis der Männer um. Zuletzt schaut er auf Jim Durbin.
„Was ist los?“, fragt er den Rancher, den er immer noch nicht anschaut.
„Eine ganze Menge, Marshal. Einer meiner Leute wurde ermordet. Es ist gut, dass Sie kommen. Clint Durbin hielt sich in der Nähe versteckt. Wenn Sie etwas Zeit haben, erleben Sie noch, wie meine Männer zurückkommen und ihn bringen.“
Jim sieht den Marshal aus dem Sattel steigen.
„Und er?“, fragt Raine.
„Er hat bei mir fünf Dollar abzuarbeiten. Und er hatte Clint in der Nähe postiert. Ich schätze, nach der Bande braucht nun niemand mehr lange zu suchen. - Kommen Sie!“
Raine geht hinter McBee her um das Haupthaus herum.
Am Nachmittag kommen die Reiter zurück. Sie haben Clint nicht bei sich. Ihre enttäuschten Mienen sagen Jim alles. Sie haben Clint nicht stellen können. Er fragt sich, ob er sich darüber freuen soll.
McBee steht mit dem Marshal auf der Veranda. Der Rancher winkt dem Vormann zu sich hinauf und verschwindet mit ihm und Raine im Haus. Nach zwanzig Minuten kommen sie heraus.
„Ich gebe Ihnen fünf Leute mit, Raine“, meint der Rancher. „Man kann nicht wissen, ob die Halunken schon irgendwo lauern, um Ihnen den Gefangenen abzujagen.“
Jim sieht, dass Raine nickt. Der Mann kommt die Freitreppe herunter. Zwei Cowboys schneiden die Stricke durch, mit denen er an den Zügelholm gebunden ist. Sie fesseln ihm die Hände auf den Rücken und setzen ihn auf das Pferd, auf dem er am frühen Morgen gekommen ist. Seine Beine werden am Bauchgurt des Sattels befestigt.
McBee bestimmt die Männer, die den Marshal begleiten sollen. Dann reitet die kleine Schar los. Jim sieht, dass die Männer ihre Gewehre in den Händen halten. Als sie über den ersten Hügel sind und vor ihnen Büsche am Rande der Wagenpiste auftauchen, schlagen sie einen weiten Bogen.
Nichts geschieht. Eine Stunde später hält der Marshal an. Er blickt auf die leuchtenden Prärie-Anemonen im Büffelgras und sagt zu dem Reiter neben sich: „Sie reiten zu Miss Stewart und sagen ihr, was vorgefallen ist.“
„Gut, Marshal.“
Als der Mann fortgeritten ist, setzt sich der Trupp wieder in Bewegung. Der Marshal lenkt sein Pferd an Jims Seite.
„Der Richter in Dodge City wird feststellen müssen, wie tief Sie in die Sache verstrickt sind“, sagt er. „Eines kann ich Ihnen aber jetzt schon sagen, Durbin: Nur wenn Sie uns helfen, können Sie Ihren Kopf retten.“
„Sie reden, als gebe es keinen Zweifel mehr daran, dass ich ein Bandit bin.“
„Gibt es auch nicht, Durbin. Oder haben Sie irgendeine Erklärung dafür, dass Ihr Bruder in der Nähe war und einen Mann erschoss?“
„Ich habe dafür keine Erklärung. Aber da das, was Sie annehmen, nicht stimmt, wird es mir der Territoriumsrichter auch niemals beweisen können.“ Jim blickt den Marshal direkt an. „Haben Sie eigentlich gemerkt, was McBee vorhatte?“
„Wichtig ist, was getan wurde, Durbin. McBee wurden Rinder getötet. Ein Mann erschossen. Man muss alles in einem festen Zusammenhang sehen.“
„Natürlich, Marshal. Sie meinen, man muss von der Tatsache ausgehen, dass Clint und ich Brüder sind.“
Marshal Brad Raine dreht den Docht der Lampe höher. Es wird heller im Office. Sharleens bleiches Gesicht ist deutlicher zu sehen. Jim Durbin steht mit auf den Rücken gefesselten Händen neben dem Ofen. Einer der Cowboys hat einen Topf, in dem sich eine dicke Socorromehlsuppe befindet, auf die Herdplatte gestellt.
„Sie behaupten also, Clint wäre bei Ihnen gewesen“, brummt der Marshal. Sharleen nickt.
„Ich behaupte es nicht nur, es stimmt sogar, Marshal. Er kam, kurz nachdem Jim fortgeritten war, um die fünf Dollar abzuarbeiten, die er im Winter Vorschuss für alle Männer bekommen hatte.“
„Hmm. Und Sie haben dann zu Clint also gesagt, dass Jim nun für alle anderen arbeiten müsste?“
„Ja. Daraufhin ritt er gleich wieder weg.“
„In welcher Richtung?“
„Süden.“
„Also direkt zu McBee.“
„Das weiß ich nicht.“
„Wir wissen das inzwischen. Wann war Clint vorher das letzte Mal dagewesen?“
„Er war noch nie da.“
„Und was hat er von seinem Bruder gewollt?“
„Danach habe ich ihn nicht gefragt, Marshal.“
Brad Raine schaut Jim an.
„Die Tatsache, dass du ihn in den Bergen getroffen hast, bleibt bestehen“, brummt er.
„Ich habe ihn nicht getroffen. Er hat mich getroffen. Er wollte mich zwingen, mit ihm zu reiten, aber ich entkam.“
„Ja, Durbin. Das ist eine sehr glatte Geschichte.“
„Sie wollen ihm mit Gewalt etwas andichten!“, ruft das Mädchen schrill. „Warum, Raine? Warum wollen Sie aus einem guten Mann mit Gewalt einen Wolf machen? Er kann doch nichts dafür, dass sein Bruder über die Postkutsche hergefallen ist, weil er glaubte, den Hunger nicht mehr aushalten zu können! - Hören Sie nicht? Dafür kann Jim nichts!“
„Regen Sie sich nicht auf, Miss Stewart. Wenn ein Mann weiter nichts will, als nur seinen Hunger zu stillen, dann braucht er deswegen nicht gleich zweitausendfünfhundert Dollar zu nehmen.“
„Jim hat damit nichts zu tun! Niemand kann ihm einen Vorwurf daraus machen, dass sein Bruder zum Banditen geworden ist.“
„Das macht ja auch niemand. Aber Tatsache ist, dass er ihn in den Bergen getroffen hat. Und Tatsache ist weiter, dass Clint bei Ihnen war und hofft, seinen Bruder zu treffen. - Durbin, was hat Ihr Bruder gewollt?“
„Woher soll ich das wissen?“
„Vielleicht hattet ihr irgendetwas ausgemacht.“
Der Cowboy neben Jim nimmt den Topf vom Herd, setzt sich in der Ecke auf einen Stuhl und beginnt zu essen. Jim blickt von einem der Männer zum anderen. Sie stehen überall: am Fenster, an der Tür, und einer mit dem Colt in der Hand direkt neben ihm. Sie wollen ihm keine Chance geben. Weder die zur Flucht, noch eine andere. Zugleich weiß Jim, dass der Marshal von sich aus nichts gegen ihn unternehmen kann. Er braucht den Richter.
„Es ist gut, Miss Stewart. Der Cowboy bringt Sie morgen Vormittag zurück.“
Sharleen schaut Jim an.
„Du musst keine Angst haben“, sagt er. „Der Richter wird wissen, dass sich keiner seinen Bruder aussuchen kann.“
„Ich habe bereits einen Boten nach Dodge City geschickt“, erklärt der Marshal. „Vermutlich ist der Richter übermorgen hier.“
Sharleen lässt sich von dem Cowboy hinausschieben.
„Bringt ihn in die Zelle!“, knurrt der Marshal. Seinem Gesicht ist die Enttäuschung anzusehen.
Der Cowboy neben Jim macht eine Bewegung mit seinem Revolver. Jim geht vor ihm her. Einer hat schon die starke Bohlentür geöffnet, die ins Jail führt.
Schnell sinkt die Dunkelheit über die Stadt. Knarrend öffnet sich die Tür von Raines Haus, und Jim tritt auf die Straße hinaus. Der weißhaarige Richter folgt ihm.
Jim bleibt an der Stepwalkkante stehen. Überall sieht er Menschen stehen, die ihn anstarren. Er liest in ihren Augen wie in aufgeschlagenen Büchern. Sie haben etwas gegen ihn. Vielleicht hat sogar der Richter etwas gegen ihn, obwohl er ein sachlicher und kluger Mann ist.
„Sie müssen versuchen, die Männer zu verstehen, Durbin“, sagt der Richter leise. „McBees Ranch ist der Lebensnerv dieser Stadt. Und Ihr Bruder nagt daran. Er will McBee vernichten. Daran gibt es keinen Zweifel. Dagegen wehren sich die Leute. Ich bin überzeugt, dass Sie damit nichts zu tun haben. Deshalb sind Sie wieder frei. Vielleicht sollten Sie fortgehen.“
Jim blickt zum Saloon hinüber.
„Oder Sie helfen uns“, fährt der Richter fort. „Das würde die Männer anderen Sinnes machen.“
„Sie wissen genau, dass ich Ihnen gar nicht helfen könnte.“
„Davon haben Sie mich nicht überzeugen können. Das hatte ich Ihnen noch sagen wollen.“ Der Richter wendet sich ab und geht ins Office zurück.
Jim steigt die Stufen hinunter und überquert die Straße. Als er den Saloon betritt, ist außer dem Keeper niemand zu sehen. Zwei Lampen verbreiten trübes Licht. Das Gesicht Matt Cooks sieht gelb aus. Vielleicht ist das Licht daran schuld.
Jim geht bis zur Theke und lehnt sich dagegen. Natürlich weiß Cook nun auch, dass er seinen Bruder getroffen hat. Und sicher kann er sich denken, dass bei dieser Gelegenheit über Manches gesprochen wurde. Beispielsweise über fünfzig Dollar, die Jim im Winter in der Tasche hatte, als er hier hereinkam. Cook hustet trocken. Es klingt wie das Bellen eines Hundes.
„Whisky? ... Sie ... ich meine, ich schenke Ihnen auch einen, Durbin.“
„Sie brauchen mir nichts zu schenken, Cook. Geben Sie das Geld freiwillig heraus?“
Der Keeper weicht gegen das Regal zurück. Angst flackert in seinen Augen.
„Ich verstehe nicht, Durbin. Ich habe kein Geld.“
„Doch, Cook. Sie verstehen ganz genau. Ich hatte die Sache vergessen wollen, sonst wäre ich schon eher gekommen. Aber inzwischen ist Vieles geschehen. Jetzt kann ich nichts mehr vergessen und nichts mehr auf sich beruhen lassen. Geben Sie die fünfzig Dollar heraus, denn sie gehören Sharleen Stewart. Ich hatte das Geld damals bei mir, weil ich den Doc holen sollte.“
„Ich weiß wirklich nicht, von was Sie reden, Durbin“, zischt der Keeper.
Jim geht um die Theke herum. Cook flieht zur Küchentür. Er reißt den Mund auf und schreit: „Hilfe! Überfall!“
Jim will ihm nachspringen, als er hört, wie die Schwingtür aufgestoßen wird.
„Durbin!“, ruft der betagte Richter. Jim geht zurück.
„Er wollte mich überfallen!“, keift der Keeper. „Nehmen Sie ihn fest!“
Der Richter ist stehengeblieben. Er scheint nicht zu wissen, was er jetzt tun soll.
„Er hat mir fünfzig Dollar aus der Tasche gezogen“, meint Jim. „Und zwar damals, als ich und der Marshal bewusstlos hier im Saloon lagen. Die Geschichte hat Raine Ihnen ja erzählt. Nur wusste er eben nicht, dass ich das Geld hatte. Cook behauptete, mein Bruder habe es an sich genommen.“
„Ach so. Und als Sie Ihren Bruder getroffen haben, hat der gesagt, er hätte es nicht?“
„Ja. Ich habe an der Art, wie er es sagte, gemerkt, dass er es wirklich nicht hat. Sehen Sie sich Cook an. Ein Mann, der nichts zu verbergen hat, braucht keine Angst zu haben.“
„Er lügt!“, schreit der Keeper.
„Er denkt, dass der am lautesten schreien kann, auch recht haben muss“, meint Jim. „Ich weiß selbst, dass ich es nicht beweisen kann. Ich wollte die Sache gern ohne Aufsehen aus der Welt schaffen. Es wäre ganz einfach gewesen. Er brauchte das Geld nur herauszugeben.“
„Er lügt!“, keift der Keeper wieder.
„Sie sollten die Stadt sofort verlassen“, sagt der Richter leise. „Gehen Sie weit fort, Durbin!“
„Er wollte mich überfallen!“, zischt der Keeper. „Sie müssen ihn festnehmen! Ich verlange es!“
Der Richter blickt den Salooner einen Moment an, dann wendet er sich wieder an Jim und sagt: „Sehr weit fort, Durbin. Einen anderen Rat kann ich Ihnen nicht geben.“
„Festnehmen, Mr. Solar!“
„Hören Sie auf, Cook! Noch ist ja nichts geschehen.“
„Sie glauben ihm wohl?“
„Was ich glaube, ist ganz unwesentlich. Ich bin Richter und habe mich an Tatsachen und Beweise zu halten, Cook. Weder das eine noch das andere lässt sich hier beweisen. - Kommen Sie, Durbin!“
Jim spürt sich am Ärmel ergriffen und hinausgezogen.
„Los, nehmen Sie Ihr Pferd!“, drängt der Richter.
„Sie irren sich, wenn Sie glauben, ich würde verschwinden“, gibt Jim zurück.
„Ich habe Ihnen etwas verschwiegen, Durbin. Ein Kurier der Armee hörte, was Raines Bote zu mir sagte. Der Kurier ist nach Fort Riley geritten. Es kann sein, dass von dort bald Soldaten kommen, die Sie auffordern, mit ihnen in die Berge zu reiten. Ich weiß nicht, in welcher Form das geschehen wird. Aber ich weiß, dass die Soldaten auf die Ergreifung Ihres Bruders immer noch sehr verrückt sind, auch wenn es nicht so scheint. Vielleicht habe ich Ihnen hauptsächlich deshalb einen guten Rat geben wollen.“
„Ach so.“
„Ja. Durbin. Ich kann Sie sehr gut verstehen. Ich weiß, wie schnell aus einem guten Mann ein schlechter gemacht werden kann. Ich will Ihnen doch nur helfen, zum Teufel!“
Jim sieht den Stallburschen, der sein Pferd über die Straße führt. Wahrscheinlich hat der Richter ihm befohlen, das Tier zu satteln. Er weiß genau, dass er nicht fortreiten wird. Sharleen wird das, was ihr Vater aufgebaut hat, um keinen Preis verlassen wollen. Und ohne sie geht er nicht.
Als er im Sattel sitzt und den Richter anschaut, weiß er, dass dieser Mann enttäuscht sein wird. Aber es geht nicht anders.
„Sie müssen immer daran denken, dass meiner Macht enge Grenzen gesetzt sind“, meint David Solar. „Dort, wo die Armee im Spiel ist, bin ich beinahe machtlos.“
„Ich weiß wirklich nicht, wo sich mein Bruder versteckt hält.“
„Nehmen Sie nur an, Sie würden mit den Soldaten durch die Berge reiten und ihn treffen. Das wollen Sie doch nicht, oder?“
„Nein.“
„Dann tun Sie, was ich Ihnen sagte.“ Der Richter schlägt dem Pferd auf die Hinterhand.
Die Tür des Hauses öffnet sich langsam, als er im Hof anhält. Rechts wird die Trommel eines Colts ratschend durchgedreht. In der Lichtbahn, die aus dem Haus fällt, steht Sharleen.
„Wer ist noch hier?“, fragt Jim.
„Clint. Er will mit dir sprechen. Ich habe ihm gesagt, dass er dich in Ruhe lassen soll, Jim. Aber er blieb.“
Jim blickt über die Schulter. Von der Schuppenwand löst sich eine Gestalt. Ja, es ist Clint. Er hat den Colt noch in der Hand.
„Hallo, Jim. Haben sie dich laufenlassen?“
„Das siehst du doch.“
„Natürlich. Wollen wir nicht ins Haus gehen?“
„Es ist Sharleens Haus, Clint. Warum willst du sie in eine Sache hineinziehen, die sie nichts angeht und nur Unglück über sie bringen kann?“
„Ich wollte dir sagen, dass ich Freunde gefunden habe. Sie warten in den Bergen und möchten dich kennenlernen. Hast du schon erzählt, dass ich das Geld noch habe?“
„Nein. Ich wurde gar nicht danach gefragt.“
„Das ist gut.“
„Trotzdem sucht die Armee dich immer noch.“
„Ja, ich weiß. Pass mal auf! Ich bin jetzt in der Lage, eine große Herde spurlos verschwinden zu lassen. Ich weiß Leute, die nicht danach fragen, vorher haben wir dann andere Namen und sind auch keine Brüder mehr. Gefällt dir das wirklich nicht?“
„Nein, Clint. Du konntest dir den Weg sparen. Ich muss nun sogar noch einmal in die Stadt reiten und dem Marshal sagen, dass McBee ermordet werden soll. Das ist meine Pflicht.“
„Abe sagte schon, dass mit dir darüber doch nicht zu reden wäre. Ich wollte es ihm nicht glauben. Deshalb bin ich gekommen.“
„Deshalb warst du schon einmal hier, nicht wahr, Clint?“
„Ja. Ich werde dich zwingen, mit mir zu kommen. Und eines Tages wirst du mir dafür sehr dankbar sein.“
„Willst du mich zwingen?“
„Das sagte ich doch. Los, Mädel, bring mein Pferd her! Du reitest vor ihm!“
„Wirst du schießen, wenn ich nicht mitspiele?“
„Ganz bestimmt, Jim. Ich töte dich nicht. Aber ich bringe dich dorthin, wohin du gehörst. Nämlich zu meinen Leuten. - Los, Mädel!“
Sharleen geht zum Stall und holt das Pferd. Jim blickt auf die Mündung des Colts, die sich wieder gehoben hat.
„Ein Schuss in den linken Arm ist eine schmerzliche Sache. Aber sie braucht nicht unbedingt gefährlich zu sein. Wir haben noch etwas Zeit, dich wieder fit zu machen, mein Junge!“
Jim achtet genau auf den Revolver, als sein Bruder in den Sattel steigt. Die Mündung bleibt auf ihn gerichtet. Sharleen geht zum Haus zurück und verschwindet darin. Als sie wieder auftaucht, hat sie das Sharpsgewehr ihres Vaters in den Händen.
„Werfen Sie den Colt weg, Clint!“, sagt sie scharf.
Clint lacht leise.
„Du hältst mich für sehr dumm, Mädel“, brummt er. „Natürlich habe ich das Gewehr entladen, als ich im Haus war. Ich hatte doch Zeit genug. - Los, Jim, vorwärts!“
Jim wendet sein Tier. Als er anreitet, hört er die knirschenden Huftritte des zweiten Pferdes hinter sich.
„Clint, ich werde dem Richter sagen, dass Sie ihn dazu gezwungen haben!“, ruft Sharleen.
„Das kannst du machen. Es spielt keine Rolle. Schneller, Jim!“
Als sie am Corral vorbei sind, wirft sich Jim mit einem gewaltigen Satz nach links. Er schrammt auf die Erde, hört den peitschenden Abschuss und sieht das verzerrte Gesicht seines Bruders für einen Herzschlag in der aufsprühenden Mündungsflamme. Die Kugel geht über ihn hinweg. Er rollt sich einmal um seine eigene Achse, greift nach der Hüfte und schwingt den Colt hoch, als der zweite Abschuss aufbrüllt. Die Kugel liegt zu hoch. Clint scheint ihn nur erschrecken und einschüchtern zu wollen. Jim schießt zurück. Das Pferd bäumt sich mit einem schrillen Wiehern auf und wirft den Reiter aus dem Sattel. Es wirft sich noch halb herum, dann knickt es ein. Staub weht wie ein dichter Vorhang vor der Lichtbahn, die aus dem Haus fällt.
Jim springt auf, sieht, dass sein Bruder gefallen ist und schleudert ihm, als er sich aufrichten will, den Colt mit einem raschen Schnappen des Handgelenkes entgegen. Die Waffe trifft Clint gegen die Stirn und wirft ihn zurück. Jim springt nach, hechtet seinen Bruder an und schmettert ihm die Faust ins Gesicht. Clints Hinterkopf schrammt auf den Boden. Seine Hand öffnet sich.
Als Jim sich aufrichtet, kommt Sharleen über den Hof. Sie hat noch immer das Gewehr in der Hand. Jim bückt sich nach seinem Colt und schiebt ihn in die Halfter.
„Er ist bewusstlos?“
„Ja, Sharleen. Aber er wird gleich wieder zu sich kommen.“
„Musst du ihn jetzt nach Wichita bringen?“
„Ich weiß nicht, Sharleen. Aber ich glaube, der Richter erwartet nicht, dass ich meinen Bruder an den Galgen liefere.“
„Es würde dir auch das Herz zerbrechen. Du müsstest immer wieder daran denken.“
Jim lehnt sich gegen einen Pickettpfahl. Clint bewegt sich, öffnet die Augen und richtet sich in sitzende Stellung auf. Er greift nach der Waffe und blickt auf Jims Colt, der auf ihn gerichtet ist.
„Nimm mein Pferd!“, sagt Jim. „Reite fort und komm nie mehr zurück! Nimm deine Bande, wenn du es unbedingt willst, und geh in ein anderes Land, sonst geschieht ein Unglück, Clint! Vergiss auch McBee. Ein Unrecht lässt sich durch ein anderes nicht gutmachen. Denke daran!“
Clint steht auf und schlägt den Sand von seiner Hose. Er geht zu dem zweiten Pferd und steigt in den Sattel.
„Wir sind komische Kerle“, meint er. „Wir sollten uns so sehr hassen, dass wir aufeinander schießen, wenn wir uns nur sehen. Aber es ist anders - ganz anders. Jedenfalls weiß ich nun, dass du dich nicht auf meine Seite stellen willst.“
Jim antwortet nicht. Es sieht so aus, als wollte Clint noch mehr sagen. Doch dann wendet er sich ab und reitet fort.
„Vielleicht kehrt er um und kommt von der anderen Seite zurück.“
„Glaube ich nicht, Sharleen. Er hat nur gehofft, durch den Zwischenfall mit McBee und durch die Tatsache, dass er nun eine ganze Bande hat, könnte sich meine Meinung geändert haben. Er kommt nicht mehr zurück.“
„Aber die Gegend verlässt er nicht. Dazu hasst er McBee zu sehr. Weißt du, was ich manchmal denke?“
„Nun?“
Er hasst McBee dafür, dass er ihn zu einem Banditen gemacht hat.“
„Das kann sein.“ Jim geht zum Stall, um Lassos und ein Pferd zu holen, mit dem er den Kadaver wegschleifen kann.