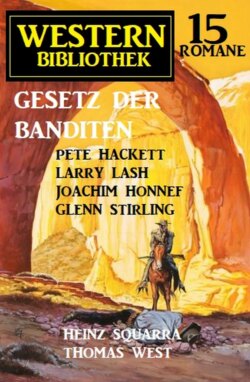Читать книгу Gesetz der Banditen: Western Bibliothek 15 Romane - Pete Hackett - Страница 56
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеEs ist April geworden. Wochenlang ist warmer Wind vom Golf von Mexiko heraufgekommen und hat den Schnee verschwinden lassen. Die Flüsse sind angeschwollen. Sonst erinnert nichts mehr an den gnadenlosen Winter, der ein paar gute, raubeinige Männer zerbrochen hat.
Jim Durbin blickt der Kavallerieabteilung nach, die in westlicher Richtung Dodge City verlässt. Sie waren von Osten gekommen.
Der Blick des Cowboys kehrt in die Stadt zurück und saugt sich an der Tafel an der Wand des Marshalhauses fest. Der vergilbte Steckbrief hängt immer noch dort. Er hing schon an dieser Stelle, als er vor zwei Monaten das erste Mal in die Stadt kam.
„Hast du gehört, was der Lieutenant sagte?“, fragt ein Mann im blauen Overall einen anderen.
„Natürlich, Owen. Ich stehe doch nicht auf den Ohren. Die Blauröcke wollen die Spur in den Arbuckle Mountains verloren haben. Weißt du überhaupt, wo das ist?“
„Keine Ahnung.“
„Nur ein paar Meilen östlich der Ranch, für die sie geritten sind. Ich denke manchmal, dass das kein Zufall ist.“
„Kann schon sein. Jedenfalls scheinen die zweitausendfünfhundert Bucks der Armee keine weitere Mühe wert zu sein.“
„Wieso auch? Es sind Monate vergangen, und von dem Geld wird nichts mehr zu holen sein. Das kann sich jeder ausrechnen.“
„Wenn sie irgendwo auftauchen, wird man sie hängen.“
„Natürlich. Vielleicht rechnen die Soldaten damit, dass sie eher auftauchen, wenn man sie in Ruhe lässt. Sie fühlen sich dann sicherer.“
Jim geht zu seinem Pferd und steigt in den Sattel. In den Arbuckle Mountains sind sie also verschwunden. Vielleicht wirklich nicht ohne Grund. Vielleicht fühlen sie sich nun in die Enge gedrängt, dass sie um sich beißen. Und vielleicht wollen sie bei McBee damit anfangen. Er reitet aus der Stadt hinaus und ist froh, dass ihn niemand gefragt hat, wie er heißt. Immer wieder in den letzten Wochen musste er erleben, dass Hass gegen ihn aufflammte, obwohl er die Menschen nicht kannte, denen er begegnet war.
Am Abend kann er einen jungen Antilopenbock erlegen. Als er Stücke davon gebraten hat, muss er daran denken, dass es für einen Mann, der das Land kennt, in den warmen Monaten leicht ist, ohne Geld zu leben. Wenn er nur genug Patronen hat, ein wenig Tabak, Schwefelhölzer, oder einen Stein, zum Feuer schlagen.
Vier Tage später wachsen die Felsgiganten vor ihm in die Höhe. Dort also kann er sie finden, wenn er Glück hat. In den letzten Wochen hat er sich immer wieder gefragt, was er eigentlich von ihnen will. Sie zwingen, mit ihm zum nächsten Marshal oder ins nächste Fort zu reiten?
Unsinn, die Armee soll sich selbst kümmern. Er will Clint etwas anderes fragen.
Der dunkle Schlund eines Canyons öffnet sich vor ihm. Der Hufschlag hallt von den steilen, kahlen Felswänden wider, als Jim dem Weg folgend in die Höhe strebt. Entweder wird er sie finden oder sie ihn. Es ist gleichgültig. Aber vielleicht schießen sie auch gleich, wenn sie ihn sehen. Das ist auch gleichgültig. Clint hat dafür gesorgt, dass die Menschen unten im Tal auch ihn gründlich hassen.
Die Sonne steht genau über ihm, als er ein Plateau erreicht. Er hält an, steigt ab und lockert den Sattelgurt. Hier wird er bleiben, bis die Sonne etwas weiter ist, so dass die überhängenden Schluchtwände wieder Schatten bieten. Neben ein paar vertrockneten Scrubbüschen setzt er sich auf den Boden. Zwei Stunden später ist er wieder unterwegs. Er reitet kreuz und quer, bis die Nacht anbricht. Dann schläft er in einer Höhle, und am Morgen ist er wieder unterwegs. Drei Stunden später hält er auf einer kahlen Höhe. Der Morgen ist so klar, dass er die fast zehn Meilen entfernten Gebäude einer kleinen Ranch sehen kann. Er weiß, dass dort unten Sharleen sein muss. Viele Wochen hat er versucht, nicht mehr an sie zu denken. Wer weiß, was inzwischen geschehen ist. Er war ein Narr, denn eigentlich ist er wegen der fünfzig Dollar geritten. Dabei hätte er Sharleen und ihrem Vater sicher mehr genützt, wäre er bei ihnen geblieben. Jim fragt sich, ob es klug wäre, umzukehren. Er kann am Abend dort unten sein.
Da rollt irgendwo hinter ihm ein Stein über den Boden und das scharfe, metallische Geräusch eines zuschnappenden Repetierverschlusses schlägt an seine Ohren.
„Hallo, Jim“, sagt eine raue, stark veränderte Stimme. „Das ist eine herrliche Aussicht, nicht wahr? Ty sagte vor Tagen, dass du wahrscheinlich da unten ein herrliches Leben führen würdest.“ Jim wendet sich langsam um. Sie stehen alle vier vor ihm. Dreckverschmiert, abgerissen, ja beinahe schon zerlumpt. Alles an ihnen ist so heruntergekommen, wie sie es selbst sind; nur ihre Waffen nicht, die sie in den Händen halten und auf ihn richten.
„Und nun bist du hier“, redet Clint weiter. „Haben sie dich auch nicht mehr haben wollen? — Weil du ein Durbin bist nicht wahr?“
Ty lacht leise. Als er sich etwas weiter nach links schiebt, wirken seine Bewegungen katzenhaft.
„Vielleicht hat ihn auch der Marshal geschickt“, murmelt Abe Johnson.
„Ach was. Nicht wahr, Jim, du lässt dich nicht von einem Marshal schicken?“
„Ich komme wegen etwas anderem, Clint. Und ich habe euch zwei Monate und ein paar Tage lang gesucht.“
„Sieh mal an“, meint Clint grinsend. „Dann muss es ja verdammt wichtig sein, was?“
„Sicher, Clint. Kannst du den anderen nicht mal sagen, dass sie es einmal in ihrem Leben fair mit mir machen sollen?“
„Wie meinst du das?“
„Einer nach dem anderen, Clint. Bis jetzt habt ihr es immer alle zusammen gemacht.“
„Die Jungen bluffen doch nur, Jim. Sie wissen genau, dass ich sie töte, wenn sie auf dich schießen. Das heißt, wenn du nicht auf mich schießen willst!“
„Vielleicht habe ich dich deshalb gesucht.“
Clints Gesicht verfinstert sich schlagartig. Mit einer eckigen Bewegung stößt er den Colt in die Halfter.
„Sprich!“, schnaubt er. „Warum hast du nach mir gesucht? - Hat dich doch ein Marshal geschickt?“
„Es geht um die fünfzig Dollar, Clint.“
„Fünfzig Dollar?“
„Die ich damals in Wichita in der Tasche hatte. Ihr habt doch gewusst, dass es Stewarts Geld ist. Und ihr habt doch weiter gewusst, dass Stewart auch nur ein armer Teufel ist!“
„Natürlich haben wir das gewusst. Deshalb habe ich Joe ja auch gesagt, er soll dir das Geld in die Tasche zurückstecken. Hast du es nicht mehr gefunden, als du zu dir gekommen bist?“
„Nein, Clint.“
„Sieh mal an! Wer war denn alles dabei?“
„Das weißt du doch. Der Marshal und Cook.“
„Ja. Aber der Marshal war auch eingeschläfert worden. Dann ist ja Cook ein ganz verschlagener Teufel. Was wir ihm weggenommen hatten, war höchstens zehn Dollar wert gewesen.“
„Den Rest hat er sich vielleicht für die Angst eingesteckt, die er ausstehen musste“, wendet Johnson ein und leckt sich mit der Zunge über die aufgerissenen Lippen.
„Das ist natürlich auch möglich“, bekennt Clint grinsend. „Jim, nimm die Sache nicht so tragisch! Ich mache dir einen anderen Vorschlag: Du bleibst bei uns! Die Leute denken zwar, wir hätten die Bucks der Armee längst ausgegeben. Aber anscheinend fragt sich niemand, wo das geschehen sein könnte. Also, wir haben noch über zweitausend Dollar. Und ich beteilige dich daran. Du wärst derjenige, der in eine Stadt reiten könnte. Dir können sie nichts tun. Wir brauchen Sprengpulver. Findest du nicht auch, dass sich ein Feuerwerk auf McBees Ranch nett ausnehmen würde?“
„Ich würde ihm nicht zu viel erzählen“, mault Johnson. „Er hat immer einen Gerechtigkeitsvogel gehabt, und ich kann mir schlecht vorstellen, dass sich das geändert haben soll.“
Das Grinsen friert in Clints Gesicht ein.
„Stimmt das, Jim?“, fragt er grollend. „Vielleicht, Clint. Ihr habt mir die fünfzig Dollar also bestimmt nicht abgenommen?“
„Nein. Wir können dich natürlich jetzt nicht umkehren lassen. Niemand darf erfahren, dass wir das Geld doch noch haben. Du verstehst?“
„Sicher, Clint. Du willst mich also zwingen, auch ein Bandit zu werden?“
„Sobald wir mit McBee fertig sind, verschwinden wir aus dieser Gegend. Wir wollen nach Norden. Vielleicht bis Montana, Jim! Dort sucht uns kein Mensch. Und dort wird es niemand wagen, uns Banditen zu nennen. Vielleicht fallen uns unterwegs noch ein paar Bucks in die Hände, so dass wir dort oben ganz groß anfangen können. Ich meine, das Rindergeschäft verstehen wir doch alle.“
Jim schüttelt betont langsam den Kopf.
„Da haben wir’s“, schnaubt Abe Johnson. „Der Junge glaubt immer noch, er könnte zu etwas kommen, wenn er korrekt bis zum letzten Kragenknopf ist. Natürlich ist unser Risiko groß, Jim. Aber wo gibt es ein Geschäft ohne Risiko? Nirgends, sage ich dir! Unten im Tal wären wir längst verhungert und von den Wölfen aus dem Schnee gescharrt worden. Leat Merrill wollte klüger als wir sein. Dümmer ist er gewesen!“
„Wieso?“
„Joe war vor drei Wochen in Fort Scott. Er hat ein Alltagsgesicht. Keiner erkannte ihn. Dort hing eine Verlustliste der Armee aus. Und auf der stand Leat, der arme Junge. Wäre er mit uns gegangen, könnte er heute noch leben und ein paar hundert Bucks sein Eigentum nennen.“
„Genug“, meint Clint. „Jim, du kommst mit uns!“
„Ich denke nicht daran, Clint!“
„Es spielt keine Rolle, ob du willst oder nicht. Jedenfalls für mich nicht. Du kommst mit. Ich gehe kein Risiko ein, das sich vermeiden lässt. Und im Übrigen bin ich froh, dass wir uns doch noch getroffen haben. Du weißt ja, dass es keinen Menschen gibt, der mir mehr bedeuten könnte als du. Das war schon so, als du noch ein ganz kleiner Junge gewesen bist, und als ich dein Bruder und deine Mutter gleichzeitig sein musste.“
Jim spürt, dass etwas in seiner Kehle sitzt. Er sieht Abe und Joe aus den Augenwinkeln, die sich ihm nähern, während Ty nun schon hinter ihm ist. Plötzlich wirbelt er herum und schlägt Ty mitten ins Gesicht. Das Halbblut stolpert. Es kann sich nicht halten, tritt über den messerscharfen Grat hinweg und fällt.
Jim ist es, als würde eine kalte Hand nach ihm greifen und das Herz in seiner Brust umdrehen, als er Tys verzerrten Schrei hört und den Körper in der Tiefe hinter dem Grat verschwinden sieht. Er ist nicht fähig, noch eine Bewegung zu machen.
Loses Geröll poltert in die Tiefe. Noch ein letzter, entnervender Schrei, dann ein dumpfer Aufschlag und Alkalistaub, der über den Grat weht und Jim in Nase und Augen brennt.
„Jim“, sagt Clint heiser.
Übelkeit fällt ihn an. Er kann nur noch denken, dass er ausgerechnet den in den Tod gestürzt hat, der ihm vor einer scheinbar endlosen Zeit vor dem weißgesichtigen Stier gerettet hat.
Plötzlich wirbelt er herum. Er hat die Hände zu Fäusten geschlossen und schreit an Clint gewandt: „Warum muss auch immer einer hinter mir stehen? Warum kann ich nicht meinen Weg gehen, wie du immer deinen Weg gegangen bist?“
Clint schüttelt den Kopf.
„Jim, es war Ty“, sagt er, als habe er gar nicht gehört, was sein Bruder sagte. „Es war Ty, hörst du denn nicht!“
Jim lässt die Arme sinken. Seine Fäuste öffnen sich. Er schaut Johnson an und hat für einen Moment den Wunsch, den auch in die Tiefe zu stürzen. Natürlich wird er das mit einem abgezirkelten Schlag schaffen. Und vielleicht vergisst Clint dann, dass sie Brüder sind. Vielleicht ist dann alles endlich zu Ende.
„Wir wollen hier fort“, sagt Clint leise. „Und wir wollen hier nie wieder herkommen. Komm, Jim! Abe, Joe, ich glaube, es war ein Unglück.“
Joe berührt Jim an der Schulter und schiebt ihn vor sich her. Und Jim geht. Er geht wie im Traum und ist nicht fähig, irgendeinen Entschluss zu fassen.
Sie reiten auf einem schmalen Wildwechsel, der sich auf der Höhe einer Geröllhalde dahinzieht. Plötzlich wirft sich Jim Durbin aus dem Sattel. Hart schrammt er auf die Halde, überschlägt sich und rollt in die Tiefe. Gesteinsbrocken poltern vor und hinter ihm. Er wird überrollt und spürt die Schmerzen überall an seinem Körper. Etwas streift seinen Kopf und bringt ihn fast um das Bewusstsein.
Clint stemmt die Hände übereinander auf die blanke Platte des Sattelhorns. Er kann den rollenden Körper seines Bruders im wallenden Alkalistaub kaum noch erkennen. Joe hebt den Colt.
„Nicht!“, sagt Clint. „Nein, Joe, meinen Bruder tötet niemand!“
„Einmal tut er es mit uns!“
„Unsinn, Joe!“ Clint stiert auf die Büsche, die in der Tiefe zu sehen sind. Bis dorthin geht die Staubwolke jetzt schon. Zehn Minuten später ist die Halde wieder klar zu übersehen. Steine sind durch die Büsche geschlagen und haben sie auseinandergerissen. Überall liegen die Gesteinsbrocken verstreut.
„Er muss zwischen den Büschen liegen“, sagt Joe. „Es kann sein, dass er erschlagen wurde. Wollen wir nicht nachsehen? Eine halbe Meile weiter führt ein Weg hinunter.“
Clint schüttelt den Kopf, als könnte er immer noch nicht begreifen, warum sein Bruder Jim das getan hat. Dann wendet er das Gesicht schweigend nach vorn und reitet weiter.
Erst eine halbe Stunde später erreichen sie das untere Ende der Geröllhalde. Clint sieht auf den ersten Blick, dass sein Bruder nicht zwischen den Büschen liegt. Joe springt aus dem Sattel und beugt sich über die Erde.
„Blut“, sagt er.
Clint nickt. Er kann die dünne Spur selbst sehen, die von den Büschen über den Hohlweg führt und in dem schmalen Creek verschwindet, der sich rechts an der Felswand entlang windet.
Als Joe am Wasser steht, meint er: „Schwer kann er nicht verletzt sein, Clint. Und er wusste, dass wir ihm folgen würden. Da wir von oben gekommen sind, kann er im Wasser nur nach unten gegangen sein.“
Clint schnalzt mit der Zunge. Sein Pferd setzt sich wieder in Bewegung. Plötzlich hält er es mit einem Ruck wieder an. An der Biegung des Hohlweges ist ein Reiter in einer blauen Uniform aufgetaucht. Clint Durbin ist nur einen Moment verblüfft, dann reißt er den Colt aus der Halfter und schießt. Die Kugel schrammt gegen die Felswand und steigt quarrend zum Himmel. Der uniformierte Reiter verschwindet. Eine Kommandostimme erschallt.
„Zurück!“, bellt Clint und wirft sein Pferd auf der Hinterhand herum.
Indessen sitzt auch Joe wieder im Sattel, wendet sein Pferd und prescht hinter Abe her, der schon die Flucht ergriffen hat. Clint folgt als Letzter. Eine Kugel brüllt ihm nach, jault über ihn hinweg und verliert sich singend im Hohlweg. Hinter ihnen erfüllt das vielfache Echo eines Trompetenstoßes den Hohlweg. Dann erdröhnt der Boden unter eisenbeschlagenen Hufen. Sie donnern den Hohlweg hinauf, bis sie die Höhe gewonnen haben, hinter der sich der Schluchtweg wieder neigt. Clint springt aus dem Sattel.
„Halt!“, schreit er.
Die beiden anderen parieren ihre Pferde ebenfalls und steigen ab. Sie laufen zu Clint zurück, der sich bereits hinter einen Stein gestemmt hat, ihn aber allein nicht in Bewegung bringen kann.
Mit vereinter Kraft rollen sie den fast runden Stein auf den Weg und stoßen ihn abwärts. Kleine und große Geröllbrocken werden mitgerissen. Donnernd rollt alles in die Tiefe und verschluckt den Hufschlag und das metallische Klirren der Waffen.
„Weiter!“, ruft Clint, als er zu seinem Pferd hetzt und in den Sattel springt.
Sie verschwinden wie ein Spuk in der grauen, endlosen Eintönigkeit der Arbuckle Mountains.