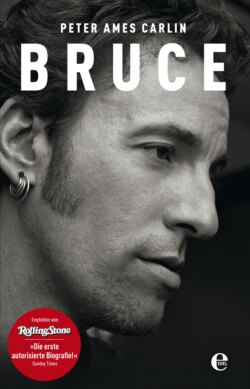Читать книгу Bruce - Peter Ames Carlin - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
DER ORT, DER MIR ALLES BEDEUTETE
ОглавлениеDer Laster kann nicht schnell gewesen sein. Nicht in einer so ver-schlafenen Wohnstraße wie der McLean. Falls er von der Route 79 kam – die in Freehold, New Jersey, auch South Street genannt wird –, wird er sogar besonders langsam gefahren sein, denn kein Siebentonner kann mit unvermindert hohem Tempo durch eine Neunzig-Grad-Kurve fahren. Doch der Truck war immerhin so groß und breit, dass er die gesamte Straße einnahm und die anderen Wagen, Fahrräder und Fußgänger zwang auszuweichen, bis er an ihnen vorbeigetuckert war. Vorausgesetzt, die anderen Verkehrsteilnehmer waren aufmerksam genug und bemerkten ihn.
Ein fünfjähriges Mädchen auf seinem Dreirad hatte andere Dinge im Kopf. Vielleicht folgte es gerade einer Freundin zur Lewis-Oil-Tank-stelle an der nächsten Ecke. Oder es war gerade nur gedankenverloren in ein Spiel vertieft an diesem frühlingshaften Aprilnachmittag im Jahr 1927. Den Laster jedenfalls sah Virginia Springsteen nicht. Und falls sie sein panisches Hupen hörte, als sie auf die Straße fuhr, hatte sie keine Zeit mehr zu reagieren. Der Fahrer trat sofort auf die Bremse, aber es war zu spät. Schon hörte und spürte er einen furchtbaren Schlag. Aufgeschreckt durch die Schreie der Nachbarn kamen die Eltern des Mädchens aus dem Haus gerannt und sahen ihr kleines Töchterchen bewusstlos, aber noch atmend auf der Straße liegen. Sie brachten sie zunächst in die Praxis von Dr. George G. Reynolds und danach in das dreißig Minuten von Freehold entfernte Long Branch Hospital. Dort erlag Virginia Springsteen schließlich ihren schweren Verletzungen.
Die Trauer war unermesslich. Angehörige, Freunde und Nachbarn kamen in das kleine Haus an der Randolph Street, um die Eltern zu trösten. Fred Springsteen, ein siebenundzwanzigjähriger Elektriker, der im Freehold Electrial Shop arbeitete, sprach mit erstickter Stimme, während er seine Hände in den Hosentaschen vergrub. Doch seine achtundzwanzigjährige Frau Alice war völlig aufgelöst und schien unter dem Verlust ihres Kindes zusammenzubrechen. Ungekämmt und mit tränenverquollenen Augen kauerte sie benommen in einer Ecke. Sie war kaum in der Lage, sich um Virginias kleinen Bruder Douglas zu kümmern. Und angesichts seiner eigenen Trauer und der Hilflosigkeit seiner verzweifelten Gattin schaffte es auch der Vater nicht, nach ihm zu sehen. Und so übernahmen es in den ersten Wochen Alices Schwestern Anna und Jane, für den damals zwanzig Monate alten Jungen zu sorgen. Das Leben ging weiter, und ganz allmählich fanden alle wieder in den Alltag zurück. Nur Alice nicht. Der Sommer kam und ging, doch ihre Trauer war so groß und allumfassend wie am ersten Tag.
Die Liebe ihres kleinen Sohnes vermochte sie nicht zu trösten. Kurz vor seinem zweiten Geburtstag im August machte das Kind einen so vernachlässigten und abgemagerten Eindruck, dass nicht mehr von der Hand zu weisen war, dass dringend etwas für ihn getan werden musste. Und so kamen wieder Alices Schwestern, packten Kleider, Spielsachen und sein Bettchen ein und brachten den Jungen zu seiner Tante Jane Cashion, bei deren Familie er bleiben sollte, bis die Eltern wieder in der Lage waren, sich um ihn zu kümmern. Es dauerte schließlich zwei, drei Jahre, bis Alice und Fred wünschten, dass ihr Sohn zu ihnen zurückkam. Aber selbst danach kreisten Alices Gedanken meist um die tote Virginia. Der Anblick ihres Sohnes erinnerte sie jedes Mal daran, wie sehr sie ihr kleines Mädchen vermisste, das sie über alles geliebt und durch Unachtsamkeit verloren hatte.
Auch wenn es ihnen gelang, nach außen hin wie eine ganz normale Familie zu erscheinen, war das Leben im Hause Springsteen doch geprägt von einem gewissen Realitätsverlust, der sich bei allen Familienmitgliedern bemerkbar machte. Fred arbeitete inzwischen nicht mehr im Freehold Electrical Shop, sondern wühlte sich zu Hause durch Berge von Elektronikmüll, die er angehäuft hatte, um mithilfe seiner gesammelten Ersatzteile defekte Radios zu reparieren, die er danach an zugewanderte Landarbeiter verkaufte, die am Stadtrand campierten. Alice, die nie einen Beruf ausgeübt hatte, lebte in ihrer eigenen Welt ohne festen Tagesrhythmus. Wenn ihr morgens nicht danach war aufzustehen, blieb sie einfach im Bett liegen. Und wenn Doug nicht zur Schule gehen wollte, durfte er zu Hause bleiben. Was an häuslichen Arbeiten anstand – Putzen oder Reparaturen –, wurde eher auf die lange Bank geschoben als tatkräftig angegangen. Von den Wänden blätterte allmählich die Farbe und von der Küchendecke bröckelte der Putz. Die einzige Wärmequelle des Hauses war ein Gasherd, weshalb im Winter auch drinnen fast überall sibirische Temperaturen herrschten. Douglas, dem die Veranlagung zur Schwermut seit jeher in den Genen steckte, verstand schon früh die gleichnishafte Bedeutung der sich ablösenden Tapeten und morschen Fensterrahmen mit den gesprungenen Scheiben, und so prägten diese Symptome des fortschreitenden Verfalls von klein auf seine Weltsicht. Andere Menschen sehen das Leben durch eine rosarote Brille oder aus der Sicht eines zupackenden Machers. Doch ganz gleich, wo Doug war und was er tat, er betrachtete das Leben fortan durch eine der gesprungenen Fensterscheiben seines Elternhauses an der 87 Randolph Street.
Doug Springsteen wuchs zu einem schüchternen, aber lebhaften jungen Mann heran. Er besuchte die Freehold High School und liebte es, Baseball zu spielen, besonders mit seinem Cousin und besten Freund Dave »Dim« Cashion, einem hervorragenden Pitcher und First Baseman. Cashion galt damals bereits als einer der besten Spieler, die Freehold je hervorgebracht hatte. Abseits des Spielfeldes verbrachten die beiden ihre Zeit mit Poolbillard in einer zwischen Lebensmittelgeschäften, Friseur- und Zeitschriftenläden gelegenen Spielhalle im Zentrum von Freehold, wo sich die Hauptverkehrsstraßen South und Main Street kreuzten. Cashion war sieben Jahre älter als Doug und konzentrierte sich nach seinem Schulabschluss 1936 voll und ganz auf seine Baseballkarriere. In den folgenden fünf Jahren arbeitete er sich von der Amateurliga über die semiprofessionellen Ligen bis in die Major Leagues hoch. Infolge des Eintritts der USA in den Zweiten Weltkrieg geriet die Sportart jedoch in eine tiefe Krise, weshalb schließlich auch Cashion dem Baseball den Rücken kehrte und zur US Army ging.
Aufgewachsen in der Obhut von Eltern, die davon überzeugt waren, dass Bildung einen nur davon abhalte, sich dem wirklichen Leben zu stellen, beendete Doug 1941 seine Schullaufbahn an der Freehold Regional nach nur einem Jahr, um als Hilfsarbeiter in Freeholds florierender Teppichfabrik von A. & M. Karagheusian anzufangen. Hier blieb er bis Juni 194 3. Danach machte der mittlerweile Achtzehnjährige von seinem Recht Gebrauch, sich freiwillig zur Army zu melden, und kam kurz darauf als Lastwagenfahrer zum Kriegseinsatz nach Europa. Zurück in Freehold ließ er es nach dem Ende des Krieges 1945 ruhig angehen und lebte von den zwanzig Dollar Veteranenrente, die er monatlich von der US-Regierung bekam.
Von Fred und Alice hatte er – wenn auch nur aufgrund deren völligen Mangels an Ehrgeiz und Tatkraft – gelernt, dass es weder auf eine akademische Ausbildung noch auf anderweitige berufliche Ambitionen ankam, ganz zu schweigen von Büchern, Kultur oder allen anderen Interessen, deren praktischer Wert nicht unmittelbar ersichtlich war. Wenn Doug also bei ihnen wohnen bleiben und sich irgendwie durchs Leben mogeln wollte, so hatten sie nichts dagegen einzuwenden.
Doug zeigte wenig Interesse an den typischen Vergnügungen eines jungen Erwachsenen, bis ihn seine Cousine Ann Cashion (Dims jüngere Schwester) eines Tages fragte, ob er Lust habe auszugehen. Sie habe eine Freundin namens Adele Zerilli, die er vielleicht gerne kennenlernen würde. Was er von einem Abend zu viert hielte? Doug zuckte mit den Schultern und sagte, er sei dabei. Wenige Tage später saß man zu viert in einer Bar und unterhielt sich, wobei Doug der bezaubernden, offenherzigen Dunkelhaarigen, die ihm gegenübersaß, immer wieder heimliche Blicke zuwarf. »Danach wurde ich ihn nicht mehr los«, sagt Adele heute. »Und dann kam er und sagte, er wolle mich heiraten. Ich antwortete: ›Du hast keinen Job!‹ Und er sagte: ›Wenn du mich heiratest, suche ich mir einen.‹« Sie schüttelt den Kopf und lacht. »Mein Gott. Worauf ich mich da nur eingelassen habe.«
Douglas und Adele Springsteen heirateten am 22. Februar 1947. Sie mieteten eine kleine Wohnung nahe der Innenstadt von Freehold und profitierten wie viele Amerikaner vom Nachkriegsboom. Doug hielt Wort, er ging auf Jobsuche und fand eine Stelle in den Ford-Werken im nahe gelegenen Edison. Adele arbeitete bereits seit einiger Zeit ganztägig als Sekretärin im Büro eines auf Immobilienrecht spezialisierten Anwalts. Anfang 1949 wurde Adele schwanger, und am 23. September schenkte sie um 22:50 Uhr im Long Branch Hospital (das heute Monmouth Medical Center heißt) einem Jungen das Leben, der seine ersten Atemzüge genau dort tat, wo die Schwester seines Vaters zweiundzwanzig Jahre zuvor ihre letzten getan hatte. Das knapp dreitausend Gramm schwere Kerlchen mit den braunen Haaren und den braunen Augen war kerngesund. Seine Eltern gaben ihm den Namen Bruce Frederick, und obschon sie eine eigene Wohnung im Bezirk Weaverville im Osten von Freehold nahe der Route 33 hatten, gaben sie als Adresse die 87 Randolph Street an, was die Schwester dann auch in die Geburtsurkunde eintrug.
Als Adele und der Junge eine Woche nach der Geburt aus dem Krankenhaus entlassen wurden, fuhr Doug mit den beiden als Erstes zu seinen Eltern und legte den kleinen Bruce seiner Mutter in die Arme. Liebevoll begrüßte sie den ersten Nachwuchs in der Familie seit dem Tod der kleinen Virginia. Fast war es, als erkenne sie in den Augen des Babys dasselbe Strahlen, das ihr einst ihre verstorbene Tochter schenkte. Sie hielt den Jungen fest umschlugen und wollte ihn lange nicht wieder hergeben.
Seine ersten Monate verbrachte Bruce in der kleinen Wohnung seiner Eltern; er war ein ganz normales Baby wie jedes andere auch. Doch durch seine Adern floss das Blut einer ganzen Reihe von Menschen, die seit dem frühen 17 . Jahrhundert Teil der amerikanischen Ge-schichte gewesen waren. Damals hatten Casper Springsteen und seine Frau Geertje ihre holländische Heimat verlassen, um in der Neuen Welt ihr Glück zu suchen. Casper verstarb bereits früh1, doch er hatte einen Sohn, Joosten, der zwar zunächst in Holland blieb, doch 1652 ebenfalls nach Amerika übersiedelte. Joosten Springsteen ist der Stammvater einer inzwischen weitverzweigten Familie. Ein Zweig dieses Clans ließ sich Mitte des 18. Jahrhunderts im Monmouth County, New Jersey, nieder. Nach dem Ausbruch des Unabhängigkeitskriegs 1775 trat John Springsteen der Monmouth-County-Miliz bei und war bis 1779 drei Jahre lang an etlichen Schlachten beteiligt. Der ebenfalls aus Monmouth County stammende Alexander Springsteen diente von 1862 bis zum Ende des Bürgerkriegs 1865 als Grenadier in der zur Nordstaatenarmee zählenden New Jersey Infantry. In Friedenszeiten verdienten sich die Springsteens bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Lebensunterhalt als Landarbeiter, doch wurden sie im Zuge der immer stärker um sich greifenden Industrialisierung zu Fabrikarbeitern.
Alice Springsteen stammte von irischen Einwanderern ab, die 1850 von Kildare in die Vereinigten Staaten übersiedelten. Auch sie ließen sich im Monmouth County nieder und verdingten sich als Landarbeiter, wobei einigen von ihnen ein bescheidener sozialer Aufstieg gelang. 1853 ließ Christopher Garrity, der Stammvater der Familie, seine Frau und seine Kinder in die USA nachkommen. Kurz darauf bandelte seine Tochter Ann mit einem Nachbarn an, einem Arbeiter namens John Fitzgibbon, den sie 1856 heiratete. Zwei Jahre später hatte dieser genügend Geld zusammengespart, um sich an der im Süden von Freehold gelegenen Mulberry Street (die in den 1870er-Jahren in Randolph Street umbenannt wurde), wo damals gerade ein neues Arbeiterviertel entstand, für 127,50 Dollar das Haus mit der Nummer 87 leisten zu können. Ann Garrity pflanzte auf dem Grundstück eine junge Buche, die sie aus Kildare mitgebracht hatte. Der Baum gedieh ebenso prächtig wie Anns und Johns Familie. Bereits in den Jahren vor dem Bürgerkrieg war ihre Ehe mit zwei Kindern gesegnet. John zog in den Krieg und zeichnete sich auf den Schlachtfeldern von Fredericksburg und Charlottesville in Virginia aus. Mit Tapferkeitsmedaillen hochdekoriert kehrte er zu seiner Frau zurück, die ihm bis zu seinem Tod im Jahr 1872 sieben weitere Kinder schenkte. Auch aus Anns zweiter Ehe mit einem Schuhmacher namens Patrick Farrell gingen zwei Kinder – Zwillinge – hervor, darunter ein Mädchen namens Jennie, deren Tochter Alice später einen jungen Elektriker namens Fred Springsteen heiratete.
Wären doch nur alle Mitglieder dieser Familie so stark und standhaft gewesen wie Ann Garritys Buche. Doch sowohl in Freds als auch in Alices Familie gab es die ein oder andere gebrochene Seele. Trinker und Taugenichtse, Verrückte und Besessene. Diese Verwandten lebten hinter verschlossenen Türen und wurden totgeschwiegen. Sie waren das Gift im Blut der Familie, und Doug fühlte, dass auch er etwas davon abbekommen hatte. Das mag ein Grund dafür gewesen sein, dass er sich so sehr in Adele Zerilli verliebte, die ihn mit ihrer zupackenden, beharrlichen Art für den Rest seines Lebens schützen und stützen sollte.
Als jüngste der drei Töchter von Anthony und Adelina Zerilli, die als italienische Einwanderer zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Teenageralter nach Amerika gekommen waren, verbrachte Adele ihre Kindheit in der Gegend um Bay Ridge an der Südspitze von Brooklyn. Dass sich die Familie in dieser recht wohlhabenden Gegend niederlassen konnte, verdankte sie Anthony. Nachdem er binnen sagenhaft kurzer Zeit Englisch gelernt hatte, erhielt er fast ebenso schnell die amerikanische Staatsangehörigkeit und schloss sein Jurastudium ab. Er sicherte sich einen Posten in der Kanzlei seines Onkels, die sich auf Eigentums- und Vermögensrecht spezialisiert hatte. In den 1920er-Jahren ließ sich der Erfolg der Kanzlei auch an Anthonys Erscheinungsbild und seinem Auftreten ablesen. Der stets modisch-elegant gekleidete Anwalt war zwar von kleinem Wuchs, hatte allerdings ein breites Kreuz und eine durchdringende Stimme. Er fegte oft wie ein Orkan durch die Straßen und ließ jeden Anwesenden aufmerken, wenn er einen Raum betrat. Adelina hingegen führte das Leben einer etwas hinterwäldlerischen italienischen Matrone, die sich in Landestracht gekleidet mit Erinnerungsstücken an die Heimat umgab und sich weigerte, mehr als eine Handvoll englischer Worte in den Mund zu nehmen, selbst dann, als ihre Töchter zu modernen amerikanischen Mädchen heranwuchsen.
Als 1929 die Weltwirtschaftskrise ausbrach, wünschte sich auch Anthony, er könne die Zeit zurückdrehen. Er war gezwungen, mit seiner Familie in eine günstige Mietwohnung umzuziehen, und um die ihm noch verbliebenen Mandanten bei der Stange zu halten, lieh er einigen von ihnen Geld. Er verlieh mehr und immer mehr, und schließlich hatte er zu viel verliehen. Zur gleichen Zeit leistete er sich noch andere Schwächen, darunter auch eine Affäre mit einer Sekretärin, die schließlich sogar sein Herz eroberte. Zuerst ging Anthonys Ehe in die Brüche, dann standen die Bundesbeamten vor seiner Tür. »Ich glaube, ›Unterschlagung‹ ist die zutreffende Bezeichnung für das, worum es ging«, sagt Adele.
Die nächste zutreffende Bezeichnung in diesem Fall lautete »Verurteilung«. Bevor Anthony ins Gefängnis ging, erwarb er noch ein einfaches Häuschen am Rande von Freehold, das er renovieren ließ, um seiner Familie ein angenehmes, wenngleich bescheidenes Leben zu ermöglichen, während er seine Strafe verbüßte. Der sehr konservativen Katholikin Adelina hatten ihre zerrüttete Ehe und der rasante finanzielle Absturz der Familie allerdings so sehr zugesetzt, dass sie den Haushalt ihren Töchtern überließ, während sie selbst zu Verwandten zog. Nun war es an Dora, der Ältesten, sich um die jüngeren Schwestern zu kümmern. Den Highschoolabschluss frisch in der Tasche nahm sie eine Stelle als Serviererin an und hielt ihre Geschwister an der kurzen Leine. Einmal pro Woche kam eine Tante vorbei, um nach dem Rechten zu sehen, die Einkaufstaschen voller Spaghetti und Thunfischkonserven. Zudem konnten sich die Mädchen auf die Hilfe eines Mannes verlassen, den ihnen ihr Vater als George Washington vorgestellt hatte. Anthony hatte den afroamerikanischen Tagelöhner angestellt, um ihnen als Chauffeur und Hausmeister zur Seite zu stehen. Der etwa dreißigjährige Mann, der regelmäßig vorbeikam, um zu schauen, ob alles in Ordnung war, hieß natürlich nicht wirklich George Washington (diesen Namen hatte Anthony ihm gegeben). »Alles, was wir über ihn wussten, war, dass er tanzen konnte«, sagt Adele. Der mittleren Schwester Eda zufolge erreichte die Stimmung im Haus allabendlich ihren Höhepunkt, wenn um neunzehn Uhr die Radiosendung Your Hit Parade anlief. Dann drehten die Mädchen den Lautstärkeregler voll auf, rollten den Wohnzimmerteppich zusammen und legten los. »So haben wir tanzen gelernt«, erzählt sie. »Ich weiß, das klingt verrückt, aber so war es.« Adeles Sohn lacht laut auf, als er sich diese Szene in Gedanken ausmalt. »Sie gingen auf diese Tanzveranstaltungen, wo auch die Soldaten hinkamen, die Heimaturlaub hatten, und sie tanzten, tanzten, tanzten«, sagt Bruce. »Für sie lief alles prima.«
Dora und Eda hielten nach der Trennung ihrer Eltern demonstrativ zu ihrer Mutter, während Adele sich unparteiisch gab. Sie war ihrem Vater aber immerhin noch so sehr zugetan, dass sie seiner Bitte nachkam, zusammen mit seiner neuen Lebensgefährtin, seiner ehemaligen Sekretärin, die achtzig Meilen weite Fahrt nach Ossining, New York, auf sich zu nehmen, um ihn in dem berühmt-berüchtigten Staatsgefängnis Sing Sing zu besuchen. Als Dora Wind davon bekam, schaltete sie das Bezirksgericht von Monmouth ein, um diesen Besuchen einen Riegel vorzuschieben. Trotzdem gelang es Anthony, seine Jüngste zu einem weiteren Besuch mit seiner Geliebten zu überreden. Da erwirkte Dora eine entsprechende gerichtliche Verfügung, die ihr das bei Androhung von Strafe untersagte. »Das war idiotisch, ich war damals ja noch ein Kind!«, sagt Adele. Das muss sie doch sicher sehr gekränkt haben. »Nein. Ich konnte nur einfach nicht mehr hinfahren, das war’s«, sagt Adele. Ihre Tochter Ginny widerspricht ihr: »Doch, sie hat das nie verwunden«, erklärt sie. Und Adele gibt zu: »Das Schreiben vom Gericht habe ich bis heute aufbewahrt.«
Sie tanzten trotzdem weiter. Und auch als die Zerilli-Schwestern erwachsen wurden, arbeiten gingen und heirateten, schwere Stunden und sogar Tragödien durchstehen mussten, munterte die Musik sie immer wieder auf, brachte sie wieder auf die Beine und riss sie mit. »Das ist bis heute so geblieben«, sagt Bruce. »Schau dir nur diese drei Mädels an. Tanzen war stets ein wichtiger Teil ihres Lebens. Und das ist es noch immer.«
Fünf Monate nach Bruce’ Geburt wurde Adele erneut schwanger. Und als Anfang 1951 das zweite Kind geboren wurde – ein Mädchen, das sie zu Ehren von Dougs verstorbener Schwester Virginia nannten –, mussten Doug und Adele bald einsehen, dass ihre bescheidene Wohnung für die größer werdende Familie zu klein wurde. Da sie sich keine größere leisten konnten, blieb ihnen keine andere Wahl, als in die Randolph Street zu ziehen und sich dort zwischen Bauteilen zerlegter alter Radios, die Fred in der Küche lagerte, und klapprigen Möbeln einzurichten. Alice war überglücklich, den kleinen Bruce bei sich im Haus zu haben. Seine Schwester hingegen nahm sie kaum wahr. »Es war alles andere als einfach für sie, aber was wusste ich schon? Ich war noch so jung«, sagt Adele. »Ich dachte, sie Virginia zu nennen, ist das Beste, was ich tun kann, aber das war es nicht.« Ganz abgesehen davon hatten Alice und Fred ihr Lieblingsenkelchen ohnehin längst gefunden. »Bruce ging ihnen über alles, ihm sahen sie wirklich alles nach.«
Von dem Tag an, als die Familie bei ihnen einzog, umhegte und pflegte Alice den Jungen. Sie wusch und bügelte seine Wäsche und legte ihm jeden Morgen die Sachen, die er anziehen sollte, auf sein frisch gemachtes Bettchen. Tagsüber, wenn Adele und Doug nicht da waren, fütterten Alice und Fred den Kleinen und hielten ihn unentwegt bei Laune; sie waren stets in seiner Nähe. Ginny hingegen durfte sich glücklich schätzen, wenn ihr mehr Beachtung geschenkt wurde als nur ein kurzer prüfender Blick. Frustriert vom offenkundigen Desinteresse ihrer Großeltern suchte sich die Zweijährige bald andere Personen, bei denen sie den Tag verbrachte. Adele: »Sie wollte partout nicht bei ihnen bleiben, also tat sie es nicht.«
»Ich war gefangen in der Rolle, die sie mir zugedacht hatten, nämlich ihr verstorbenes Kind zu ersetzen«, sagt Bruce. »Daraus entwickelte sich eine ziemlich komplizierte Art der Zuneigung, die ich nicht völlig erwidern konnte. Die Bedeutung, die wir [Ginny und Bruce] für sie hatten, war eine ungeheure Bürde. Und das wurde schließlich für alle zu einem Problem.« Wegen der ungeteilten Aufmerksamkeit, die sie ihm schenkten, sah Bruce bald in seinen Großeltern – und nicht in seinen Eltern – seine wichtigsten Bezugspersonen. »Das war emotionaler Inzest, und die Rolle der Eltern wurde infrage gestellt. Für ein kleines Kind war das sehr verwirrend, ich verlor die Orientierung. Man buhlte von zwei Seiten um mich. Und dann waren wir an einem Punkt angekommen, an dem es kein Zurück mehr gab.«
In seiner Erinnerung ist das Haus seiner Großeltern für Bruce ein seltsamer, karger Ort, dessen rissige Wände anschaulich von der von Verlust, Erinnerungen und Reue beherrschten Atmosphäre zeugten. »Ihre tote Tochter war allgegenwärtig«, sagt er. »An jeder Wand hing ihr Bild, sie stand überall und immer im Mittelpunkt.« Jede Woche nahmen Fred und Alice die ganze Familie mit zum St.-Rose-of-Lima-Friedhof, wo jeder den Grabstein berühren und Unkraut zupfen musste. »Dieser Friedhof war so etwas wie unser Spielplatz«, sagt Ginny. »Wir waren ja dauernd dort.« Auch durch die vielen in der Nachbarschaft lebenden alten Verwandten war der Tod damals allgegenwärtig. »Wir waren bei vielen Totenwachen dabei«, erzählt Bruce, »und man war quasi daran gewöhnt, Tote zu sehen.«
Der Tod war das eine. Das andere war, dass Alice, in deren europäisch geprägtem Katholizismus Aberglaube und lustvoll ausgemalte Schrecken keine unbedeutende Rolle spielten, große Angst vor der drohenden ewigen Verdammnis hatte. Für Oma Alice zeugten jeder Blitz und jeder Donnerschlag von der Gegenwart des Teufels, sodass sie ein Gewitter stets in helle Panik versetzte. In Windeseile schnappte sie sich die Kinder und rannte zum Haus ihrer Schwester Jane, wo eine ganze Batterie mit Flaschen voller Weihwasser bereitstand, um ihre Familie vor Gefahren wie diesen zu schützen. »Die Leute kauerten ganz eng beieinander«, erinnert sich Bruce. »Sie waren geradezu hysterisch.«
Seit Freds linker Arm nach einem schweren Schlaganfall Ende der 50er-Jahre gelähmt war, nahm er Bruce mit, wenn er die Mülltonnen der Nachbarn nach alten Radios und anderen Elektroteilen durchsuchte. Die Zeit, die sie zusammen verbrachten, vertiefte die Beziehung zwischen Großvater und Enkel noch. Der ungewöhnliche Lebensrhythmus im Hause seiner Großeltern wurde immer mehr zu seinem eigenen. Denn während Adeles Tagesablauf durch ihre Stelle als Sekretärin geregelt war, spielte für den Rest der Familie – inklusive Doug, der inzwischen häufig die Arbeitsplätze wechselte und oft auch länger keinen Job hatte – Zeit keine Rolle. »Es gab keine Regeln«, so Bruce. »Um ehrlich zu sein: Ich kenne kein Kind, das so lebt, wie ich damals lebte.« Mit vier Jahren blieb er bis spät in die Nacht wach. Er stand auf, tapste ins Wohnzimmer, blätterte in seinen Bilderbüchern, hantierte mit seinen Spielsachen und sah fern. »Um halb vier in der Früh, während das ganze Haus schlief, saß ich dort rum und sah The Star-Spangled Banner, bis das Testbild kam. Und damals war ich noch nicht einmal im Schulkindalter.« Jahre später, nachdem er von der Schule abgegangen war und das für einen Musiker unvermeidliche Nachtleben führte, hatte er eine Erleuchtung: »Ich lebte plötzlich wieder so wie als Fünfjähriger. Es war wie: ›Hey, dieser ganze Schulkram war ein einziger Fehler!‹ Es war eine Rückkehr zu meinem Leben als Kleinkind. Das war zwar völlig unnormal gewesen, aber so war es nun mal.«
Adele las ihrem Sohn jeden Abend aus einem Bilderbuch mit dem Titel Brave Cowboy Bill vor. Bruce war derart fixiert auf dieses von Kathryn und Byron Jackson geschriebene und von Richard Scarry illustrierte Kinderbuch aus dem Jahr 1950, dass Adele es noch an ihrem achtzigsten Geburtstag 2005 auswendig kannte. Die Hauptfigur, Bill, der ein bisschen wie ein Sechsjähriger aussieht, reitet durch den Wilden Westen, stellt Viehdiebe, schießt Rehe und Hirsche zum Abendbrot, freundet sich mit Indianern an – wenn auch mit vorgehaltener Waffe (»Wir werden Freunde sein, erklärte er ihnen mit fester Stimme …«) –, erlegt einen Bären, geht als Sieger aus einem Rodeo hervor und bleibt die ganze Nacht wach, um am Lagerfeuer Lieder zu singen, bevor er nach Hause geht und vom Wilden Westen träumt, wo sich »niemals jemand auflehnte gegen den mutigen Cowboy Bill«. All das verschafft uns einen interessanten Einblick in die Fantasiewelt eines Jungen, der in derart unkonventionellen Verhältnissen aufwuchs. 2
Als Bruce alt genug war, um allein auf die Straße zu gehen und mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft zu spielen, verstörte ihn, was er bei seinen Besuchen bei den Familien seiner Spielkameraden mitbekam. Plötzlich sah er, dass die Zimmer seiner Freunde frisch gestrichen waren, dass deren Fensterrahmen nicht klapperten und der Putz nicht von der Küchendecke herunterzufallen drohte. Die Erwachsenen machten einen soliden, zuverlässigen Eindruck. Sie schienen sichere Arbeitsplätze zu haben, ein regelmäßiges Einkommen und zeigten keinerlei Anzeichen von Gemütskrankheiten. »Ich liebte meine Großeltern ungemein, aber sie waren absolute Außenseiter«, sagt er. »Da kam so etwas wie Schuld und Scham in mir auf, aber ich fühlte mich auch deshalb schlecht, weil ich mich für sie schämte.«
Im Herbst 1956 war Bruce alt genug, um eingeschult zu werden. Adele meldete ihn an der katholischen St.-Rose-of-Lima-Schule an. Falls Doug eine Meinung dazu hatte, behielt er sie für sich. Fred und vor allem Alice waren hingegen der Ansicht, dass Bruce nicht zur Schule gehen müsse, wenn er nicht wolle. Fred war nicht lange zur Schule gegangen, und Doug auch nicht. Warum viel Aufhebens um eine Ausbildung machen, die Bruce gar nicht brauchte? Adele, deren Vater darauf bestanden hatte, dass seine Töchter auf jeden Fall einen High-schoolabschluss machten, wollte davon nichts wissen. »Natürlich musste er zur Schule gehen«, sagt sie. »Aber sie [Fred und Alice] wollten es verhindern.« Da sie sich, was den Einfluss auf ihren Sohn anbelangte, ohnehin schon an den Rand gedrängt fühlte und es mehr als satt hatte, in einem derart chaotischen Haushalt auf verlorenem Posten die pflichtbewusste Ehefrau zu spielen, nahm Adele das Heft in die Hand und sorgte für klare Verhältnisse. »Ich sagte meinem Mann: ›Wir müssen hier raus!‹« Falls Doug sich auf eine Diskussion darüber eingelassen haben sollte, muss er sich am Ende wohl geschlagen gegeben haben. Denn als sie erfuhren, dass Verwandte aus einer Maisonettewohnung an der nur dreieinhalb Blocks von Freds und Alices Haus entfernt liegenden 39 ½ Institute Street auszogen, mieten sie sich sofort dort ein.
Heute weiß Bruce, dass das für seine Mutter die einzige Möglichkeit war, mit ihrer Familie in einigermaßen normalen Verhältnissen zu leben. Es dauerte allerdings eine ganze Weile, bis er das verstehen konnte. Für ihn als Sechsjährigen sei die plötzliche Veränderung verheerend gewesen, sagt er. »Es war grausam, weil damals meine Großeltern de facto zu meinen Eltern geworden waren. Man riss mich im Grunde genommen aus meinem Elternhaus heraus.« Immerhin sah Bruce seine Großeltern weiterhin regelmäßig, da sie nach der Schule auf ihn aufpassten.
Die neue Wohnung, die sich über zwei Etagen erstreckte, war deutlich komfortabler als das Haus der Großeltern. »Wir hatten sogar eine Heizung«, sagt Bruce, der sich das größere der beiden Zimmer mit seiner Schwester Ginny teilte. Es gab jedoch keinen Warmwasserboiler, weshalb Spülen und vor allem Baden relativ umständlich waren. Letzteres, so Bruce, fiel häufig aus.
Es lag wohl nicht zuletzt an den gravierenden Veränderungen der häuslichen und familiären Situation, dass Bruce zur Zeit seiner Einschulung ein sehr empfindliches und trotziges Kind war. Die strengen Regeln an der Nonnenschule und die Anforderungen, die dort an ihn gestellt wurden, wirkten zunächst verwirrend auf ihn, später frustrierten sie ihn. »Wenn du in einer Familie aufwächst, in der niemand arbeiten geht und auch niemand von der Arbeit heimkommt, spielt Zeit für dich keine Rolle«, sagt Bruce. »Wenn dann jemand kommt, etwas von dir verlangt und sagt, du hast zwanzig Minuten Zeit dafür, macht dich das richtig wütend, weil du gar nicht genau weißt, was zwanzig Minuten überhaupt bedeuten.« Ebenso wenig wusste Bruce, wie er im Unterricht still sitzen, sich auf die Ausführungen der Nonnen konzentrieren oder deren verhärmte Gesichter und zeigestockschwingenden Hände als etwas anderes begreifen sollte als das irdische Abbild eines zürnenden Gottes.
Bruce versuchte so gut es ging, den Anforderungen gerecht zu werden. Jeden Morgen zog er seine Schuluniform an und lief an der Hand seiner Mutter stolz zur Schule. »Immer ging er erhobenen Hauptes hinein, und ich dachte: ›Wunderbar‹«, erzählt Adele. Doch wie kam er wirklich in der Schule klar? Um sich selbst ein Bild davon zu machen, ging Adele während der Mittagspause dorthin und beobachtete ihren Sohn auf dem Schulhof. »Da stand er, ganz allein an den Zaun gelehnt. Er spielte mit niemandem. Es war so traurig.« Für Bruce selbst entwickelte sich damals sein Hang zum Einzelgängertum auf ebenso natürliche Weise wie der Wunsch, ständig im Mittelpunkt zu stehen.
»Es ist ein menschliches Bedürfnis, zu einer Gemeinschaft zu gehören, doch mir ist das nie leichtgefallen«, sagt er. »Ich war ein Eigenbrötler und längst daran gewöhnt, immer allein zu sein.« Ganz gleich wo er gerade war, mit seinen Gedanken war er immer woanders. »Ich hatte eine äußerst lebhafte Fantasie. Meine Aufmerksamkeit galt immer etwas anderem als dem, worum es gerade ging. Ich konzentrierte mich beispielsweise darauf, wie das Licht auf eine Wand fiel oder wie sich die Steine unter meinen Füßen anfühlten.«
Bruce hatte einen kleinen Freundeskreis, der sich überwiegend aus den Jungen zusammensetzte, mit denen er in der Gegend rund um die Randolph Street Ball spielte oder Rennen mit Spielzeugautos veranstaltete. Sein bester Freund aus dieser Gruppe war der etwas jüngere Bobby Duncan, den Bruce in der Vorschule kennengelernt hatte. Für Duncan war er ein ganz normales Kind: Er liebte Baseball, fuhr nachmittags gerne mit dem Fahrrad zum Süßwarengeschäft auf der Main Street und radelte dann mit ihm zurück zum Haus seiner Großeltern, wo sie das Kinderprogramm sahen oder Archie-Comics lasen oder beides. Duncan bemerkte allerdings auch, das sein Freund anders war: »Er war ein Einzelkämpfer. Er scherte sich nicht darum, was die Leute dachten.« Allein dadurch fiel er aus dem Rahmen, sodass die anderen Jungs aus der Nachbarschaft oft nicht wussten, was sie mit ihm anfangen sollten. Das machte sich besonders bemerkbar, als sie alt genug waren, um sich in den üblichen Prügeleien miteinander zu messen. »Ich wuchs in einem Schwarzenviertel auf, aber in der näheren Umgebung gab es etliche Viertel, in denen weiße Familien lebten«, sagt David Blackwell, der damals nur wenige Blocks von Bruce entfernt wohnte. »Wir wurden alle Freunde, weil wir uns alle prügelten. Ich schlug mich mit all meinen Freunden, weißen wie schwarzen. Aber Bruce hatte irgendwas an sich … Ich glaube, Sie werden in Freehold niemanden finden, der versucht hat, sich mit ihm zu prügeln.« Wenn auch nur, wie Davids Bruder Richard sich erinnert, weil der Springsteen-Spross immun zu sein schien gegen die Spötteleien, die diese Prügeleien provozierten. »Man konnte irgendwas Beleidigendes über seine Mutter sagen, und er zuckte nur mit den Schultern, sagte ›Okay!‹ und ging weiter«, berichtet er. »Da konnte man nichts machen, das musste man respektieren. Sollte er sich halt mit seinem eigenen Kram beschäftigen.«
Seine unzugängliche und störrische Art war es wohl auch, die Bruce zu einem gefundenen Fressen für die Nonnen mit ihren mittelalterlich anmutenden Strafen sowie für die Klassenkameraden machte, die sich über Bruce’ unbeholfene Reaktionen amüsierten. Bruce handelte sich reichlich Ärger mit den Lehrerinnen ein, sodass mehr als einer seiner Schultage im Büro des Direktors endete, wo er einige Stunden warten musste, bis Adele ihn abholen kam. Von seinen Eltern zur Rede gestellt, gab er immer wieder dieselbe Erklärung für sein Verhalten. »Er wollte einfach nicht mehr auf diese katholische Schule gehen«, sagt Adele. »Aber ich habe ihn dazu gezwungen, was mir heute unendlich leidtut. Ich hätte wissen müssen, dass das nichts für ihn war.« 3
Douglas Springsteen war in diesen Jahren meist ganz und gar in sich gekehrt. Mit seiner grüblerischen, gar nicht mal unattraktiven Art erinnerte er ein wenig an den Schauspieler John Garfield. In seinem Job war er oft nicht in der Lage, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, und so wechselte er häufig die Arbeitsstelle. Nach dem Ende seiner Beschäftigung bei den Ford-Werken arbeitete er zunächst als Wachmann und dann als Taxifahrer, bevor er ein, zwei Jahre in der nahe gelegenen M & Q-Plastikfabrik Formteile ausstanzte. Anschließend war er ein paar unglückliche Monate lang als Gefängniswärter tätig, bevor er sich gelegentlich als LKW-Fahrer verdingte. Unterbrochen wurden diese Beschäftigungsverhältnisse von oft langen Phasen der Arbeitslosigkeit, in denen Doug seine Tage meist rauchend und Löcher in die Luft starrend allein am Küchentisch verbrachte. Doch von dem, was sich vor seinem Küchenfenster abspielte, bekam er nichts mit.
Richtig wohl fühlte sich Doug nach wie vor bei seinem Cousin und engsten Freund Dim Cashion, der nach seiner Zeit als Profibaseballer inzwischen als Trainer für Little-League-Teams sowie als Spielertrainer für New Jerseys semiprofessionelle Ligen arbeitete. Doch obschon es Dim dank seines Talents und Charismas gelang, Generationen kleiner Jungs aus Freehold für Baseball zu begeistern, konnte auch er sich dem Sog der manisch-depressiven Erkrankung, die in ihm schlummerte, nicht entziehen. Das ewige Auf und Ab zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt konnte zu unkontrollierbaren Anfällen führen. »Küchenschränke krachten von den Wänden, Telefone wurden aus der Wand gerissen, und am Ende stand die Polizei vor der Tür«, erzählt Dims jüngster Bruder Glenn Cashion. Und auch wenn das Verhältnis zwischen Doug und Dim nicht immer spannungsfrei war und sie sich oft monatelang nicht sahen (obwohl sie nur wenige Blocks voneinander entfernt lebten), verbrachten die beiden Cousins viel Zeit in den alten Billardhallen und tranken das ein oder andere Bier zusammen. Ihre gemeinsam verbrachten Jahre und ihr genetischer Code verband sie auf ewig miteinander.
Fest entschlossen, mehr Kontakt zu anderen Kindern zu schließen – und vielleicht auch die Beziehung zu seinem Vater zu vertiefen –, trat Bruce seinem Lieblingsbaseballverein in Freeholds Little League, den Indians, bei, und spielte dort als Right Fielder. Bruce hatte allerdings mehr Ehrgeiz als Talent. Jimmy Leon (heute Mavroleon), der viele Jahre lang mit Bruce in einem Team spielte, erinnert sich noch an einen Sommertag, an dem ein hoher Ball quer über den blauen Himmel direkt auf den ausgestreckten Fangarm seines Mannschaftskameraden zuflog. Ein sicherer Punkt für sie. »Aber dann traf der Ball nur seinen Kopf. Ungefähr so lief das mit ihm.« Ganz gleich wie geringfügig sein Beitrag auch sein mochte, Bruce war stolz drauf, im Team der Indians zu sein, als die Mannschaft in der regulären Saison 1961 ungeschlagen blieb. Getrübt wurde dieser Erfolg lediglich dadurch, dass sie am Ende nicht den Meistertitel holten, weil sie in den letzten zwei Spielen der Finalrunde knapp gegen die Cardinals verloren, die vom Freeholder Friseur Barney DiBenedetto trainiert wurden. 4
Doch ganz gleich wie beglückend diese Kindheitserlebnisse waren, in Bezug auf seinen psychisch kranken Vater blieb Bruce nichts anderes übrig, als sich trotz aller Enttäuschungen immer wieder um ein vernünftiges Verhältnis zu ihm zu bemühen. »Man kam nicht an ihn ran, zeitweise konnte man einfach überhaupt nicht zu ihm durchdringen«, erinnert sich Bruce an die vielen Versuche, mit seinem Vater zu reden. »Vierzig Sekunden lang hatte man ihn. Und weißt du, was passiert, wenn dann gar nichts mehr passiert? Genau das passierte.« Nach dem Essen, wenn der Abwasch erledigt war, wurde die Küche wieder Dougs einsames Reich. Ohne Licht anzumachen, nur mit einer Dose Bier, einer Packung Zigaretten, einem Feuerzeug und einem Aschenbecher auf dem Tisch verbrachte Doug seine Stunden allein in der Dunkelheit.
Im Februar 1962 brachte Adele ihr drittes Kind zur Welt, ein Mädchen, das sie Pamela nannten. Der Familienzuwachs machte einen erneuten Umzug in ein größeres Zweifamilienhaus an der 68 South Street erforderlich. Das weiße Haus, das über eine Heizung und fließend warmes Wasser verfügte, stand direkt neben einer Tankstelle. Die Anwesenheit des Babys vertrieb den düsteren Fatalismus, der das Familienleben in der Regel beschwerte. Die Last, die die Vergangenheit und die Erwartungen der anderen ihnen aufbürdeten, schien plötzlich abgefallen. Der dreizehnjährige Bruce war ganz vernarrt in das Baby, sodass er sich wesentlich mehr darum kümmerte als Ginny, die eigentlich die Aufgabe hatte, die kleine Schwester zu wickeln, zu füttern und zu hüten. Ganz gleich, womit er gerade beschäftigt war, er rannte sofort zu ihr, wenn er die kleine Pamela schreien hörte. »Ich habe mich richtig um sie gekümmert«, sagt Bruce, »mit allem drum und dran, Windeln wechseln und so weiter. Wir standen uns sehr nahe, als sie noch ganz klein war.«
Eines Tages, noch im selben Jahr, kamen Fred und Alice vorbei, um die Familie zu besuchen. Während sie darauf warteten, dass Doug von der Spätschicht in der Plastikfabrik nach Hause kam, meinte Fred plötzlich, das Wetter mache ihm zu schaffen, und ging nach oben, um sich kurz hinzulegen. Als Adele etwa eine Stunde später nach ihm sah, war er ganz kalt und regte sich nicht mehr – offenbar war er schon einige Zeit tot. Adele lief sofort in die Küche und überbrachte Alice die schreckliche Nachricht. Die alte Frau nickte nur. Einig darin, nichts zu unternehmen, bevor Doug da war, blieben die beiden sitzen, bis die Tür aufging. Doug reagierte ähnlich emotionslos wie seine Mutter. Er hielt einen Augenblick inne, sagte »Oh, okay«, suchte in seinen Taschen ein paar Münzen und ging zu einer Telefonzelle, um einen Bestatter zu bestellen und einige Verwandte zu benachrichtigen. Als Bruce von der Schule nach Hause kam und erfuhr, dass sein Großvater gestorben war, war er völlig aufgelöst. »Für mich brach eine Welt zusammen«, sagt er. »Trotzdem haben wir nicht über den Tod meines Großvaters gesprochen. Er war Anfang/Mitte sechzig, als er starb. Ich hatte ihm so nahe gestanden, aber als Kind weiß man ja nicht, wie man reagieren soll. Ich erinnere mich an die Beerdigung, die Totenwache und all das. Aber es war nicht so wie heute. Alle waren noch … so anders.«
Da das Haus an der Randolph Street eigentlich abbruchreif war, zog Alice zu Doug und seiner Familie. Die meiste Zeit über kümmerte sie sich um Pam und nutzte die Gelegenheit, ihrem vierzehnjährigen Enkel wieder einmal ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Wie früher legte sie ihm jeden Morgen seine Sachen aufs Bett, kochte sein Lieblingsessen und begeisterte sich für alles, was er tat und sagte. Dieses Mal spielte Adele das Spielchen mit. Sie überließ Bruce das beste Zimmer im Haus, das einen direkten Zugang zum Wintergarten hatte. Als er herausfand, dass dort genug Platz für einen Billardtisch war, sparten sich Adele und Doug das Geld dafür vom Mund ab und nahmen einen weiten Weg durch einen dichten Schneesturm auf sich, damit das teure Spielzeug rechtzeitig zu Weihnachten im Haus war.
Alice hatte wochen-, wenn nicht gar monatelang für sich behalten, dass es ihr nicht gut ging. Aber warum hätte sie auch jemanden damit behelligen sollen? Sie hatte ohnehin kein Geld für Arztbesuche. Als Adele sie endlich ins Krankenhaus brachte, diagnostizierten die Ärzte Krebs und behielten sie für drei Monate da. Die alte Frau ließ etliche Behandlungen über sich ergehen, von denen einige höchstwahrscheinlich experimenteller Natur waren. »Ich vermute, dass sie für die bloß ein Versuchskaninchen war, da sie weder Geld noch eine Versicherung hatte«, sagt Adele.
Alice kam wieder nach Hause, doch es dauerte sehr lange, bis sie langsam wieder zu Kräften kam. Sie war schon fast wieder ganz die Alte, als die damals dreijährige Pam eines Nachts aufwachte und ihre Mutter fragte, ob sie sich zur Oma ins Bett legen dürfe. Adele wunderte sich zwar angesichts dieser Bitte – Pam hatte so etwas bislang noch nie getan –, doch sie nickte nur und blickte ihrer Tochter hinterher, als sie den Flur entlangtapste und durch die Tür in das gegenüberliegende Schlafzimmer schlüpfte. »Ich erinnere mich noch, wie ich in Omas Zimmer ging und sie ein wenig zur Seite rückte und die Bettdecke anhob, um mich hineinzulassen«, sagt Pam.
Das kleine Mädchen kuschelte sich bei der alten Frau an, ganz so, wie es ihre kleine Virginia so viele Jahre zuvor getan haben mochte, und so schliefen die beiden ein. Was immer Alice gedacht oder geträumt haben mag, als sie wieder eingeschlafen war – wir werden es nie erfahren. »Als ich am nächsten Morgen aufwachte, rüttelte ich sie hin und her, um sie zu wecken, doch sie bewegte sich nicht«, erzählt Pam. Bruce, der bereits auf dem Weg zur Schule war, hatte nichts mitbekommen: »Ich bin mir sicher, dass ich durch den Raum ging, als sie dalagen – mein Zimmer war keine fünf Meter von ihrem entfernt. Ihr Tod veränderte mein ganzes Leben, meine Welt stürzte ein. Ich kann mich nicht erinnern, dass viel Aufhebens um den Tod meines Großvaters gemacht worden wäre, aber als meine Großmutter starb, war das anders. Mein Vater war vor Verzweiflung völlig außer sich.«
Das Haus an der Randolph Street hatte, nachdem Alice 1962 ausgezogen war, für ein paar Monate leer gestanden. Dann kamen die Bulldozer, um es abzureißen. Eine große Staubwolke stieg auf, als die verwitterten Wände in sich zusammenfielen, übrig blieb lediglich ein großer Schutthaufen, der mit einem LKW abtransportiert wurde. Das geräumte Grundstück wurde planiert, asphaltiert und zu einem Parkplatz der St. Rose Church umfunktioniert. Bruce weigerte sich lange, einen Blick darauf zu werfen. »Noch Jahre nach dem Abriss konnte ich nicht dorthin gehen«, sagt er. »Ich brachte es einfach nicht fertig, mir das anzusehen. Dieser Ort war sehr, sehr wichtig für mich.« Die Stille, die bedingungslose Liebe seiner Großeltern, die Bewunderung, die ihm zuteil wurde. Dies war der Ort gewesen, an dem sich sein Bewusstsein entwickelt hatte. Er hatte hier so tiefe und so weit verzweigte Wurzeln geschlagen wie die irische Buche im Vorgarten.
»Ich dachte an früher«, sagt Bruce über das windschiefe Haus, in dem er sich immer daheim gefühlt hatte, »und mir wurde klar, dass dies der Ort war, der mir alles bedeutete.«
1 Je nachdem, welche genealogische Quelle man konsultiert, starb er entweder während der Überfahrt oder sogar noch bevor das Schiff den holländischen Hafen verließ.
2 Umso mehr, wenn man bedenkt, wie viele seiner Songs von Wild-West-Helden handeln, die fest entschlossen sind, ihr Leben in den Griff zu bekommen und ihm einen Sinn zu geben. Gefragt nach möglichen Zusammenhängen zwischen seinem liebsten Kinderbuch und seinem Lebenswerk, erwidert Bruce lachend: »Rosebud! Sie haben mein Rosebud entdeckt!« Wobei er nicht den Anschein erweckt, als würde er es ernst meinen.
3 Adele gab den Bitten ihres Sohnes, die St. Rose of Lima School verlassen zu dürfen, 1963 nach, gerade rechtzeitig, um es Bruce zu ermöglichen, auf die Freehold Regional High School zu wechseln.
4 Ab dieser Stelle scheiden sich über den weiteren Verlauf unserer Geschichte die Geister, da die Indians das zweite Spiel tatsächlich um ein Haar gewonnen hätten, hätte nicht Schiedsrichter Boots »Bootsy« Riddle eine von vielen als fragwürdig erachtete Entscheidung getroffen, in deren Folge die Cardinals schließlich das Spiel und damit auch die Meisterschaft ganz knapp gewannen. Zwar ist deren Trainer Barney DiBenedetto noch heute von der grundsätzlichen Überlegenheit seiner ehemaligen Mannschaft überzeugt, für Jimmy Mavroleon hingegen, der damals bei den Cardinals spielte, ist die Sache nicht ganz so klar. »Wir haben einfach Glück gehabt«, sagt er. Er und Bruce hatten 1976 Gelegenheit, ihre Erinnerungen aufzufrischen. Mavroleon wollte gerade im Monmouth Queen Diner, dem Lokal seiner Eltern, seine Nachtschicht beenden und die Kasse schließen, als Bruce zur Tür hereinkam und es sich bequem machte. Sie tauschten die neuesten Nachrichten aus und schwelgten in Erinnerungen an vergangene Zeiten und das unglaubliche Tempo von Jimmys legendären Fastballs. Wer nun glaubt, damit wäre die Frage geklärt, wer sich hinter dem verbirgt, der in »Glory Days« als derjenige bezeichnet wird, der »could throw that speed ball at you«, sollte sich Kevin Coynes Artikel über Joe DePugh (New York Times, 9. Juli 2011) zu Gemüte führen. Lance Rowe, der Sohn des Indians-Trainers, wiederum hält auch ehemalige Mannschaftskameraden für mögliche Kandidaten. Vielleicht ist es ja eine Kombination aus all diesem.